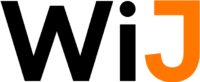Tagungsbericht zur Vortrags- und Diskussionsveranstaltung „Insolvenzstrafrecht in der Krise“
Am 29. November 2011 fand in den Räumlichkeiten des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofes in Leipzig die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung „Insolvenzstrafrecht in der Krise“ statt, deren Anliegen es war, über grundsätzliche, aktuelle und praktische Fragestellungen zum Insolvenzstrafrecht zu diskutieren und somit ein Forum für einen offenen Gedanken- und Erfahrungsaustausch der verschiedenen, mit dem Insolvenzstrafrecht in Berührung kommenden Berufsgruppen zu bilden. Ausgerichtet wurde diese vom WisteV-Arbeitskreis Insolvenzstrafrecht; die Moderation übernahm Rechtsanwalt Christof Püschel, strafverteidiger|büro, Köln. Die Veranstaltung stieß auf reges Interesse und wurde von einer Vielzahl von Teilnehmern aus Justiz, Wissenschaft und Praxis besucht.
Nach der Begrüßung und Einführung durch das WisteV Vorstandsmitglied Dr. Michael Racky, Siemens AG, ging Bundesanwalt Prof. Dr. Hartmut Schneider in seinem Grußwort der streitig diskutierten Frage nach, wer Rechtsbeistände juristischer Personen von deren strafprozessualer Schweigepflicht entbinden darf, sofern zwischen der relevanten, dem Schweigerecht unterfallenden Aussage und dem Zeitpunkt der Entbindungserklärung ein Personalwechsel innerhalb des Vertretungsorgans stattgefunden hat. Mit anderen Worten: Muss der ausgeschiedene Geschäftsführer einer GmbH, der einem für „seine“ GmbH tätigen Rechtsanwalt sensible, auch ihn persönlich betreffende Auskünfte erteilt hat, befürchten, dass sein Nachfolger in einem gegen ihn (den Altgeschäftsführer) geführten Strafverfahren den Anwalt von seiner Schweigepflicht wirksam entbindet? Vier Lösungen werden derzeit in Schrifttum und instanzgerichtlicher Rechtsprechung hierzu angeboten: Sie reichen von der Ansicht, wonach nur das ehemalige Organ zur Entbindung des Rechtsbeistands befugt ist, über die Auffassung, beide, also der frühere und der aktuelle Organwalter müssten gemeinsam die Entbindungserklärung abgeben, bis hin zu der These, zuständig zur Entbindung sei das Organ in seiner momentanen Besetzung. Vermittelnd tritt noch die Meinung hinzu, die danach differenziert, wessen Geheimnissphäre von der Zeugenaussage des Rechtsbeistands betroffen ist. Es liegt auf der Hand: Erlaubt man den aktuellen Organwaltern, den Berufsgeheimnisträger von seiner Schweigepflicht zu entbinden, gelangt man zu der für die Justizpraxis günstigsten Lösung. Denn insbesondere in Strafverfahren gegen die ehemaligen Organwalter werden ihre Nachfolger – vor allem, wenn es um die Aburteilung von gegen die juristische Person gerichteten Straftaten geht – nur allzu gerne bereit sein, die Entbindungserklärung abzugeben. Diese Bereitschaft dürfte sich noch potenzieren, wenn die Organstellung aufgrund der zwischenzeitlichen Insolvenz der juristischen Person auf einen Insolvenzverwalter übergegangen ist. Da dem ausgeschiedenen ehemaligen Organwalter laut Schneider die Entbindungsbefugnis wegen mangelnder Rechtskompetenz fehlt, scheiden die beiden Lösungen aus, nach denen es seiner Mitwirkung bedarf; eine mögliche Entbindung gehört nicht mehr zu seiner Rechtssphäre. Das Argument, wonach zwischen Rechtsbeistand und Organwalter ein Vertrauensverhältnis bestehe und schon deshalb dem früheren Vertretungsorgan die Kompetenz zum Erteilen der Entbindungserklärung zustehen müsse, lehnte der Referent ab. Auch einer Differenzierung nach Geheimnissphären widerspricht der Vortragende aus folgendem Grund: § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO unterscheide nicht zwischen einzelnen Geheimnissphären oder bestimmten Geheimnissen; der Norm sei eine Binnendifferenzierung fremd. Es erstaunt somit nicht, dass der Referent als ein Vertreter der Strafverfolgungspraxis der Ansicht den Vorzug gibt, die eine Erklärung der aktuellen Organwalter für die wirksame Entbindung von der Schweigepflicht genügen lässt. Die Möglichkeit, eine vertragliche Abrede mit der juristischen Person zu treffen, bleibt dem ehemaligen Organwalter dennoch erhalten. Jedoch müssen die Vertragspartner beachten, dass die Grenze des § 266 StGB nicht durch einen zu weit gehenden Vertrag tangiert wird.
Den Tagungsauftakt bildete der Vortrag von Akad. Rat a.Z. Dr. Christian Brand, Universität Konstanz, mit dem Thema „Legitimität des Insolvenzstrafrechts – Zur Strafwürdigkeit der Insolvenzdelikte angesichts der Finanzkrise“, der demnächst in der Zeitschrift für Insolvenzrecht (KTS) erscheinen wird. Anlass dazu boten das vom Gesetzgeber im Rahmen der Krisengesetzgebung verabschiedete Restrukturierungsgesetz sowie die Änderungen des InvG. Ob bzw. inwieweit im Kontext der Bankenkrise die Anwendung des Bankrottstrafrechts (§§ 283 ff. StGB) und der strafbewehrten Insolvenzverschleppung (§ 15a Abs. 4, 5 InsO) – bei Beteiligung einer Bank die diese ersetzende Anzeigepflicht gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (§§ 46b Abs. 1, 55 KWG) – aufgrund dieser Änderungen ihre Legitimität verlieren, bildeten die Schwerpunkte von Brands Überlegungen. Die erste „Legitimationslücke“ könnte, so Brand, ihre Ursache darin haben, dass bei systemrelevanten Banken staatliche Hilfsmaßnahmen die Entstehung der Insolvenzgründe „Zahlungsunfähigkeit“ bzw. „Überschuldung“ oder aber die Eröffnung des Insolvenzverfahrens verhindern. In diesen Fällen bleibt ein wirtschaftswidrig investierender Bankenmanager, im Gegensatz zu einem „normalen“ GmbH-Geschäftsführer, wegen § 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB straflos, da in der ersten Konstellation – wegen fehlender Verursachung der Insolvenzgründe – der objektive Tatbestand des § 283 Abs. 2 StGB nicht erfüllt ist und in der zweiten die objektive Strafbarkeitsbedingung gemäß § 283 Abs. 6 StGB fehlt. Der Referent zeigte sodann die verschiedenen, durch das Restrukturierungsgesetz geschaffenen Instrumentarien auf, die bestehen, wenn eine Bank in den „Strudel der Insolvenz“ gerät. Zur Vermeidung von Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung oder eines Insolvenzverfahrens stellte Brand dabei das im KredReorgG verankerten Reorganisationsverfahren (dessen Teilnehmer nur bestandsgefährdete systemrelevante Banken sein können) sowie die durch den Restrukturierungsfonds unterstützte aufsichtsrechtliche Übertragungsanordnung gemäß §§ 48a ff. KWG dar. Daran anschließend untersuchte der Redner die Auswirkungen der einzelnen Sanierungsoptionen auf die Legitimität des Insolvenzstrafrechts. Er stellte fest, dass jedenfalls keine legitimatorischen Bedenken angebracht sind, wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Rahmen der Ausgliederungsanordnung – wie es wohl regelmäßig der Fall sein wird – vorerst alle Vermögensbestandteile der angeschlagenen Bank auf eine neue „Brückenbank“ überträgt, um sodann – nach genauer Sichtung der nicht systemrelevanten Teile – die „toxischen, systematisch irrelevanten Bestandteile“ zurück zu übertragen. Denn obwohl die Rückübertragung häufig aufgrund der knappen Frist von vier Monaten gemäß § 48j Abs. 1 S. 1 KWG unterbleiben wird, steht als Anknüpfungspunkt für eine Bankrottstrafbarkeit die zumindest subsidiär weiter für alte Verbindlichkeiten haftende “Rechtsträgerhülle“ des strauchelnden Instituts zur Verfügung; wegen der Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung, die meist zur Insolvenzeröffnung führt, ist die objektive Strafbarkeitsbedingung nach § 283 Abs. 6 StGB üblicherweise verwirklicht.
Selbst in den Fällen, in denen erst das Dazwischentreten der BaFin in Form einer partiellen Übertragungsanordnung die Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung und Insolvenzeröffnung herbeiführt, sind keine Bedenken angebracht. Der Erfolgseintritt der Insolvenzeröffnungsgründe ist dem Manager nämlich trotzdem objektiv zurechenbar; ein eigenverantwortliches Dazwischentreten der BaFin liegt nicht vor.
Da der Zurechnungszusammenhang zwischen Tathandlung und objektiver Strafbarkeitsbedingung lediglich einen tatsächlichen und zeitlichen Bezug verlangt, ändert auch das Herbeiführen der objektiven Strafbarkeitsbedingung „Insolvenzeröffnung“ durch die BaFin bei schon bestehender Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung an diesem Ergebnis nichts.
Was den Bereich des Reorganisationsverfahrens angeht, besteht zwar eine Ungleichbehandlung im Vergleich von Managern systemrelevanter und bestandsgefährdeter Institute, die durch ein Reorganisationsverfahren eine Strafbarkeit gemäß § 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB abwenden können (vgl. oben), und „normalen“ GmbH-Geschäftsführern, denen dieses Instrumentarium nicht zur Verfügung steht. Jedoch führt auch diese Ungleichbehandlung nicht dazu, dass die Legitimität dahinschwindet. Denn obwohl GmbH-Geschäftsführer in den Fällen des § 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB bzw. § 283 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 StGB zur Unternehmensrettung mit staatlicher Unterstützung das vergleichbare Insolvenzplanverfahren erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens beschreiten können und somit durch Herbeiführung der objektiven Strafbarkeitsbedingung dem Verdikt von § 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB ausgesetzt sind, ist es, wie Brand darstellte, nicht notwendig, einen Sonderstraftatbestand für Manager von systemrelevanten Instituten zu schaffen, „die drohende Zahlungsunfähigkeit aus der Krisentrias des Tatbestandes zu streichen“ oder aber § 283 Abs. 6 StGB um eine speziell für die Vornahme der Übertragungsanordnung geltende Variante zu ergänzen. Die Privilegierung gilt nämlich weder uneingeschränkt noch für einen großen Teil von Bankmanagern (dazu ausführlich: Brand, KTS, im Erscheinen).
Die zweite „Legitimationslücke“, die der Referent untersuchte, ergibt sich daraus, dass Geschäftsleiter von Kapitalanlagegesellschaften und Investmentaktiengesellschaften wie solche von Kreditinstituten gemäß §§ 99 Abs. 3 S. 1, 19k InvG i.V.m. § 46b Abs. 1 S. 2 KWG von der Insolvenzantragspflicht des § 15a Abs. 1 InsO befreit sind. Stattdessen werden die betreffenden Person dazu verpflichtet, schon die drohende Zahlungsunfähigkeit der BaFin anzuzeigen. Jedoch droht einem Geschäftsleiter einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft bei Nichtbeachtung dieser Pflicht keine Bestrafung, wie dies bei Kreditinstituten gemäß § 55 KWG der Fall ist, sondern lediglich eine „Bebußung wegen einer Ordnungswidrigkeit“ gemäß § 143 Abs. 3 Nr. 5 InvG. Gründe, Manager dieser Gesellschaftsformen insolvenzstrafrechtlich zu privilegieren, existieren laut Brand nicht; es bestehe kein „geringeres Gläubigergefährdungspotenzial“ als dies bei Kreditinstituten der Fall sei. Daher müsse der Gesetzgeber zur Auflösung dieser Ungleichbehandlung tätig werden.
Anschließend widmete sich Staatsanwalt Christian Brudnicki, Leipzig, dem Thema „Strafrechtliche Implikationen des ESUG“. Als Leiter der Unterabteilung WESP, stellte der Referent einleitend die gemeinsame Ermittlungsgruppe von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten (WESP) in Leipzig vor. Diese hat das Ziel, die Ermittlungsarbeit durch eine besonders enge Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei zu intensivieren und zu verbessern und die Akzeptanz der Strafverfolgung zu erhöhen; pro Jahr werden ca. 700 Ermittlungsverfahren bearbeitet. Daraufhin zeigte Brudnicki einige durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) entstandene Änderungen auf. Zunächst wurde eine redaktionelle Neuerung in § 15a InsO in den Blick genommen, die das Wort „Insolvenzantrag“ in „Eröffnungsantrag“ modifiziert. Dies könnte, so der Redner, Auswirkungen auf die Akzeptanz der strafrechtlichen Verfolgung haben und diese stärken, was im Gleichlauf mit einem der Ziele der WESP stände. Sodann beschäftige sich der Referent mit der „verschärften Mitwirkungspflicht“ des § 13 Abs. 1 InsO, nach der ein Schuldner nunmehr dem Eröffnungsantrag ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen beizufügen hat sowie weitere zusätzliche Angaben zu machen sind, wenn der Schuldner die Eigenverwaltung beantragt, die Merkmale des § 22a Abs. 1 InsO erfüllt oder die Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses beantragt wurde. Ob diese verschärfte Mitwirkungspflicht des Schuldners in der Praxis durchsetzbar ist, bezweifelte Brudnicki. Denn bereits jetzt sei die Mitwirkung bei „unwilligen Schuldnern“ schwer durchsetzbar. Daraufhin wandte sich der Redner dem neu eingefügten § 26 Abs. 4 InsO zu, dessen Ziel es sei, „den Schuldner (bzw. dessen Vertreter/Geschäftsführer) [bei Vorliegen der Voraussetzungen einer Insolvenzverschleppung] bereits im Vorfeld zur Massekostendeckung [verpflichtend] heran zu ziehen und nicht nur die nachträgliche Inanspruchnahme durch einen vorschießenden Gläubiger zu ermöglichen“. Das Insolvenzverfahren soll dadurch eröffnet und somit Vermögenswerte für die Gläubiger gesichert werden. Denn schon die Gesetzesmaterialien und das Beispiel Leipzig zeigten – der Insolvenzgerichtsbezirk Leipzig hat pro Jahr ca. 400 Abweisungen mangels Masse zu beklagen, wobei „vorschießende Gläubiger“ nahezu nicht ins Gewicht fallen –, dass das Kostenrisiko für einen Vorschuss nach § 26 Abs. 3 InsO zu hoch ist und diese Norm daher in der Praxis keine allzu große Rolle spielt; ein Bedürfnis nach dieser Neuerung bestehe daher. Da bei natürlichen Personen häufig keine Mittel zur Leistung des Vorschusses vorhanden sind, kritisierte Brudnicki zugleich die fehlende Relevanz von § 26 Abs. 4 InsO, wenn keine juristische Person die Rolle des Schuldners einnimmt. Zudem forderte er eine Klarstellung, ob auch ein faktischer Geschäftsführer erfasst ist. Da Geschäftsleiter aus Furcht vor strafrechtlichen und haftungsrechtlichen Folgen regelmäßig das Vorliegen der Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 InsO bestreiten werden und der vorläufige Insolvenzverwalter somit dazu „gezwungen“ wird, den Anspruch in einem langwierigen Verfahren gerichtlich geltend zu machen, zweifelte der Vortragende an der Effektivität der Neuregelung. Außerdem warf er die Frage auf, wer die Kosten eines solchen Verfahrens zu tragen habe. Schließlich thematisierte Brudnicki einige weitere „Folgeprobleme“: Da staatsanwaltliche Ermittlungen vor einem „angedachten oder laufenden Insolvenzverfahren“ zur Feststellung der Insolvenzverschleppung „an Wert gewinnen“, erwartet der Redner eine Vielzahl an Akteneinsichtsgesuchen und vorsorglichen Anzeigen durch Gläubiger oder Insolvenzgutachter, was die Verfahrendauer und -kosten erheblich steigern wird. Denn reichte den Strafverfolgungsbehörden nach alter Rechtslage noch regelmäßig das Insolvenzgutachten für eine summarische Prüfung, befürchtet der Vortragende, dass nunmehr „die Erkenntnisse des Gutachters […] perspektivisch von den Strafverfolgungsbehörden selbst ermittelt werden“ müssen. Für die Strafverfolgungsbehörden positiv sieht Brudnicki die Neuregelung daher nur, wenn die zivilrechtliche Inanspruchnahme gemäß § 26 Abs. 4 InsO vor dem Ermittlungsverfahren erfolgt.
Der „Diskussionsvortrag“ von LOStA Folker Bittmann, Dessau-Roßlau, und Rechtsanwalt Dr. Carsten Wegner, Krause und Kollegen, Berlin, mit dem Titel „Das Verwendungsverbot des § 97 Abs. 1 S. 3 InsO“, der die mit dem Verwendungsverbot einhergehenden Probleme beleuchtete, bildete den Schlusspunkt der Veranstaltung (vgl. zum Ganzen auch die WisteV-Standards, Bittmann, WiJ 2012, 144 ff.). Dabei vertraten die beiden Referenten bei vielen der streitigen Fragen die jeweils gegenteilige Ansicht, wobei Bittmann zumeist die „justizfreundlichen“ und Wegner die „beschuldigtenfreundlichen“ Argumente für sich in Anspruch nahm. Das Ausgangsproblem, mit dem sich die Redner beschäftigten, war der Konflikt zwischen einer umfassenden Auskunftspflicht des Verpflichteten im Insolvenzverfahren im Interesse der Gläubiger auf der einen und dem aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG abgeleiteten verfassungsverbürgten Schweigerecht des Beschuldigten im Ermittlungs- und Strafverfahren als Ausprägung des „Nemo-tenetur-Prinzips“ auf der anderen Seite. Die Referenten stellten zunächst dar, dass sich die durch den Gemeinschuldnerbeschluss des BVerfG (BVerfGE 56, 37) zunächst als Verwertungsverbot ausgestaltete Untersagung des § 97 Abs. 1 S. 3 InsO mit Inkrafttreten der Insolvenzordnung 1999 zu einem weitergehenden Verwendungsverbot wandelte, das auch die sogenannte Fernwirkung erfasst. Danach dürfen Erkenntnisquellen, die durch die Auskunft des Schuldners bzw. bei juristischen Personen seiner Organe erlangt worden sind, nicht verwendet werden und die Auskunft auch nicht zu weiteren Erkenntnisquellen führen. Hingegen dürften, so die Vortragenden noch übereinstimmend, die Insolvenzgerichte die Staatsanwaltschaft wegen des schon 1998 und somit – trotz Verabschiedung der InsO im Jahr 1994 – vor der InsO in Kraft getretenen Justizmitteilungsgesetzes als Grundlage der „Mitteilungen über Zivilsachen“, auf ein eröffnetes Insolvenzverfahren oder die Abweisung mangels Masse hinweisen. Dies gelte auch bei einem Eigenantrag des Schuldners. Erste Unterschiede wurden bereits deutlich bei der Frage, ob die Staatsanwaltschaft dazu berechtigt ist, Insolvenzakten mitsamt den darin enthaltenen Auskünften des Schuldners zu lesen; jedenfalls gibt es aber kein Recht, Informationen, die darin enthalten sind und der Auskunftspflicht des § 97 Abs. 1 S. 1 InsO unterfallen, zu verwenden. Über die Frage, ob das Verwendungsverbot darüber hinaus Äußerungen, die dem Gutachter im Insolvenzeröffnungsverfahren gegenüber erklärt wurden, erfasst, waren sich die Redner ebenfalls einig. Da der Gutachter lediglich Helfer des Insolvenzgerichtes ist und somit Äußerungen diesem gegenüber auch „mittelbare Angaben gegenüber dem Insolvenzgericht“ sind, greift § 97 Abs. 1 S. 3 InsO. Im weiteren wurden durch die Vortragenden vor allem folgende Thesen kontrovers diskutiert: Sind Erklärungen des Schuldners – auch in Erfüllung sonstiger gesetzlicher Pflichten – im Eigenantrag zur Insolvenzeröffnung von § 97 Abs. 1 S. 3 InsO erfasst bzw. gilt dies auch für die durch das ESUG beizufügende Gläubigerliste? Wie sind freiwillige Äußerungen, beispielsweise gegenüber dem Insolvenzgericht, aufgrund eines Irrtums über die Person des Insolvenzverwalters oder seiner Mitarbeiter zu behandeln? Können Falschauskünfte sowie Informationen, die durch beredtes Schweigen gewonnen werden, verwendet werden? Des Weiteren setzten sich Bittmann und Wegner mit der Frage auseinander, ob der Inhalt von Büchern und Bilanzen dem Verwendungsverbot unterliegt. Bittmann argumentierte, dass diese „nicht aufgrund insolvenzrechtlicher Pflichten geführt“ bzw. erstellt werden und somit frei verwendbar sind; sollte aber das Versteck, in dem diese Unterlagen verborgen sind, durch eine Auskunft gemäß § 97 Abs. 1 S. 1 InsO bekannt werden, so solle diese von § 97 Abs. 1 S. 3 InsO umfasst sein. Erörtert wurde zudem, ob Kundgaben, die grundsätzlich dem Verwendungsverbot unterfallen, in einem Verfahren gegen weitere Verantwortliche wie Mitgeschäftsführer verwendet werden dürfen bzw. sollte dies der Fall sein, ob das „nur [für] selbstständige Verfahren gilt oder auch bei Ermittlungen in einem Verfahren gegen alle Verantwortliche“. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft führte Bittmann noch aus, dass bei unrechtmäßiger strafprozessualer Verwertung von Informationen, die § 97 Abs. 1 S. 1 InsO unterliegen, diese im Ermittlungs- und Strafverfahren „dann weiter genutzt werden [dürfen], wenn sie sich auch auf eine von der Auskunft unabhängige, also uneingeschränkt verwertbare Quelle zurückführen“ lassen. Schlussendlich wurde noch der Frage nachgegangen, wie sich die Stellung des Insolvenzverwalters im Ermittlungs- und Strafverfahren darstellt: Die Referenten waren sich einig, dass diesem kein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, sondern bezüglich der Verwendbarkeit seiner Aussage ein inhaltlicher Gleichlauf mit § 97 Abs. 1 S. 3 InsO zu präferieren ist.
[:en]
Am 29. November 2011 fand in den Räumlichkeiten des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofes in Leipzig die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung „Insolvenzstrafrecht in der Krise“ statt, deren Anliegen es war, über grundsätzliche, aktuelle und praktische Fragestellungen zum Insolvenzstrafrecht zu diskutieren und somit ein Forum für einen offenen Gedanken- und Erfahrungsaustausch der verschiedenen, mit dem Insolvenzstrafrecht in Berührung kommenden Berufsgruppen zu bilden. Ausgerichtet wurde diese vom WisteV-Arbeitskreis Insolvenzstrafrecht; die Moderation übernahm Rechtsanwalt Christof Püschel, strafverteidiger|büro, Köln. Die Veranstaltung stieß auf reges Interesse und wurde von einer Vielzahl von Teilnehmern aus Justiz, Wissenschaft und Praxis besucht.
Nach der Begrüßung und Einführung durch das WisteV Vorstandsmitglied Dr. Michael Racky, Siemens AG, ging Bundesanwalt Prof. Dr. Hartmut Schneider in seinem Grußwort der streitig diskutierten Frage nach, wer Rechtsbeistände juristischer Personen von deren strafprozessualer Schweigepflicht entbinden darf, sofern zwischen der relevanten, dem Schweigerecht unterfallenden Aussage und dem Zeitpunkt der Entbindungserklärung ein Personalwechsel innerhalb des Vertretungsorgans stattgefunden hat. Mit anderen Worten: Muss der ausgeschiedene Geschäftsführer einer GmbH, der einem für „seine“ GmbH tätigen Rechtsanwalt sensible, auch ihn persönlich betreffende Auskünfte erteilt hat, befürchten, dass sein Nachfolger in einem gegen ihn (den Altgeschäftsführer) geführten Strafverfahren den Anwalt von seiner Schweigepflicht wirksam entbindet? Vier Lösungen werden derzeit in Schrifttum und instanzgerichtlicher Rechtsprechung hierzu angeboten: Sie reichen von der Ansicht, wonach nur das ehemalige Organ zur Entbindung des Rechtsbeistands befugt ist, über die Auffassung, beide, also der frühere und der aktuelle Organwalter müssten gemeinsam die Entbindungserklärung abgeben, bis hin zu der These, zuständig zur Entbindung sei das Organ in seiner momentanen Besetzung. Vermittelnd tritt noch die Meinung hinzu, die danach differenziert, wessen Geheimnissphäre von der Zeugenaussage des Rechtsbeistands betroffen ist. Es liegt auf der Hand: Erlaubt man den aktuellen Organwaltern, den Berufsgeheimnisträger von seiner Schweigepflicht zu entbinden, gelangt man zu der für die Justizpraxis günstigsten Lösung. Denn insbesondere in Strafverfahren gegen die ehemaligen Organwalter werden ihre Nachfolger – vor allem, wenn es um die Aburteilung von gegen die juristische Person gerichteten Straftaten geht – nur allzu gerne bereit sein, die Entbindungserklärung abzugeben. Diese Bereitschaft dürfte sich noch potenzieren, wenn die Organstellung aufgrund der zwischenzeitlichen Insolvenz der juristischen Person auf einen Insolvenzverwalter übergegangen ist. Da dem ausgeschiedenen ehemaligen Organwalter laut Schneider die Entbindungsbefugnis wegen mangelnder Rechtskompetenz fehlt, scheiden die beiden Lösungen aus, nach denen es seiner Mitwirkung bedarf; eine mögliche Entbindung gehört nicht mehr zu seiner Rechtssphäre. Das Argument, wonach zwischen Rechtsbeistand und Organwalter ein Vertrauensverhältnis bestehe und schon deshalb dem früheren Vertretungsorgan die Kompetenz zum Erteilen der Entbindungserklärung zustehen müsse, lehnte der Referent ab. Auch einer Differenzierung nach Geheimnissphären widerspricht der Vortragende aus folgendem Grund: § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO unterscheide nicht zwischen einzelnen Geheimnissphären oder bestimmten Geheimnissen; der Norm sei eine Binnendifferenzierung fremd. Es erstaunt somit nicht, dass der Referent als ein Vertreter der Strafverfolgungspraxis der Ansicht den Vorzug gibt, die eine Erklärung der aktuellen Organwalter für die wirksame Entbindung von der Schweigepflicht genügen lässt. Die Möglichkeit, eine vertragliche Abrede mit der juristischen Person zu treffen, bleibt dem ehemaligen Organwalter dennoch erhalten. Jedoch müssen die Vertragspartner beachten, dass die Grenze des § 266 StGB nicht durch einen zu weit gehenden Vertrag tangiert wird.
Den Tagungsauftakt bildete der Vortrag von Akad. Rat a.Z. Dr. Christian Brand, Universität Konstanz, mit dem Thema „Legitimität des Insolvenzstrafrechts – Zur Strafwürdigkeit der Insolvenzdelikte angesichts der Finanzkrise“, der demnächst in der Zeitschrift für Insolvenzrecht (KTS) erscheinen wird. Anlass dazu boten das vom Gesetzgeber im Rahmen der Krisengesetzgebung verabschiedete Restrukturierungsgesetz sowie die Änderungen des InvG. Ob bzw. inwieweit im Kontext der Bankenkrise die Anwendung des Bankrottstrafrechts (§§ 283 ff. StGB) und der strafbewehrten Insolvenzverschleppung (§ 15a Abs. 4, 5 InsO) – bei Beteiligung einer Bank die diese ersetzende Anzeigepflicht gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (§§ 46b Abs. 1, 55 KWG) – aufgrund dieser Änderungen ihre Legitimität verlieren, bildeten die Schwerpunkte von Brands Überlegungen. Die erste „Legitimationslücke“ könnte, so Brand, ihre Ursache darin haben, dass bei systemrelevanten Banken staatliche Hilfsmaßnahmen die Entstehung der Insolvenzgründe „Zahlungsunfähigkeit“ bzw. „Überschuldung“ oder aber die Eröffnung des Insolvenzverfahrens verhindern. In diesen Fällen bleibt ein wirtschaftswidrig investierender Bankenmanager, im Gegensatz zu einem „normalen“ GmbH-Geschäftsführer, wegen § 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB straflos, da in der ersten Konstellation – wegen fehlender Verursachung der Insolvenzgründe – der objektive Tatbestand des § 283 Abs. 2 StGB nicht erfüllt ist und in der zweiten die objektive Strafbarkeitsbedingung gemäß § 283 Abs. 6 StGB fehlt. Der Referent zeigte sodann die verschiedenen, durch das Restrukturierungsgesetz geschaffenen Instrumentarien auf, die bestehen, wenn eine Bank in den „Strudel der Insolvenz“ gerät. Zur Vermeidung von Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung oder eines Insolvenzverfahrens stellte Brand dabei das im KredReorgG verankerten Reorganisationsverfahren (dessen Teilnehmer nur bestandsgefährdete systemrelevante Banken sein können) sowie die durch den Restrukturierungsfonds unterstützte aufsichtsrechtliche Übertragungsanordnung gemäß §§ 48a ff. KWG dar. Daran anschließend untersuchte der Redner die Auswirkungen der einzelnen Sanierungsoptionen auf die Legitimität des Insolvenzstrafrechts. Er stellte fest, dass jedenfalls keine legitimatorischen Bedenken angebracht sind, wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Rahmen der Ausgliederungsanordnung – wie es wohl regelmäßig der Fall sein wird – vorerst alle Vermögensbestandteile der angeschlagenen Bank auf eine neue „Brückenbank“ überträgt, um sodann – nach genauer Sichtung der nicht systemrelevanten Teile – die „toxischen, systematisch irrelevanten Bestandteile“ zurück zu übertragen. Denn obwohl die Rückübertragung häufig aufgrund der knappen Frist von vier Monaten gemäß § 48j Abs. 1 S. 1 KWG unterbleiben wird, steht als Anknüpfungspunkt für eine Bankrottstrafbarkeit die zumindest subsidiär weiter für alte Verbindlichkeiten haftende “Rechtsträgerhülle“ des strauchelnden Instituts zur Verfügung; wegen der Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung, die meist zur Insolvenzeröffnung führt, ist die objektive Strafbarkeitsbedingung nach § 283 Abs. 6 StGB üblicherweise verwirklicht.
Selbst in den Fällen, in denen erst das Dazwischentreten der BaFin in Form einer partiellen Übertragungsanordnung die Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung und Insolvenzeröffnung herbeiführt, sind keine Bedenken angebracht. Der Erfolgseintritt der Insolvenzeröffnungsgründe ist dem Manager nämlich trotzdem objektiv zurechenbar; ein eigenverantwortliches Dazwischentreten der BaFin liegt nicht vor.
Da der Zurechnungszusammenhang zwischen Tathandlung und objektiver Strafbarkeitsbedingung lediglich einen tatsächlichen und zeitlichen Bezug verlangt, ändert auch das Herbeiführen der objektiven Strafbarkeitsbedingung „Insolvenzeröffnung“ durch die BaFin bei schon bestehender Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung an diesem Ergebnis nichts.
Was den Bereich des Reorganisationsverfahrens angeht, besteht zwar eine Ungleichbehandlung im Vergleich von Managern systemrelevanter und bestandsgefährdeter Institute, die durch ein Reorganisationsverfahren eine Strafbarkeit gemäß § 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB abwenden können (vgl. oben), und „normalen“ GmbH-Geschäftsführern, denen dieses Instrumentarium nicht zur Verfügung steht. Jedoch führt auch diese Ungleichbehandlung nicht dazu, dass die Legitimität dahinschwindet. Denn obwohl GmbH-Geschäftsführer in den Fällen des § 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB bzw. § 283 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 StGB zur Unternehmensrettung mit staatlicher Unterstützung das vergleichbare Insolvenzplanverfahren erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens beschreiten können und somit durch Herbeiführung der objektiven Strafbarkeitsbedingung dem Verdikt von § 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB ausgesetzt sind, ist es, wie Brand darstellte, nicht notwendig, einen Sonderstraftatbestand für Manager von systemrelevanten Instituten zu schaffen, „die drohende Zahlungsunfähigkeit aus der Krisentrias des Tatbestandes zu streichen“ oder aber § 283 Abs. 6 StGB um eine speziell für die Vornahme der Übertragungsanordnung geltende Variante zu ergänzen. Die Privilegierung gilt nämlich weder uneingeschränkt noch für einen großen Teil von Bankmanagern (dazu ausführlich: Brand, KTS, im Erscheinen).
Die zweite „Legitimationslücke“, die der Referent untersuchte, ergibt sich daraus, dass Geschäftsleiter von Kapitalanlagegesellschaften und Investmentaktiengesellschaften wie solche von Kreditinstituten gemäß §§ 99 Abs. 3 S. 1, 19k InvG i.V.m. § 46b Abs. 1 S. 2 KWG von der Insolvenzantragspflicht des § 15a Abs. 1 InsO befreit sind. Stattdessen werden die betreffenden Person dazu verpflichtet, schon die drohende Zahlungsunfähigkeit der BaFin anzuzeigen. Jedoch droht einem Geschäftsleiter einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft bei Nichtbeachtung dieser Pflicht keine Bestrafung, wie dies bei Kreditinstituten gemäß § 55 KWG der Fall ist, sondern lediglich eine „Bebußung wegen einer Ordnungswidrigkeit“ gemäß § 143 Abs. 3 Nr. 5 InvG. Gründe, Manager dieser Gesellschaftsformen insolvenzstrafrechtlich zu privilegieren, existieren laut Brand nicht; es bestehe kein „geringeres Gläubigergefährdungspotenzial“ als dies bei Kreditinstituten der Fall sei. Daher müsse der Gesetzgeber zur Auflösung dieser Ungleichbehandlung tätig werden.
Anschließend widmete sich Staatsanwalt Christian Brudnicki, Leipzig, dem Thema „Strafrechtliche Implikationen des ESUG“. Als Leiter der Unterabteilung WESP, stellte der Referent einleitend die gemeinsame Ermittlungsgruppe von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten (WESP) in Leipzig vor. Diese hat das Ziel, die Ermittlungsarbeit durch eine besonders enge Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei zu intensivieren und zu verbessern und die Akzeptanz der Strafverfolgung zu erhöhen; pro Jahr werden ca. 700 Ermittlungsverfahren bearbeitet. Daraufhin zeigte Brudnicki einige durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) entstandene Änderungen auf. Zunächst wurde eine redaktionelle Neuerung in § 15a InsO in den Blick genommen, die das Wort „Insolvenzantrag“ in „Eröffnungsantrag“ modifiziert. Dies könnte, so der Redner, Auswirkungen auf die Akzeptanz der strafrechtlichen Verfolgung haben und diese stärken, was im Gleichlauf mit einem der Ziele der WESP stände. Sodann beschäftige sich der Referent mit der „verschärften Mitwirkungspflicht“ des § 13 Abs. 1 InsO, nach der ein Schuldner nunmehr dem Eröffnungsantrag ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen beizufügen hat sowie weitere zusätzliche Angaben zu machen sind, wenn der Schuldner die Eigenverwaltung beantragt, die Merkmale des § 22a Abs. 1 InsO erfüllt oder die Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses beantragt wurde. Ob diese verschärfte Mitwirkungspflicht des Schuldners in der Praxis durchsetzbar ist, bezweifelte Brudnicki. Denn bereits jetzt sei die Mitwirkung bei „unwilligen Schuldnern“ schwer durchsetzbar. Daraufhin wandte sich der Redner dem neu eingefügten § 26 Abs. 4 InsO zu, dessen Ziel es sei, „den Schuldner (bzw. dessen Vertreter/Geschäftsführer) [bei Vorliegen der Voraussetzungen einer Insolvenzverschleppung] bereits im Vorfeld zur Massekostendeckung [verpflichtend] heran zu ziehen und nicht nur die nachträgliche Inanspruchnahme durch einen vorschießenden Gläubiger zu ermöglichen“. Das Insolvenzverfahren soll dadurch eröffnet und somit Vermögenswerte für die Gläubiger gesichert werden. Denn schon die Gesetzesmaterialien und das Beispiel Leipzig zeigten – der Insolvenzgerichtsbezirk Leipzig hat pro Jahr ca. 400 Abweisungen mangels Masse zu beklagen, wobei „vorschießende Gläubiger“ nahezu nicht ins Gewicht fallen –, dass das Kostenrisiko für einen Vorschuss nach § 26 Abs. 3 InsO zu hoch ist und diese Norm daher in der Praxis keine allzu große Rolle spielt; ein Bedürfnis nach dieser Neuerung bestehe daher. Da bei natürlichen Personen häufig keine Mittel zur Leistung des Vorschusses vorhanden sind, kritisierte Brudnicki zugleich die fehlende Relevanz von § 26 Abs. 4 InsO, wenn keine juristische Person die Rolle des Schuldners einnimmt. Zudem forderte er eine Klarstellung, ob auch ein faktischer Geschäftsführer erfasst ist. Da Geschäftsleiter aus Furcht vor strafrechtlichen und haftungsrechtlichen Folgen regelmäßig das Vorliegen der Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 InsO bestreiten werden und der vorläufige Insolvenzverwalter somit dazu „gezwungen“ wird, den Anspruch in einem langwierigen Verfahren gerichtlich geltend zu machen, zweifelte der Vortragende an der Effektivität der Neuregelung. Außerdem warf er die Frage auf, wer die Kosten eines solchen Verfahrens zu tragen habe. Schließlich thematisierte Brudnicki einige weitere „Folgeprobleme“: Da staatsanwaltliche Ermittlungen vor einem „angedachten oder laufenden Insolvenzverfahren“ zur Feststellung der Insolvenzverschleppung „an Wert gewinnen“, erwartet der Redner eine Vielzahl an Akteneinsichtsgesuchen und vorsorglichen Anzeigen durch Gläubiger oder Insolvenzgutachter, was die Verfahrendauer und -kosten erheblich steigern wird. Denn reichte den Strafverfolgungsbehörden nach alter Rechtslage noch regelmäßig das Insolvenzgutachten für eine summarische Prüfung, befürchtet der Vortragende, dass nunmehr „die Erkenntnisse des Gutachters […] perspektivisch von den Strafverfolgungsbehörden selbst ermittelt werden“ müssen. Für die Strafverfolgungsbehörden positiv sieht Brudnicki die Neuregelung daher nur, wenn die zivilrechtliche Inanspruchnahme gemäß § 26 Abs. 4 InsO vor dem Ermittlungsverfahren erfolgt.
Der „Diskussionsvortrag“ von LOStA Folker Bittmann, Dessau-Roßlau, und Rechtsanwalt Dr. Carsten Wegner, Krause und Kollegen, Berlin, mit dem Titel „Das Verwendungsverbot des § 97 Abs. 1 S. 3 InsO“, der die mit dem Verwendungsverbot einhergehenden Probleme beleuchtete, bildete den Schlusspunkt der Veranstaltung (vgl. zum Ganzen auch die WisteV-Standards, Bittmann, WiJ 2012, 144 ff.). Dabei vertraten die beiden Referenten bei vielen der streitigen Fragen die jeweils gegenteilige Ansicht, wobei Bittmann zumeist die „justizfreundlichen“ und Wegner die „beschuldigtenfreundlichen“ Argumente für sich in Anspruch nahm. Das Ausgangsproblem, mit dem sich die Redner beschäftigten, war der Konflikt zwischen einer umfassenden Auskunftspflicht des Verpflichteten im Insolvenzverfahren im Interesse der Gläubiger auf der einen und dem aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG abgeleiteten verfassungsverbürgten Schweigerecht des Beschuldigten im Ermittlungs- und Strafverfahren als Ausprägung des „Nemo-tenetur-Prinzips“ auf der anderen Seite. Die Referenten stellten zunächst dar, dass sich die durch den Gemeinschuldnerbeschluss des BVerfG (BVerfGE 56, 37) zunächst als Verwertungsverbot ausgestaltete Untersagung des § 97 Abs. 1 S. 3 InsO mit Inkrafttreten der Insolvenzordnung 1999 zu einem weitergehenden Verwendungsverbot wandelte, das auch die sogenannte Fernwirkung erfasst. Danach dürfen Erkenntnisquellen, die durch die Auskunft des Schuldners bzw. bei juristischen Personen seiner Organe erlangt worden sind, nicht verwendet werden und die Auskunft auch nicht zu weiteren Erkenntnisquellen führen. Hingegen dürften, so die Vortragenden noch übereinstimmend, die Insolvenzgerichte die Staatsanwaltschaft wegen des schon 1998 und somit – trotz Verabschiedung der InsO im Jahr 1994 – vor der InsO in Kraft getretenen Justizmitteilungsgesetzes als Grundlage der „Mitteilungen über Zivilsachen“, auf ein eröffnetes Insolvenzverfahren oder die Abweisung mangels Masse hinweisen. Dies gelte auch bei einem Eigenantrag des Schuldners. Erste Unterschiede wurden bereits deutlich bei der Frage, ob die Staatsanwaltschaft dazu berechtigt ist, Insolvenzakten mitsamt den darin enthaltenen Auskünften des Schuldners zu lesen; jedenfalls gibt es aber kein Recht, Informationen, die darin enthalten sind und der Auskunftspflicht des § 97 Abs. 1 S. 1 InsO unterfallen, zu verwenden. Über die Frage, ob das Verwendungsverbot darüber hinaus Äußerungen, die dem Gutachter im Insolvenzeröffnungsverfahren gegenüber erklärt wurden, erfasst, waren sich die Redner ebenfalls einig. Da der Gutachter lediglich Helfer des Insolvenzgerichtes ist und somit Äußerungen diesem gegenüber auch „mittelbare Angaben gegenüber dem Insolvenzgericht“ sind, greift § 97 Abs. 1 S. 3 InsO. Im weiteren wurden durch die Vortragenden vor allem folgende Thesen kontrovers diskutiert: Sind Erklärungen des Schuldners – auch in Erfüllung sonstiger gesetzlicher Pflichten – im Eigenantrag zur Insolvenzeröffnung von § 97 Abs. 1 S. 3 InsO erfasst bzw. gilt dies auch für die durch das ESUG beizufügende Gläubigerliste? Wie sind freiwillige Äußerungen, beispielsweise gegenüber dem Insolvenzgericht, aufgrund eines Irrtums über die Person des Insolvenzverwalters oder seiner Mitarbeiter zu behandeln? Können Falschauskünfte sowie Informationen, die durch beredtes Schweigen gewonnen werden, verwendet werden? Des Weiteren setzten sich Bittmann und Wegner mit der Frage auseinander, ob der Inhalt von Büchern und Bilanzen dem Verwendungsverbot unterliegt. Bittmann argumentierte, dass diese „nicht aufgrund insolvenzrechtlicher Pflichten geführt“ bzw. erstellt werden und somit frei verwendbar sind; sollte aber das Versteck, in dem diese Unterlagen verborgen sind, durch eine Auskunft gemäß § 97 Abs. 1 S. 1 InsO bekannt werden, so solle diese von § 97 Abs. 1 S. 3 InsO umfasst sein. Erörtert wurde zudem, ob Kundgaben, die grundsätzlich dem Verwendungsverbot unterfallen, in einem Verfahren gegen weitere Verantwortliche wie Mitgeschäftsführer verwendet werden dürfen bzw. sollte dies der Fall sein, ob das „nur [für] selbstständige Verfahren gilt oder auch bei Ermittlungen in einem Verfahren gegen alle Verantwortliche“. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft führte Bittmann noch aus, dass bei unrechtmäßiger strafprozessualer Verwertung von Informationen, die § 97 Abs. 1 S. 1 InsO unterliegen, diese im Ermittlungs- und Strafverfahren „dann weiter genutzt werden [dürfen], wenn sie sich auch auf eine von der Auskunft unabhängige, also uneingeschränkt verwertbare Quelle zurückführen“ lassen. Schlussendlich wurde noch der Frage nachgegangen, wie sich die Stellung des Insolvenzverwalters im Ermittlungs- und Strafverfahren darstellt: Die Referenten waren sich einig, dass diesem kein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, sondern bezüglich der Verwendbarkeit seiner Aussage ein inhaltlicher Gleichlauf mit § 97 Abs. 1 S. 3 InsO zu präferieren ist.