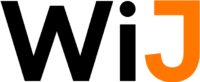Der Pflichtwidrigkeitsvorsatz der Untreue. Zugleich ein Beitrag zur gesetzlichen Bestimmtheit des § 266 StGB
Von Lasse Dinter, Schriften zum Wirtschaftsstrafrecht, C.F. Müller Heidelberg u.a. 2012 – XI, 148 S., 49,95 Euro
§ 266 StGB hat sich in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Strafvorschriften des Wirtschaftsstrafrechts entwickelt. Allerdings gelten zentrale dogmatische Fragen als ungelöst. So hat der 3. Strafsenat des BGH im Mannesmann-Urteil (BGHSt 50, 331 ff.) die Frage offen gelassen, ob der Irrtum über die Pflichtwidrigkeit einen Tatbestands- oder einen Verbotsirrtum begründet: Eine sachgerechte Einordnung lasse sich „nicht durch schlichte Anwendung einfacher Formeln ohne Rücksicht auf wertende Kriterien und differenzierende Betrachtungen“ erreichen. Dinter hat es sich in seiner Münsteraner Dissertation, die von Mark Deiters betreut wurde, zum Ziel gesetzt, eine praxistaugliche Lösung zu entwickeln.
Im einleitenden ersten Teil stellt Dinter zunächst das bisherige Meinungsspektrum vor. Das Schrifttum begreife die Pflichtwidrigkeit entweder als „normatives Tatbestandsmerkmal“, was die Anwendung der Regeln des Tatbestandsirrtums nahe lege, oder aber als „Blankett“, „blankettartiges Merkmal“ bzw. „gesamttatbewertendes Merkmal“, was für die Anwendung der Regeln des Verbotsirrtums spreche. Der BGH gehe dagegen von einem „komplexen“ normativen Tatbestandsmerkmal aus, bei dem der Irrtum über die Pflichtwidrigkeit nicht zwangsläufig zu einem Tatbestandsirrtum führe, sondern auch einen Verbotsirrtum darstellen könne.
Im zweiten Teil analysiert Dinter die grundsätzliche Abgrenzung des Tatbestandsirrtums vom Verbotsirrtum. Beim Pflichtwidrigkeitsmerkmal der Untreue lasse sich entweder auf die Tatsachen-, die Rechtsfolgen- oder die Rechtskenntnis abstellen, womit drei „Vorsatzmodelle“ existieren. Bei Untreuetaten könne daher gegebenenfalls bereits die Kenntnis der die Verhaltensnormen begründenden Tatsachen einen Appell an den Täter richten, über die Rechtmäßigkeit nachzudenken, ohne dass der Pflichtverstoß erkannt worden sein müsse. Die Pflichtwidrigkeit begreift Dinter als ein „teilweise verhaltensnormenvermittelndes Tatbestandsmerkmal“, das nicht auf eine, sondern auf mehrere Verhaltensnormen Bezug nimmt. Deshalb könne ein Verstoß gegen das allgemeine Schädigungsverbot noch keine Untreue begründen. Die bloße Verursachung eines Nachteils vermittle keinen hinreichenden Unrechtsimpuls, womit der Schluss vom Nachteils- auf den Pflichtwidrigkeitsvorsatz unzulässig sei.
Im dritten Teil befasst sich Dinter mit der Frage, welche Umstände der Täter erkannt haben muss, um einen Pflichtwidrigkeitsappell vermittelt zu bekommen. Er plädiert zunächst dafür, den Maßstab der Erkennbarkeit dem Adressatenkreis anzupassen (Expertenstrafrecht). Damit bereite die Annahme von Vorsatz selten praktische Probleme. Wer wisse, dass für seine Tätigkeit Vorschriften bestehen, sich aber nicht informiere, handle meistens mit Eventualvorsatz. Hinsichtlich der Umstände, die der Täter kennen muss, will Dinter nach der Quelle der Vermögensbetreuungspflicht differenzieren (S. 73 ff.): Bei Verstößen gegen gesetzliche Pflichten genüge Tatsachenkenntnis, da der Normadressat diese Pflichten zu kennen habe, gesetzliche Verbote generell und damit für jedermann erkennbar formuliert seien. Dagegen müsse der Normadressat bei Verstößen gegen Pflichten aus Rechtsgeschäft oder aus behördlichem Auftrag den Pflichtverstoß erkannt haben (Rechtskenntnis), da es hier an einer allgemeinen Wertwidrigkeit fehle, das Verbot erst durch eine nur dem Einzelnen zugängliche Anordnung konkretisiert werde. Diese Differenzierung dürfte allerdings auf Widerstand stoßen: Denn maßgebend kann nicht sein, dass „jedermann“ den Pflichtwidrigkeitsappell vermittelt bekommt, sondern entscheidend ist, dass gerade der Vermögensbetreuungspflichtige Anlass hat, über die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens nachzudenken. Der „Pflichtige“ dürfte aber die Pflichten, die ihm durch Vertrag oder behördlichem Auftrag konkret auferlegt wurden, regelmäßig besser kennen als abstrakte gesetzliche Pflichten!
Den abschließenden vierten Teil widmet Dinter verfassungsrechtlichen Problemen, die dadurch entstehen, dass das Pflichtwidrigkeitsmerkmal an Verhaltensnormen mit unterschiedlichem Bestimmtheitsgrad anknüpft. Der Verweis auf unbestimmte Vermögensbetreuungspflichten (z.B. Beachtung der „Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes“, § 93 Abs. 1 S. 1 AktG) sei zulässig, wenn die erforderliche Bestimmtheit hergestellt werden könne. Restriktionsansätze, die auf der objektiven Tatbestandsebene ansetzen, betrachtet Dinter allerdings als unergiebig, da weder das Erfordernis einer gravierenden Pflichtverletzung noch das Kriterium der Vertretbarkeit einer Entscheidung bzw. der Evidenz einer Pflichtverletzung überzeugen könnten. Vielmehr müsse die Restriktion im subjektiven Tatbestand erfolgen. Der Vermögensinhaber verdiene nämlich nur dann Schutz, wenn er seinen Willen hinreichend klar geäußert habe (viktimodogmatische Betrachtung) und der Täter sicher wisse, dass er entgegen dem Willen bzw. dem Interesse des Vermögensinhabers handelt. Auch in Zweifelsfällen bestehe keine Erkundigungspflicht. Bei unbestimmten Verhaltensgeboten sei daher eine Strafbarkeit erst bei Kenntnis vom Pflichtverstoß anzunehmen. Die Einwände, die im Schrifttum gegen eine derartige Sichtweise, die den Vermögensinhaber und damit das Opfer benachteiligt, bereits vorgebracht wurden, konnten Dinter nicht überzeugen (S. 124 f.): Dem Zwang juristischer Personen, sich eines vermögenspflichtigen Organs bedienen zu müssen, stehe der Nutzen gegenüber, überhaupt handlungs- und willensfähig zu sein; einen weitergehenden Schutz könne nur der Gesetzgeber durch die Kodifizierung hinreichend bestimmter Pflichten oder durch die Einräumung von Weisungsrechten gegenüber den Organen sicherstellen; solange der Gesetzgeber die Verhaltenslenkung unbestimmten Maßstabsfiguren überlasse, verbleibe dem Privaten lediglich die Entscheidung darüber, ob er sich für sein Unternehmen eines – aus strafrechtlicher Perspektive – sektoral unsicheren „wirtschaftlichen Mantels“ bedienen möchte. Auch diese Auffassung dürfte auf Widerstand stoßen: Denn die Einräumung eines Ermessensspielraums ist im Kontext unternehmerischer Entscheidungen rechtsökonomisch notwendig, wie Dinter selbst konzediert, so dass eine gesetzliche Konkretisierung an Grenzen stößt. Schließlich soll nach Auffassung von Dinter auch der Einwand nicht verfangen, dass subjektive Restriktionsbemühungen jenen auf objektiver Tatbestandsebene deshalb strukturell unterlegen seien, weil der Richter die Kenntnis des Täters vom Pflichtverstoß aus seiner richterlichen Überzeugung ableiten könne (S. 125 f.): Der Richter werde „bei einer behutsamen und gewissenhaften Anwendung des in-dubio-Grundsatzes nicht umhin kommen, seine persönliche Empörung über den besonders skandalösen Einzelfall beiseite zu legen und in Zweifelsfällen freizusprechen“. Diese Hoffnung dürfte eine Illusion sein: Warum soll ein Richter – gerade in einem „empörenden Fall“ – den subjektiven Tatbestand der Untreue verneinen, zumal wenn nach Meinung von Dinter der Vorsatz bei schadensträchtigen unternehmerischen Entscheidungen bereits dann vorliegen soll, wenn sich ein Handeln entgegen dem Willen des Vermögensträgers „geradezu aufdrängt“ (S. 126 f.)?
Die Schrift bietet damit ein gemischtes Bild. Einerseits sind Darstellung und Analyse sorgfältig und instruktiv. Andererseits tendiert die Lösung dazu, bei unbestimmten Verhaltenspflichten den Vermögensinhaber zu benachteiligen. Das dürfte kaum konsensfähig sein.
[:en]
Von Lasse Dinter, Schriften zum Wirtschaftsstrafrecht, C.F. Müller Heidelberg u.a. 2012 – XI, 148 S., 49,95 Euro
§ 266 StGB hat sich in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Strafvorschriften des Wirtschaftsstrafrechts entwickelt. Allerdings gelten zentrale dogmatische Fragen als ungelöst. So hat der 3. Strafsenat des BGH im Mannesmann-Urteil (BGHSt 50, 331 ff.) die Frage offen gelassen, ob der Irrtum über die Pflichtwidrigkeit einen Tatbestands- oder einen Verbotsirrtum begründet: Eine sachgerechte Einordnung lasse sich „nicht durch schlichte Anwendung einfacher Formeln ohne Rücksicht auf wertende Kriterien und differenzierende Betrachtungen“ erreichen. Dinter hat es sich in seiner Münsteraner Dissertation, die von Mark Deiters betreut wurde, zum Ziel gesetzt, eine praxistaugliche Lösung zu entwickeln.
Im einleitenden ersten Teil stellt Dinter zunächst das bisherige Meinungsspektrum vor. Das Schrifttum begreife die Pflichtwidrigkeit entweder als „normatives Tatbestandsmerkmal“, was die Anwendung der Regeln des Tatbestandsirrtums nahe lege, oder aber als „Blankett“, „blankettartiges Merkmal“ bzw. „gesamttatbewertendes Merkmal“, was für die Anwendung der Regeln des Verbotsirrtums spreche. Der BGH gehe dagegen von einem „komplexen“ normativen Tatbestandsmerkmal aus, bei dem der Irrtum über die Pflichtwidrigkeit nicht zwangsläufig zu einem Tatbestandsirrtum führe, sondern auch einen Verbotsirrtum darstellen könne.
Im zweiten Teil analysiert Dinter die grundsätzliche Abgrenzung des Tatbestandsirrtums vom Verbotsirrtum. Beim Pflichtwidrigkeitsmerkmal der Untreue lasse sich entweder auf die Tatsachen-, die Rechtsfolgen- oder die Rechtskenntnis abstellen, womit drei „Vorsatzmodelle“ existieren. Bei Untreuetaten könne daher gegebenenfalls bereits die Kenntnis der die Verhaltensnormen begründenden Tatsachen einen Appell an den Täter richten, über die Rechtmäßigkeit nachzudenken, ohne dass der Pflichtverstoß erkannt worden sein müsse. Die Pflichtwidrigkeit begreift Dinter als ein „teilweise verhaltensnormenvermittelndes Tatbestandsmerkmal“, das nicht auf eine, sondern auf mehrere Verhaltensnormen Bezug nimmt. Deshalb könne ein Verstoß gegen das allgemeine Schädigungsverbot noch keine Untreue begründen. Die bloße Verursachung eines Nachteils vermittle keinen hinreichenden Unrechtsimpuls, womit der Schluss vom Nachteils- auf den Pflichtwidrigkeitsvorsatz unzulässig sei.
Im dritten Teil befasst sich Dinter mit der Frage, welche Umstände der Täter erkannt haben muss, um einen Pflichtwidrigkeitsappell vermittelt zu bekommen. Er plädiert zunächst dafür, den Maßstab der Erkennbarkeit dem Adressatenkreis anzupassen (Expertenstrafrecht). Damit bereite die Annahme von Vorsatz selten praktische Probleme. Wer wisse, dass für seine Tätigkeit Vorschriften bestehen, sich aber nicht informiere, handle meistens mit Eventualvorsatz. Hinsichtlich der Umstände, die der Täter kennen muss, will Dinter nach der Quelle der Vermögensbetreuungspflicht differenzieren (S. 73 ff.): Bei Verstößen gegen gesetzliche Pflichten genüge Tatsachenkenntnis, da der Normadressat diese Pflichten zu kennen habe, gesetzliche Verbote generell und damit für jedermann erkennbar formuliert seien. Dagegen müsse der Normadressat bei Verstößen gegen Pflichten aus Rechtsgeschäft oder aus behördlichem Auftrag den Pflichtverstoß erkannt haben (Rechtskenntnis), da es hier an einer allgemeinen Wertwidrigkeit fehle, das Verbot erst durch eine nur dem Einzelnen zugängliche Anordnung konkretisiert werde. Diese Differenzierung dürfte allerdings auf Widerstand stoßen: Denn maßgebend kann nicht sein, dass „jedermann“ den Pflichtwidrigkeitsappell vermittelt bekommt, sondern entscheidend ist, dass gerade der Vermögensbetreuungspflichtige Anlass hat, über die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens nachzudenken. Der „Pflichtige“ dürfte aber die Pflichten, die ihm durch Vertrag oder behördlichem Auftrag konkret auferlegt wurden, regelmäßig besser kennen als abstrakte gesetzliche Pflichten!
Den abschließenden vierten Teil widmet Dinter verfassungsrechtlichen Problemen, die dadurch entstehen, dass das Pflichtwidrigkeitsmerkmal an Verhaltensnormen mit unterschiedlichem Bestimmtheitsgrad anknüpft. Der Verweis auf unbestimmte Vermögensbetreuungspflichten (z.B. Beachtung der „Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes“, § 93 Abs. 1 S. 1 AktG) sei zulässig, wenn die erforderliche Bestimmtheit hergestellt werden könne. Restriktionsansätze, die auf der objektiven Tatbestandsebene ansetzen, betrachtet Dinter allerdings als unergiebig, da weder das Erfordernis einer gravierenden Pflichtverletzung noch das Kriterium der Vertretbarkeit einer Entscheidung bzw. der Evidenz einer Pflichtverletzung überzeugen könnten. Vielmehr müsse die Restriktion im subjektiven Tatbestand erfolgen. Der Vermögensinhaber verdiene nämlich nur dann Schutz, wenn er seinen Willen hinreichend klar geäußert habe (viktimodogmatische Betrachtung) und der Täter sicher wisse, dass er entgegen dem Willen bzw. dem Interesse des Vermögensinhabers handelt. Auch in Zweifelsfällen bestehe keine Erkundigungspflicht. Bei unbestimmten Verhaltensgeboten sei daher eine Strafbarkeit erst bei Kenntnis vom Pflichtverstoß anzunehmen. Die Einwände, die im Schrifttum gegen eine derartige Sichtweise, die den Vermögensinhaber und damit das Opfer benachteiligt, bereits vorgebracht wurden, konnten Dinter nicht überzeugen (S. 124 f.): Dem Zwang juristischer Personen, sich eines vermögenspflichtigen Organs bedienen zu müssen, stehe der Nutzen gegenüber, überhaupt handlungs- und willensfähig zu sein; einen weitergehenden Schutz könne nur der Gesetzgeber durch die Kodifizierung hinreichend bestimmter Pflichten oder durch die Einräumung von Weisungsrechten gegenüber den Organen sicherstellen; solange der Gesetzgeber die Verhaltenslenkung unbestimmten Maßstabsfiguren überlasse, verbleibe dem Privaten lediglich die Entscheidung darüber, ob er sich für sein Unternehmen eines – aus strafrechtlicher Perspektive – sektoral unsicheren „wirtschaftlichen Mantels“ bedienen möchte. Auch diese Auffassung dürfte auf Widerstand stoßen: Denn die Einräumung eines Ermessensspielraums ist im Kontext unternehmerischer Entscheidungen rechtsökonomisch notwendig, wie Dinter selbst konzediert, so dass eine gesetzliche Konkretisierung an Grenzen stößt. Schließlich soll nach Auffassung von Dinter auch der Einwand nicht verfangen, dass subjektive Restriktionsbemühungen jenen auf objektiver Tatbestandsebene deshalb strukturell unterlegen seien, weil der Richter die Kenntnis des Täters vom Pflichtverstoß aus seiner richterlichen Überzeugung ableiten könne (S. 125 f.): Der Richter werde „bei einer behutsamen und gewissenhaften Anwendung des in-dubio-Grundsatzes nicht umhin kommen, seine persönliche Empörung über den besonders skandalösen Einzelfall beiseite zu legen und in Zweifelsfällen freizusprechen“. Diese Hoffnung dürfte eine Illusion sein: Warum soll ein Richter – gerade in einem „empörenden Fall“ – den subjektiven Tatbestand der Untreue verneinen, zumal wenn nach Meinung von Dinter der Vorsatz bei schadensträchtigen unternehmerischen Entscheidungen bereits dann vorliegen soll, wenn sich ein Handeln entgegen dem Willen des Vermögensträgers „geradezu aufdrängt“ (S. 126 f.)?
Die Schrift bietet damit ein gemischtes Bild. Einerseits sind Darstellung und Analyse sorgfältig und instruktiv. Andererseits tendiert die Lösung dazu, bei unbestimmten Verhaltenspflichten den Vermögensinhaber zu benachteiligen. Das dürfte kaum konsensfähig sein.