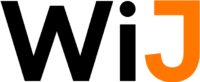Lösing, Carsten: Die Kompensation des Vermögensnachteils durch nicht exakt quantifizierbare, vermögenswirksame Effekte
Duncker & Humblot, Schriften zum Strafrecht, Heft 233, Hamburg 2012, 271 Seiten.
1. Welch ein Gegensatz! Unter seinem Fazit zitiert Lösing Montesquieu (S. 233): „Es ist der Wettbewerb, der den richtigen Preis für Güter setzt und die richtigen Beziehungen zwischen ihnen herstellt.“ Und das, nachdem der Autor zuvor über gut 60 Seiten feinziselierte normative Überlegungen zur Wertfeststellung als eine Art angemessenem ‚Preis‘ anstellte und dessen Bestimmung mit dem Gebot der Abwägung aller Umstände des Einzelfalles quasi in das richterliche Ermessen stellte. Nicht der einzige Schmerz.
Falscher Ort, falsche Zeit. Tragisch, wenn die Aktualität vermutlich jahrelanger Arbeit von einer kurz nach Fertigstellung ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 126, 170 ff. zur Untreue und ebenso wie die Entscheidung vom 7.12.2011, NJW 2012, 907 ff., zum Betrug mit grundlegenden Ausführungen zur Quantifizierung der Tatbestandsmerkmale Nachteil bzw. Schaden; auch in der veröffentlichten Fassung nur rudimentär berücksichtigungsfähig gewesen) weitgehend beseitigt wird. Dafür darf der Autor mit aufrichtigem Bedauern rechnen. Keine Nachsicht verdient aber seine fehlende Entscheidung zwischen induktiver Rechtsprechungsanalyse und darüber hinausgehender (in- oder deduktiver) wissenschaftlich-dogmatischer Erkenntnis, ebensowenig sein undurchsichtiges Pendeln zwischen generellen Untersuchungen bzw. Aussagen einerseits und der Beschränkung auf seinen Leitfall (BGH 3 StR 470/04) andererseits, auch nicht der von ihm gewählte Titel: Wo die dogmatische Frage ‚draufsteht‘, welche Effekte kompensatorische Wirkung haben können, wie sich diese quantifizieren lassen und wer den Wert festlegt, ist (weitgehend) nur Mannesmann ‚drin‘.
2. a) Ausgangspunkt ist die Fragestellung des Autors, ob den an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder gezahlten Anerkennungsprämien tatsächlich, wie vom BGH angenommen, keine kompensierenden Effekte gegenüberstanden (S. 29). Daß diese Ausgangsfrage schief gestellt ist, erkannte der Autor schnell und versuchte sie durch den Hinweis ins Lot zu bringen, daß angesichts des unmittelbar nachfolgenden Ausscheidens des Vorstands gar keine Kompensation durch erhöhte Arbeitsleistung mehr eintreten konnte (S. 31 f.). Das ist zwar richtig, zeigt aber, daß der Fall Mannesmann als Ausgangssachverhalt für die dogmatische Fragestellung nicht wirklich geeignet ist.
b) Teil 2 der Untersuchung befaßt sich im 1. Kapitel (S. 38 ff.) ausführlich mit Fragen der Vergütungsstruktur bei Vorstandsmitgliedern und stellt etliche Erscheinungsformen variabler Entlohnungsmodelle vor. Zu diesen gehören auch Anerkennungsprämien. Diese sind nach Lösing auf der Basis der Entscheidung des BGH nur zulässig, wenn der mit ihnen verbundene Vermögensabfluß in gleicher Höhe durch anderweiten Vermögenszuwachs ausgeglichen wird. Im 3. und Haupt-Teil beleuchtet Lösing mögliche derartige kompensatorische Effekte (S. 70 ff.). Im Kapitel 1 (S. 73 ff.; unklar jedoch zum Risikogeschäft, S. 107) verweist er zwar auf das aus der Eigenständigkeit der Tatbestandsmerkmale Pflichtwidrigkeit und Nachteil folgende Verschleifungsverbot, kommt darauf aber nur gegen Ende zurück, als er procedurale Kriterien (wohl) der Pflichtwidrigkeit zuordnete S. 216). Ansonsten läßt sich keine Prüfung dahingehend erkennen, welchem Tatbestandsmerkmal welcher Aspekt zugeordnet werden muß. Zutreffend ist allerdings, daß Lösing eine Verbindung lediglich zwischen Nachteil und Kompensation herstellt (S. 76, 84). Die in der allgemeinen Rechtsprechung bereits anerkannten Kompensationseffekte finden sich auf den S. 78 f. aufgelistet. Systematisierend unterscheidet Lösing zwischen direkter und indirekter Kompensation und bei Letzterer solche vor generell- und spezialeffektivem Hintergrund (S. 80 ff.).
c) Das 2. Kapitel des 2. Teils (S. 84 ff.) ist Fragen des Vermögensbegriffs gewidmet. Am Beginn steht die Prüfung, (1) welche Vermögensbestandteile (der aufgrund der Wortwahl naheliegende Zirkelschluß läßt sich mit einem Verständnis dahingehend vermeiden, daß hier die Gegenstände gemeint sind, die dem Inhaber im bürgerlich-rechtlichen Sinne zustehen) für § 266 StGB (ebenso für § 263 StGB) relevant sind und welche nicht und (2) wie der Nachteil bzw. Schaden zu ermitteln ist (S. 85).
Zu (1) hebt Lösing anknüpfend an die grundlegenden Arbeiten Hefendehls hervor, daß die Vermögensgefährdung auf der Schadensseite das Spiegelbild zur Exspektanz auf der Seite des Vermögens und damit möglicher Kompensationen darstellt (S. 86). Daraus leitet er mit Saliger eine nur vom Zweifelssatz eingeschränkte Symmetrie dergestalt ab, daß das Unmittelbarkeitskriterium entweder auf beiden Seiten oder weder beim Ab- noch beim Zufluß Anwendung finden kann (S. 87; erweitert auf das gesamte Verständnis des Vermögens sowohl im Hinblick auf Minderungen wie Mehrungen, S. 128, 130), ohne aber eine Entscheidung dieser Alternativität zu treffen. Bei der weiteren Prüfung relevanter Vermögensgegenstände stellt Lösing auf den Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ ab (S. 87), ebenso bei der Frage, ob und wie genau der Nachteil zu quantifizieren ist (S. 88 ff.). Das ist verfehlt – aber nicht, weil dieser nur eingeschränkt gälte (S. 127). Es handelt sich dabei vielmehr allein um eine prozessuale Entscheidungsregel, welche im materiellen Recht keinen Platz hat.
Aus dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG kann kein exaktes Quantifizierungsgebot abgeleitet werden (S. 90 f.). Mag auch das Vorhandensein des Strafzumessungsgrundes eines besonders schweren Falls beim Eintritt eines Verlusts ‚großen Ausmaßes‘ für die Notwendigkeit exakter Quantifizierung sprechen (S. 91 ff.), so gilt das nicht für das Schuldprinzip als solches (S. 93 f.). Das von Lösing (S. 94, auch 105) angeführte Argument ist schlagend, wenngleich nur auf der Ebene des einfachen, nicht des Verfassungsrechts: Aufgrund des notwendigen Kausalzusammenhangs zwischen Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht und dem Nachteil sind aus der tatsächlich eingetretenen Vermögensminderung zur Bestimmung des Nachteils all die Effekte herauszunehmen, welche nicht auf dieser spezifischen Pflichtwidrigkeit beruhen. Das ist nicht exakt, sondern nur mit Hilfe einer wertenden Betrachtung möglich. Gegen das Erfordernis exakter Quantifizierung und für die Zulässigkeit der Schätzung der Höhe des an sich festgestellten Schadens führt Lösing weitere, eher utilitaristische Argumente an, verweist aber auch auf einige Vorschriften im StGB, welche Schätzungen ausdrücklich zulassen (S. 94 ff.). Obwohl die Reduzierung auf die Frage nach der Zulässigkeit von Schätzungen das Thema ‚Quantifizierung‘ nicht ausschöpft, erst recht nicht die in der Überschrift zum Ausdruck gebrachte weitergehende Problematik der Abgrenzung relevanter von irrelevanten Vermögensbestandteilen, auf welche Lösing erst später zurückkommt (S. 111 ff.), kann ihm ohne weiteres in seinem Ergebnis gefolgt werden, daß exakte Feststellungen zu treffen sind, soweit das nach einem pragmatischen Maßstab möglich ist, daß aber jenseits dessen Schätzungen zulässig sind (S. 96 f.). Konsequenterweise wendet sich Lösing anschließend, wenn auch arg knapp, der Frage zu, unter welchen Voraussetzungen Schätzungen mit dem Bestimmtheitsgebot vereinbar sind (S. 97 f.).
Die Überlegungen zur Ermittlung des Schadens bzw. Nachteils (2.) setzen bei den von Lösing sogenannten verschiedenen Schadensarten an (S. 98 ff.). Er befaßt sich zunächst (S. 98 f.) mit Besonderheiten bei Risikogeschäften (ausgenommen S. 106 ff.), der schadensgleichen Vermögensgefährdung allgemein, dem individuellen Schadenseinschlag und dem Submissionsbetrug. Ob es sich dabei jedoch um verschiedene Arten von Schäden mit materiellrechtlich unterschiedlichen Inhalten handelt, oder ob eine Definition allgemein gilt, bei der Subsumtion aber jeweils auf die Besonderheiten des Falles und seiner Umstände abzustellen ist, oder ob es sich gar nur um prozessuale Fragen des Beweises handelt, thematisiert Lösing nicht. Er wendet sich schnell dem Prinzip der Gesamtsaldierung zu (S. 99 ff.) und konstatiert, daß es nicht ausnahmslos durchgehalten werde (S. 105) und es zudem zulasse, den maßgeblichen Zeitpunkt unterschiedlich, ja beinahe beliebig zu bestimmen (S. 104). Bei Risikogeschäften verstehe der BGH den Schaden/Nachteil anders. Der fehlende Versuch einer Systematisierung rächt sich in der eher hilflosen Feststellung, der Risikoschaden lasse sich nicht anhand objektiver Kriterien bestimmen und sei daher durch einen stark normativen Charakter geprägt (S. 108). Lösing stellt dem und der aufgrund der Ausnahmen ihn ebenfalls nicht überzeugenden Gesamtsaldierung die zivilrechtliche Differenzhypothese gegenüber (108 f.), welcher ersichtlich seine Sympathie gehört (S. 109 ff.). Konsequenzen daraus macht Lösing allerdings nicht deutlich. Stellt man sowohl auf Minderungen als auch auf Zuwächse im betroffenen Vermögen ab, so werden auch die Kompensationen erfaßt – eine eigene Erkenntnis Lösings, allerdings beschränkt auf das Risikogeschäft und die in der Rechtsprechung anerkannte Rechtsfigur eines ‚wirtschaftlich vernünftigen Gesamtplans‘ (S. 107, auch S. 133).
Nach Befassung mit den von ihm unterschiedenen Schadens-Arten wendet sich Lösing wieder dem Aspekt (1.) zu (S. 111 ff.) und spaltet die Frage nach der Werthaltigkeit von Vermögenspositionen auf in die Bestimmung relevanter Positionen (a) und deren Bewertung (b), S. 111. Vermögens-strafrechtlich relevant (a) sind nach Lösing (S. 111. f.) allgemeine Positionen (Eigentum etc., nicht aber bestrittene Forderungen – der Grund dafür bleibt dunkel) und (S. 112 ff.) Exspektanzen, verstanden mit Hefendehl als bereits vorhandene Herrschaftsmacht. Eine umfassende Bestimmung dessen, was vom Strafrecht als Vermögen geschützt wird, ist das nicht (Affektionsinteresse?) und war auch wohl nicht intendiert. Die Bewertung (b) kann auf verschiedenen Wegen erfolgen (S. 116 ff.). Zuerst zu nennen ist der Marktwert. Lösing (S. 116 ff.) beschreibt anschaulich, daß und warum ein solcher nicht immer feststellbar ist. Auch ein rein intersubjektiv vereinbarter Preis (S. 120) kann jedenfalls nicht durchweg maßgeblich sein, weil damit unredliche Geschäftspartner mit dem unlauter festgelegten Preis zugleich den Wert bestimmen könnten (S. 119). In Betracht kommen ferner der Wiederverkaufswert (S. 120 f.), Kombinationen aus objektiven und subjektiven Elementen (S. 121) sowie verschiedene betriebswirtschaftliche Methoden zur Feststellung des Barwerts (S. 122 ff.). Letztlich bestätigt Lösing sein bereits bei Befassung mit der Zulässigkeit von Schätzungen gefundenes Ergebnis (S. 96 f.): soweit möglich, komme es auf den nach objektiven Kriterien zu bestimmenden Marktwert, im übrigen auf substantielle Schätzungen an (S. 126 f.).
d) Nachfolgend fragt Lösing nach den Voraussetzungen für die Anerkennung kompensatorischer Effekte (S. 127 ff.). Problematisch seien nicht die allgemeinen Voraussetzungen, wirtschaftlicher Wert und Quelle in der strafbaren Handlung. Fraglich sei hingegen, ob die Kausalität von Zurechnungskriterien wie dem Unmittelbarkeitserfordernis einzuschränken ist und ob, sowie wenn ja, welche wirtschaftlichen Zuflüsse aus normativen Gründen nicht anzuerkennen seien (kriminelle Herkunft <Verhältnis zur Notwendigkeit, daß nur auf die Tat zurückzuführende Zuflüsse kompensieren können>, Schadenersatz etc.), S. 127. Dabei kommt er erneut auf die Frage (1.) nach der Abgrenzung zwischen relevanten und irrelevanten Vermögensteilen zurück (S. 128 f.). Die Prüfung etwaiger Einschränkung schlichter Kausalität (S. 130 ff.) erstreckt sich von den verworfenen Kriterien der Gleichzeitigkeit (S. 132 f.) und Unmittelbarkeit (S. 133 ff.), über die ebenfalls als unzureichend angesehenen Aspekte des Vorsatzes und der Adäquanztheorie zur objektiven Zurechnung zwischen Rechtsgut und Vermögenseffekt (S. 136 f.). Letzteres aufgreifend schlägt Lösing vor, die Zurechnung unter Berücksichtigung des Telos der Untreue vorzunehmen, manifestiert in Kausalität und Zugriffsmöglichkeit (S. 138). Ob darin mehr liegt als die vom Tatbestand vorgegebene Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Nachteil bleibt dabei offen. Die Prüfung der Eignung eintretender Folgen zur Kompensation beginnt mit dem Satz: „Kompensatorische Effekte müssen generell kompensationsfähig sein“ (S. 138). Gemeint ist damit: Effekte sind nicht als kompensatorisch anzuerkennen, wenn ihnen die generelle Kompensationsfähigkeit fehlt.
Sein Versprechen allgemeiner Ausführungen zu den Anforderungen an die generelle Kompensationsfähigkeit (S. 142) löst Lösing nur mit Ausführungen zu Mannesmann ein (S. 143 ff.). Folgen wird man ihm darin können, die Gewährung einer Anerkennungsprämie nicht als Risikogeschäft zu betrachten. Nachfolgend wendet sich Lösing verschiedenen Effekten zu und prüft die Kompensationseignung von Anreizwirkungen jenseits der Person des Empfängers der Anerkennungsprämie S. 143 ff. (generell bejaht, S. 146 f., 152; Quantifizierung: Schätzung nach betriebswirtschaftlichem DCF-Verfahren); der Steigerung der Reputation des Unternehmens, S. 152 ff. (ebenfalls generell bejaht, S. 155; Bemessung der Reputation: spezifische Demoskopie, S. 155 f., aber nicht quantifizierbar, S. 158), und der Schaffung von Geschäftschancen, S. 158 f. (ohne Beantwortung der Frage nach genereller Eignung: nicht bewert- und damit nicht quantifizierbar). Das Fazit lautet: schwer bewertbar, aber wegen des Zweifelssatzes nicht völlig zu vernachlässigen (S. 159). Das Ergebnis der Betrachtung von an die Empfänger von Anerkennungsprämien anknüpfenden Anreizwirkungen (S. 160 ff.: erhöhte Bindung, nur in concreto Mannesmann: nein, S. 160 f.; Loyalität bzw. Herauskaufen illoyaler Vorstandsmitglieder: bestenfalls zum Erzielen von Spezialeffekten über die Rechtspflichten hinaus, S. 161 f.) ist ein entschiedenes: kann sein – oder auch nicht (S. 163 f.).
e) Gegenstand von Teil 3, Kapitel 3 (S. 164 ff.) ist das Problem mangelnder Quantifizierbarkeit wertvoller Effekte. Letztere kann nach Lösing auf vier Gründe zurückgehen: Fehlen eines klaren Erfolgsmaßstabs, fehlende statistische Erhebungen, mangelnde Separierbarkeit verschiedener Effekte und zeitlich gestreckter Eintritt von Wirkungen. Nach allgemeiner Verwerfung der Extreme (jeder oder gar kein generell kompensationsgeeigneter Effekt kompensiert) sucht er unter Berücksichtigung der Belange des Beschuldigten und der Strafverfolgung für den Umgang mit dem konkreten Problem mangelnder Quantifizierbarkeit der Kompensationseffekte von Anerkennungsprämien nach einer vermittelnden Lösung (S. 169 ff). Da ihm dafür allein weder die richterliche Überzeugung (S. 171 ff.) noch der Zweifelssatz (S. 174 f.) genügen, unternimmt er den Versuch (S. 176 ff.) einer Konkretisierung der Angemessenheit anhand von 10 verschiedenen methodischen Ansätzen (S. 176 ff.: Normative Festsetzung <S. 176 f.: absolute Obergrenzen; S. 177 f.: Abhängigkeit vom Festgehalt>; S. 178 f.: Zustimmung der Aktionäre; S. 180 f.: sittliche Anschauungen; S. 181 f.: Üblichkeit; S. 182 ff.: Wahrscheinlichkeitstheorien; S. 188 f.: § 87 AktG; S. 189 f.: DCGK; S. 190 ff.: Anlehnung an die steuerrechtliche Behandlung verdeckter Gewinnausschüttungen; S. 201 f.: Dreistufenmodell nach Lücke; S. 202: Umstände des Einzelfalls). Lösing sieht keinen dieser Ansätze als für sich überzeugend an (S. 202 f.), entnimmt aber einigen einzelne Elementen, die er in drei Schritten für sinnvoll kombinierbar hält: Wenn (a) die Feststellung aller Zu- und Abflüsse und (b) deren Quantifizierung per Sachverständigengutachten keinen verläßlichen Erwartungs- bzw. Barwert ergäbe, so müsse (c) auf die Umstände des Einzelfalls abgestellt werden (S. 203 ff.).
Für die dafür erforderliche Gesamtschau führt Lösing eine Liste von Indizien an (S. 205 ff.: nachfrageorientierte Kriterien mit erheblicher Aussagekraft, S. 213 <S. 205 ff.: Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds; S. 208 f.: Lage der Gesellschaft; S. 209 f.: Größe des Unternehmens; S. 210 f.: Ertragsstärke; S. 211 f.: Branche>; S. 213 ff.: angebotsorientierte Kriterien mit ebenfalls erheblicher Aussagekraft, S. 215 f. <S. 213: Stellenmarkt; S. 213 f.: Qualifikation und Leistung; S. 214; Berufserfahrung/Alter; S. 215: Familienverhältnisse>; S. 216 ff.: aufgrund unvermeidlicher Verschleifung mit dem Tatbestandsmerkmal der Pflichtwidrigkeit und wohl auchwegen zu starker Normativierung (S. 219 f.) ungeeignete procedurale Kriterien <S. 217: Nähe zum Unternehmensgegenstand; S. 217: sachwidrige Motive; S. 217 f.: Unabhängigkeit des befaßten Aufsichtsrats; S. 218: Transparenz; S. 219: Kontrollintensität des Aufsichtsrats; S. 219: Dokumentation und Begründung>; S. 220 f.: relationales Kriterium der (Un-)Üblichkeit, und S. 221 f.: funktionale Kriterien, beide Letztgenannten wohl als tendentiell geeignet betrachtet). Das Bemühen um eine Reihenfolgen (S. 222 ff.) mündet in die Bevorzugung materieller vor funktionalen Kriterien (S. 226).
3. Dem Rezensenten ist der Versuch mißlungen, aus dieser beeindruckenden Liste und den sonstigen Darlegungen abzulesen oder auch nur abzuleiten, wieviel Euro und wieviel Cent z.B. das Alter des Empfängers der Anerkennungsprämie denn nun wert ist. Er dürfte damit allerdings weder alleinstehen noch kann die Ursache der Misere Lösing angelastet werden: Die Auswirkungen von Anerkennungsprämien (wie manch anderer Aufwendungen nicht nur für Werbung, Spenden, Sponsoring, sondern auch für die Festsetzung von Gehältern und das Sich-Lohnen von Investitionen) lassen sich schlicht nicht, jedenfalls nicht ex ante, wie es für Betrug und Untreue erforderlich ist, quantifizieren. Dies zu konstatieren ist keine Kapitulation des Strafrechts, wenn man schlicht einsieht, daß all die genannten wie auch alle anderen qualitativen Gesichtspunkte zum Tatbestandsmerkmal der Pflichtwidrigkeit gehören, so daß für die Feststellung des Nachteils allein quantitative Operationen übrigbleiben. Für Anerkennungsprämien bedeutet dies: Ob und in welcher Höhe sie gewährt werden, unterliegt der von seiner Pflichtenstellung begrenzten Einschätzungsprärogative des Aufsichtsrats. Innerhalb der äußersten Grenzen des Rechts hat er eine Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Pflicht- und damit rechtswidrig ist lediglich die Überschreitung des so bestimmen Rahmens. Diesen festzustellen, ist schwer genug. Hierfür lassen sich allerdings manche der Überlegungen Lösings fruchtbar machen. Ist eine Anerkennungsprämie bis zu einer bestimmten Höhe pflichtgemäß, so läßt sich der Nachteil durch einfache Differenzbildung zur gewährten Höhe berechnen. Ist hingegen die Auskehr einer Anerkennungsprämie völlig unzulässig, so scheiden Effekte, die zum Zeitpunkt des Endes der Tathandlung als dem maßgeblichen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden können, als Kompensation aus und können bestenfalls noch im Rahmen der Strafzumessung mildernd berücksichtigt werden. Bei Beschränkung des Untersuchungsgegenstands auf Anerkennungsprämien wäre daher zu prüfen gewesen, ob eine unzulässige derartige Prämie exakt oder im Wege der Schätzung quantifizierbare und damit kompensationsgeeignete Folgen zeitigt. Dazu hätten allerdings die Bewertungsfragen (S. 116 ff.) in den Mittelpunkt gestellt werden müssen. Dies ist nicht geschehen – mit spürbaren Auswirkungen auf den Ertrag der Dissertation.
[:en]
Duncker & Humblot, Schriften zum Strafrecht, Heft 233, Hamburg 2012, 271 Seiten.
1. Welch ein Gegensatz! Unter seinem Fazit zitiert Lösing Montesquieu (S. 233): „Es ist der Wettbewerb, der den richtigen Preis für Güter setzt und die richtigen Beziehungen zwischen ihnen herstellt.“ Und das, nachdem der Autor zuvor über gut 60 Seiten feinziselierte normative Überlegungen zur Wertfeststellung als eine Art angemessenem ‚Preis‘ anstellte und dessen Bestimmung mit dem Gebot der Abwägung aller Umstände des Einzelfalles quasi in das richterliche Ermessen stellte. Nicht der einzige Schmerz.
Falscher Ort, falsche Zeit. Tragisch, wenn die Aktualität vermutlich jahrelanger Arbeit von einer kurz nach Fertigstellung ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 126, 170 ff. zur Untreue und ebenso wie die Entscheidung vom 7.12.2011, NJW 2012, 907 ff., zum Betrug mit grundlegenden Ausführungen zur Quantifizierung der Tatbestandsmerkmale Nachteil bzw. Schaden; auch in der veröffentlichten Fassung nur rudimentär berücksichtigungsfähig gewesen) weitgehend beseitigt wird. Dafür darf der Autor mit aufrichtigem Bedauern rechnen. Keine Nachsicht verdient aber seine fehlende Entscheidung zwischen induktiver Rechtsprechungsanalyse und darüber hinausgehender (in- oder deduktiver) wissenschaftlich-dogmatischer Erkenntnis, ebensowenig sein undurchsichtiges Pendeln zwischen generellen Untersuchungen bzw. Aussagen einerseits und der Beschränkung auf seinen Leitfall (BGH 3 StR 470/04) andererseits, auch nicht der von ihm gewählte Titel: Wo die dogmatische Frage ‚draufsteht‘, welche Effekte kompensatorische Wirkung haben können, wie sich diese quantifizieren lassen und wer den Wert festlegt, ist (weitgehend) nur Mannesmann ‚drin‘.
2. a) Ausgangspunkt ist die Fragestellung des Autors, ob den an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder gezahlten Anerkennungsprämien tatsächlich, wie vom BGH angenommen, keine kompensierenden Effekte gegenüberstanden (S. 29). Daß diese Ausgangsfrage schief gestellt ist, erkannte der Autor schnell und versuchte sie durch den Hinweis ins Lot zu bringen, daß angesichts des unmittelbar nachfolgenden Ausscheidens des Vorstands gar keine Kompensation durch erhöhte Arbeitsleistung mehr eintreten konnte (S. 31 f.). Das ist zwar richtig, zeigt aber, daß der Fall Mannesmann als Ausgangssachverhalt für die dogmatische Fragestellung nicht wirklich geeignet ist.
b) Teil 2 der Untersuchung befaßt sich im 1. Kapitel (S. 38 ff.) ausführlich mit Fragen der Vergütungsstruktur bei Vorstandsmitgliedern und stellt etliche Erscheinungsformen variabler Entlohnungsmodelle vor. Zu diesen gehören auch Anerkennungsprämien. Diese sind nach Lösing auf der Basis der Entscheidung des BGH nur zulässig, wenn der mit ihnen verbundene Vermögensabfluß in gleicher Höhe durch anderweiten Vermögenszuwachs ausgeglichen wird. Im 3. und Haupt-Teil beleuchtet Lösing mögliche derartige kompensatorische Effekte (S. 70 ff.). Im Kapitel 1 (S. 73 ff.; unklar jedoch zum Risikogeschäft, S. 107) verweist er zwar auf das aus der Eigenständigkeit der Tatbestandsmerkmale Pflichtwidrigkeit und Nachteil folgende Verschleifungsverbot, kommt darauf aber nur gegen Ende zurück, als er procedurale Kriterien (wohl) der Pflichtwidrigkeit zuordnete S. 216). Ansonsten läßt sich keine Prüfung dahingehend erkennen, welchem Tatbestandsmerkmal welcher Aspekt zugeordnet werden muß. Zutreffend ist allerdings, daß Lösing eine Verbindung lediglich zwischen Nachteil und Kompensation herstellt (S. 76, 84). Die in der allgemeinen Rechtsprechung bereits anerkannten Kompensationseffekte finden sich auf den S. 78 f. aufgelistet. Systematisierend unterscheidet Lösing zwischen direkter und indirekter Kompensation und bei Letzterer solche vor generell- und spezialeffektivem Hintergrund (S. 80 ff.).
c) Das 2. Kapitel des 2. Teils (S. 84 ff.) ist Fragen des Vermögensbegriffs gewidmet. Am Beginn steht die Prüfung, (1) welche Vermögensbestandteile (der aufgrund der Wortwahl naheliegende Zirkelschluß läßt sich mit einem Verständnis dahingehend vermeiden, daß hier die Gegenstände gemeint sind, die dem Inhaber im bürgerlich-rechtlichen Sinne zustehen) für § 266 StGB (ebenso für § 263 StGB) relevant sind und welche nicht und (2) wie der Nachteil bzw. Schaden zu ermitteln ist (S. 85).
Zu (1) hebt Lösing anknüpfend an die grundlegenden Arbeiten Hefendehls hervor, daß die Vermögensgefährdung auf der Schadensseite das Spiegelbild zur Exspektanz auf der Seite des Vermögens und damit möglicher Kompensationen darstellt (S. 86). Daraus leitet er mit Saliger eine nur vom Zweifelssatz eingeschränkte Symmetrie dergestalt ab, daß das Unmittelbarkeitskriterium entweder auf beiden Seiten oder weder beim Ab- noch beim Zufluß Anwendung finden kann (S. 87; erweitert auf das gesamte Verständnis des Vermögens sowohl im Hinblick auf Minderungen wie Mehrungen, S. 128, 130), ohne aber eine Entscheidung dieser Alternativität zu treffen. Bei der weiteren Prüfung relevanter Vermögensgegenstände stellt Lösing auf den Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ ab (S. 87), ebenso bei der Frage, ob und wie genau der Nachteil zu quantifizieren ist (S. 88 ff.). Das ist verfehlt – aber nicht, weil dieser nur eingeschränkt gälte (S. 127). Es handelt sich dabei vielmehr allein um eine prozessuale Entscheidungsregel, welche im materiellen Recht keinen Platz hat.
Aus dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG kann kein exaktes Quantifizierungsgebot abgeleitet werden (S. 90 f.). Mag auch das Vorhandensein des Strafzumessungsgrundes eines besonders schweren Falls beim Eintritt eines Verlusts ‚großen Ausmaßes‘ für die Notwendigkeit exakter Quantifizierung sprechen (S. 91 ff.), so gilt das nicht für das Schuldprinzip als solches (S. 93 f.). Das von Lösing (S. 94, auch 105) angeführte Argument ist schlagend, wenngleich nur auf der Ebene des einfachen, nicht des Verfassungsrechts: Aufgrund des notwendigen Kausalzusammenhangs zwischen Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht und dem Nachteil sind aus der tatsächlich eingetretenen Vermögensminderung zur Bestimmung des Nachteils all die Effekte herauszunehmen, welche nicht auf dieser spezifischen Pflichtwidrigkeit beruhen. Das ist nicht exakt, sondern nur mit Hilfe einer wertenden Betrachtung möglich. Gegen das Erfordernis exakter Quantifizierung und für die Zulässigkeit der Schätzung der Höhe des an sich festgestellten Schadens führt Lösing weitere, eher utilitaristische Argumente an, verweist aber auch auf einige Vorschriften im StGB, welche Schätzungen ausdrücklich zulassen (S. 94 ff.). Obwohl die Reduzierung auf die Frage nach der Zulässigkeit von Schätzungen das Thema ‚Quantifizierung‘ nicht ausschöpft, erst recht nicht die in der Überschrift zum Ausdruck gebrachte weitergehende Problematik der Abgrenzung relevanter von irrelevanten Vermögensbestandteilen, auf welche Lösing erst später zurückkommt (S. 111 ff.), kann ihm ohne weiteres in seinem Ergebnis gefolgt werden, daß exakte Feststellungen zu treffen sind, soweit das nach einem pragmatischen Maßstab möglich ist, daß aber jenseits dessen Schätzungen zulässig sind (S. 96 f.). Konsequenterweise wendet sich Lösing anschließend, wenn auch arg knapp, der Frage zu, unter welchen Voraussetzungen Schätzungen mit dem Bestimmtheitsgebot vereinbar sind (S. 97 f.).
Die Überlegungen zur Ermittlung des Schadens bzw. Nachteils (2.) setzen bei den von Lösing sogenannten verschiedenen Schadensarten an (S. 98 ff.). Er befaßt sich zunächst (S. 98 f.) mit Besonderheiten bei Risikogeschäften (ausgenommen S. 106 ff.), der schadensgleichen Vermögensgefährdung allgemein, dem individuellen Schadenseinschlag und dem Submissionsbetrug. Ob es sich dabei jedoch um verschiedene Arten von Schäden mit materiellrechtlich unterschiedlichen Inhalten handelt, oder ob eine Definition allgemein gilt, bei der Subsumtion aber jeweils auf die Besonderheiten des Falles und seiner Umstände abzustellen ist, oder ob es sich gar nur um prozessuale Fragen des Beweises handelt, thematisiert Lösing nicht. Er wendet sich schnell dem Prinzip der Gesamtsaldierung zu (S. 99 ff.) und konstatiert, daß es nicht ausnahmslos durchgehalten werde (S. 105) und es zudem zulasse, den maßgeblichen Zeitpunkt unterschiedlich, ja beinahe beliebig zu bestimmen (S. 104). Bei Risikogeschäften verstehe der BGH den Schaden/Nachteil anders. Der fehlende Versuch einer Systematisierung rächt sich in der eher hilflosen Feststellung, der Risikoschaden lasse sich nicht anhand objektiver Kriterien bestimmen und sei daher durch einen stark normativen Charakter geprägt (S. 108). Lösing stellt dem und der aufgrund der Ausnahmen ihn ebenfalls nicht überzeugenden Gesamtsaldierung die zivilrechtliche Differenzhypothese gegenüber (108 f.), welcher ersichtlich seine Sympathie gehört (S. 109 ff.). Konsequenzen daraus macht Lösing allerdings nicht deutlich. Stellt man sowohl auf Minderungen als auch auf Zuwächse im betroffenen Vermögen ab, so werden auch die Kompensationen erfaßt – eine eigene Erkenntnis Lösings, allerdings beschränkt auf das Risikogeschäft und die in der Rechtsprechung anerkannte Rechtsfigur eines ‚wirtschaftlich vernünftigen Gesamtplans‘ (S. 107, auch S. 133).
Nach Befassung mit den von ihm unterschiedenen Schadens-Arten wendet sich Lösing wieder dem Aspekt (1.) zu (S. 111 ff.) und spaltet die Frage nach der Werthaltigkeit von Vermögenspositionen auf in die Bestimmung relevanter Positionen (a) und deren Bewertung (b), S. 111. Vermögens-strafrechtlich relevant (a) sind nach Lösing (S. 111. f.) allgemeine Positionen (Eigentum etc., nicht aber bestrittene Forderungen – der Grund dafür bleibt dunkel) und (S. 112 ff.) Exspektanzen, verstanden mit Hefendehl als bereits vorhandene Herrschaftsmacht. Eine umfassende Bestimmung dessen, was vom Strafrecht als Vermögen geschützt wird, ist das nicht (Affektionsinteresse?) und war auch wohl nicht intendiert. Die Bewertung (b) kann auf verschiedenen Wegen erfolgen (S. 116 ff.). Zuerst zu nennen ist der Marktwert. Lösing (S. 116 ff.) beschreibt anschaulich, daß und warum ein solcher nicht immer feststellbar ist. Auch ein rein intersubjektiv vereinbarter Preis (S. 120) kann jedenfalls nicht durchweg maßgeblich sein, weil damit unredliche Geschäftspartner mit dem unlauter festgelegten Preis zugleich den Wert bestimmen könnten (S. 119). In Betracht kommen ferner der Wiederverkaufswert (S. 120 f.), Kombinationen aus objektiven und subjektiven Elementen (S. 121) sowie verschiedene betriebswirtschaftliche Methoden zur Feststellung des Barwerts (S. 122 ff.). Letztlich bestätigt Lösing sein bereits bei Befassung mit der Zulässigkeit von Schätzungen gefundenes Ergebnis (S. 96 f.): soweit möglich, komme es auf den nach objektiven Kriterien zu bestimmenden Marktwert, im übrigen auf substantielle Schätzungen an (S. 126 f.).
d) Nachfolgend fragt Lösing nach den Voraussetzungen für die Anerkennung kompensatorischer Effekte (S. 127 ff.). Problematisch seien nicht die allgemeinen Voraussetzungen, wirtschaftlicher Wert und Quelle in der strafbaren Handlung. Fraglich sei hingegen, ob die Kausalität von Zurechnungskriterien wie dem Unmittelbarkeitserfordernis einzuschränken ist und ob, sowie wenn ja, welche wirtschaftlichen Zuflüsse aus normativen Gründen nicht anzuerkennen seien (kriminelle Herkunft <Verhältnis zur Notwendigkeit, daß nur auf die Tat zurückzuführende Zuflüsse kompensieren können>, Schadenersatz etc.), S. 127. Dabei kommt er erneut auf die Frage (1.) nach der Abgrenzung zwischen relevanten und irrelevanten Vermögensteilen zurück (S. 128 f.). Die Prüfung etwaiger Einschränkung schlichter Kausalität (S. 130 ff.) erstreckt sich von den verworfenen Kriterien der Gleichzeitigkeit (S. 132 f.) und Unmittelbarkeit (S. 133 ff.), über die ebenfalls als unzureichend angesehenen Aspekte des Vorsatzes und der Adäquanztheorie zur objektiven Zurechnung zwischen Rechtsgut und Vermögenseffekt (S. 136 f.). Letzteres aufgreifend schlägt Lösing vor, die Zurechnung unter Berücksichtigung des Telos der Untreue vorzunehmen, manifestiert in Kausalität und Zugriffsmöglichkeit (S. 138). Ob darin mehr liegt als die vom Tatbestand vorgegebene Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Nachteil bleibt dabei offen. Die Prüfung der Eignung eintretender Folgen zur Kompensation beginnt mit dem Satz: „Kompensatorische Effekte müssen generell kompensationsfähig sein“ (S. 138). Gemeint ist damit: Effekte sind nicht als kompensatorisch anzuerkennen, wenn ihnen die generelle Kompensationsfähigkeit fehlt.
Sein Versprechen allgemeiner Ausführungen zu den Anforderungen an die generelle Kompensationsfähigkeit (S. 142) löst Lösing nur mit Ausführungen zu Mannesmann ein (S. 143 ff.). Folgen wird man ihm darin können, die Gewährung einer Anerkennungsprämie nicht als Risikogeschäft zu betrachten. Nachfolgend wendet sich Lösing verschiedenen Effekten zu und prüft die Kompensationseignung von Anreizwirkungen jenseits der Person des Empfängers der Anerkennungsprämie S. 143 ff. (generell bejaht, S. 146 f., 152; Quantifizierung: Schätzung nach betriebswirtschaftlichem DCF-Verfahren); der Steigerung der Reputation des Unternehmens, S. 152 ff. (ebenfalls generell bejaht, S. 155; Bemessung der Reputation: spezifische Demoskopie, S. 155 f., aber nicht quantifizierbar, S. 158), und der Schaffung von Geschäftschancen, S. 158 f. (ohne Beantwortung der Frage nach genereller Eignung: nicht bewert- und damit nicht quantifizierbar). Das Fazit lautet: schwer bewertbar, aber wegen des Zweifelssatzes nicht völlig zu vernachlässigen (S. 159). Das Ergebnis der Betrachtung von an die Empfänger von Anerkennungsprämien anknüpfenden Anreizwirkungen (S. 160 ff.: erhöhte Bindung, nur in concreto Mannesmann: nein, S. 160 f.; Loyalität bzw. Herauskaufen illoyaler Vorstandsmitglieder: bestenfalls zum Erzielen von Spezialeffekten über die Rechtspflichten hinaus, S. 161 f.) ist ein entschiedenes: kann sein – oder auch nicht (S. 163 f.).
e) Gegenstand von Teil 3, Kapitel 3 (S. 164 ff.) ist das Problem mangelnder Quantifizierbarkeit wertvoller Effekte. Letztere kann nach Lösing auf vier Gründe zurückgehen: Fehlen eines klaren Erfolgsmaßstabs, fehlende statistische Erhebungen, mangelnde Separierbarkeit verschiedener Effekte und zeitlich gestreckter Eintritt von Wirkungen. Nach allgemeiner Verwerfung der Extreme (jeder oder gar kein generell kompensationsgeeigneter Effekt kompensiert) sucht er unter Berücksichtigung der Belange des Beschuldigten und der Strafverfolgung für den Umgang mit dem konkreten Problem mangelnder Quantifizierbarkeit der Kompensationseffekte von Anerkennungsprämien nach einer vermittelnden Lösung (S. 169 ff). Da ihm dafür allein weder die richterliche Überzeugung (S. 171 ff.) noch der Zweifelssatz (S. 174 f.) genügen, unternimmt er den Versuch (S. 176 ff.) einer Konkretisierung der Angemessenheit anhand von 10 verschiedenen methodischen Ansätzen (S. 176 ff.: Normative Festsetzung <S. 176 f.: absolute Obergrenzen; S. 177 f.: Abhängigkeit vom Festgehalt>; S. 178 f.: Zustimmung der Aktionäre; S. 180 f.: sittliche Anschauungen; S. 181 f.: Üblichkeit; S. 182 ff.: Wahrscheinlichkeitstheorien; S. 188 f.: § 87 AktG; S. 189 f.: DCGK; S. 190 ff.: Anlehnung an die steuerrechtliche Behandlung verdeckter Gewinnausschüttungen; S. 201 f.: Dreistufenmodell nach Lücke; S. 202: Umstände des Einzelfalls). Lösing sieht keinen dieser Ansätze als für sich überzeugend an (S. 202 f.), entnimmt aber einigen einzelne Elementen, die er in drei Schritten für sinnvoll kombinierbar hält: Wenn (a) die Feststellung aller Zu- und Abflüsse und (b) deren Quantifizierung per Sachverständigengutachten keinen verläßlichen Erwartungs- bzw. Barwert ergäbe, so müsse (c) auf die Umstände des Einzelfalls abgestellt werden (S. 203 ff.).
Für die dafür erforderliche Gesamtschau führt Lösing eine Liste von Indizien an (S. 205 ff.: nachfrageorientierte Kriterien mit erheblicher Aussagekraft, S. 213 <S. 205 ff.: Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds; S. 208 f.: Lage der Gesellschaft; S. 209 f.: Größe des Unternehmens; S. 210 f.: Ertragsstärke; S. 211 f.: Branche>; S. 213 ff.: angebotsorientierte Kriterien mit ebenfalls erheblicher Aussagekraft, S. 215 f. <S. 213: Stellenmarkt; S. 213 f.: Qualifikation und Leistung; S. 214; Berufserfahrung/Alter; S. 215: Familienverhältnisse>; S. 216 ff.: aufgrund unvermeidlicher Verschleifung mit dem Tatbestandsmerkmal der Pflichtwidrigkeit und wohl auchwegen zu starker Normativierung (S. 219 f.) ungeeignete procedurale Kriterien <S. 217: Nähe zum Unternehmensgegenstand; S. 217: sachwidrige Motive; S. 217 f.: Unabhängigkeit des befaßten Aufsichtsrats; S. 218: Transparenz; S. 219: Kontrollintensität des Aufsichtsrats; S. 219: Dokumentation und Begründung>; S. 220 f.: relationales Kriterium der (Un-)Üblichkeit, und S. 221 f.: funktionale Kriterien, beide Letztgenannten wohl als tendentiell geeignet betrachtet). Das Bemühen um eine Reihenfolgen (S. 222 ff.) mündet in die Bevorzugung materieller vor funktionalen Kriterien (S. 226).
3. Dem Rezensenten ist der Versuch mißlungen, aus dieser beeindruckenden Liste und den sonstigen Darlegungen abzulesen oder auch nur abzuleiten, wieviel Euro und wieviel Cent z.B. das Alter des Empfängers der Anerkennungsprämie denn nun wert ist. Er dürfte damit allerdings weder alleinstehen noch kann die Ursache der Misere Lösing angelastet werden: Die Auswirkungen von Anerkennungsprämien (wie manch anderer Aufwendungen nicht nur für Werbung, Spenden, Sponsoring, sondern auch für die Festsetzung von Gehältern und das Sich-Lohnen von Investitionen) lassen sich schlicht nicht, jedenfalls nicht ex ante, wie es für Betrug und Untreue erforderlich ist, quantifizieren. Dies zu konstatieren ist keine Kapitulation des Strafrechts, wenn man schlicht einsieht, daß all die genannten wie auch alle anderen qualitativen Gesichtspunkte zum Tatbestandsmerkmal der Pflichtwidrigkeit gehören, so daß für die Feststellung des Nachteils allein quantitative Operationen übrigbleiben. Für Anerkennungsprämien bedeutet dies: Ob und in welcher Höhe sie gewährt werden, unterliegt der von seiner Pflichtenstellung begrenzten Einschätzungsprärogative des Aufsichtsrats. Innerhalb der äußersten Grenzen des Rechts hat er eine Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Pflicht- und damit rechtswidrig ist lediglich die Überschreitung des so bestimmen Rahmens. Diesen festzustellen, ist schwer genug. Hierfür lassen sich allerdings manche der Überlegungen Lösings fruchtbar machen. Ist eine Anerkennungsprämie bis zu einer bestimmten Höhe pflichtgemäß, so läßt sich der Nachteil durch einfache Differenzbildung zur gewährten Höhe berechnen. Ist hingegen die Auskehr einer Anerkennungsprämie völlig unzulässig, so scheiden Effekte, die zum Zeitpunkt des Endes der Tathandlung als dem maßgeblichen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden können, als Kompensation aus und können bestenfalls noch im Rahmen der Strafzumessung mildernd berücksichtigt werden. Bei Beschränkung des Untersuchungsgegenstands auf Anerkennungsprämien wäre daher zu prüfen gewesen, ob eine unzulässige derartige Prämie exakt oder im Wege der Schätzung quantifizierbare und damit kompensationsgeeignete Folgen zeitigt. Dazu hätten allerdings die Bewertungsfragen (S. 116 ff.) in den Mittelpunkt gestellt werden müssen. Dies ist nicht geschehen – mit spürbaren Auswirkungen auf den Ertrag der Dissertation.