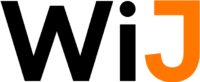Tagungsbericht zur WisteV-wistra-Neujahrstagung 2013 am 18/19.01.2013 in Frankfurt am Main
Die diesjährige WisteV-wistra Neujahrstagung 2013, die wie üblich bereits lange im Vorfeld ausgebucht war und auf dementsprechend reges Interesse stieß, befasste sich mit dem Thema „Wirtschaftsethik und Privatisierungstendenzen des Wirtschaftsstrafrechts“.
Die wirtschaftsethischen Fragen der dargebotenen Vorträge und Diskussionen bezogen sich weniger auf den Bereich der durch sogenannte „Internal Investigations“ bekannten Privatisierungsmaßnahmen im Wirtschaftsstrafrecht, als vielmehr auf den Kern des präventiven Aspekts der wirtschaftsstrafrechtlichen Praxis, namentlich des Compliancegerechten Verhaltens.
Einleitend stellte Salditt den jüngsten Fall einer umfangreichen Durchsuchungsmaßnahme in der Deutschen Bank Zentrale in Frankfurt am Main dar. Die auf der Grundlage der Maßnahme an das Auditorium gestellte Frage, ob es zulässig oder auch ethisch vertretbar sei, dass sich der Chef der Deutschen Bank im Anschluss an die Durchsuchungsmaßnahme bei dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes über die Art und Weise der Durchsuchung beschwerte, veranlasste Salditt dazu, den Begriff Wirtschaftsethik als „Ethik des Widerspruchs“ zu bezeichnen. Er machte deutlich, dass sowohl bundes- als auch landesrechtlich ein Recht auf Petition und ein sogenanntes „Notrufrecht des Bürgers“ bestehe, was derlei Schritte durchaus beinhalten könne. Dieser Aufhänger diente als Überleitung zu den thematisch dominierenden Fragen der Privatisierung wirtschaftsstrafrechtlicher Ermittlungen. Problematisch sei, dass bei privatrechtlichen Ermittlungen der schützende Rahmen der Gesetzesvorgaben entfalle. Jedem aktiv oder passiv von internen Ermittlungen bei Privatunternehmen Betroffenen müsse klar sein, dass deren Durchführung nicht nur unter gesetzlichen Maßgaben kritisch zu beleuchten sei, sondern auch oder sogar erst recht unter ethischen Gesichtspunkten.
I. Themenblock 1: Privatisierung der Strafverfolgung- Wirtschaftsethische Orientierung, Selbstregulierungund Selbstreinigung durch Compliance im Wirtschaftsleben?
An die Einleitung schloss sich im ersten Themenblock, der von Bussmann moderiert wurde, der Vortrag von Grüninger zum Thema „Effizienz der Wirtschaftsethik in der Praxis: Präventionswirkung oder nicht?“ an. Während Grüninger die Frage der Präventionswirkung der Wirtschaftsethik aus Sicht der Wirtschaftsethik selbst beurteilte bzw. referierte, betrachtete der Anschlussvortrag von Moosmayer die Frage aus Sicht der Unternehmenspraxis, hier einem Unternehmen, das aufgrund der Ereignisse in der Vergangenheit sowohl mit der Aufarbeitung von strafrechtlich relevanten Fällen durch eigene, als auch durch staatliche Ermittlungsmaßnahmen betroffen war und umfangreiche Präventivmaßnahmen getroffen hat.
Grüninger begann seinen Blick auf die Wirtschaftsethik zunächst lapidar mit dem Eingeständnis, dass es ihm bis heute nicht gelungen sei, herauszufinden, worüber er eigentlich vortragen solle, warf aber dann die These auf, dass moralische Maßstäbe für die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems unabdingbar seien. Während die Wirtschaftsethik in der Theorie eine Identifizierungs- und Implementierungsaufgabe im Wirtschaftssystem habe, bestehe in der Praxis das Problem, dass ein Unternehmen rechtlich beispielsweise für Menschenrechtsverletzungen in seiner Produktionskette kaum haftbar gemacht werden könne. Allenfalls ein moralischer Druck, der auf den Unternehmen laste, könne zur Durchsetzung und Beachtung (wirtschafts-)ethischer Herausforderungen führen, wobei die gern verwendete Terminologie der sogenannten „Corporate Social Responsibility“ (CSR) oftmals nicht mehr als ein Etikett vieler Unternehmen sei, bei dem der Teufel im Detail stecke. Insofern warf Grüninger die Frage auf, ob Verantwortungsmanagement im Unternehmen tatsächlich die Befürwortung und das Leben ethisch moralischer Maßstäbe beinhalte, oder ob es letztlich nichts anderem diene als der Enthaftung des Vorstands und somit als Marketing-Gag zu qualifizieren sei. Dementsprechend sei es sehr wohl ein Unterschied, ob ein Unternehmen mit unternehmensinterner Compliance Bestechung verhindern wolle, oder ob es die Begehung von Korruptionsstraftraten aus wirtschaftsethischen Gründen verbiete. Um eine Brücke zwischen Compliance- und Ethikmanagement im Unternehmen zu schlagen, schlug der Referent vor, Compliance-Programme an der Werteidentität eines Unternehmens auszurichten und forderte, dass wirksame Compliance auf dem Fundament eines umfassenden Ethik- und Wertemanagements, dem sämtliche Führungsorgane zu folgen hätten, basieren müsse.
Auch Moosmayer eröffnete seinen Vortrag mit der Aussage, dass er ein „Problem mit dem Begriff Ethik“ habe: Er, Moosmayer, sehe die Problematik, dass ein Unternehmen und dessen Umfeld stets auf Gewinnerzielung ausgerichtet sei, wogegen per se der Vorwurf unethischen Handelns erhoben werde. Ethik und Gewinnerzielungsabsicht seien nach seiner Ansicht schwer miteinander vereinbar. Die zentrale Frage im Unternehmen sei aber nicht die nach der Ethik, sondern vielmehr, ob die geltenden Gesetze eingehalten würden. Wie und in welchem Umfang Gesetzesverstöße in der Vergangenheit im Unternehmen Siemens aufgearbeitet worden sind und wie die zukünftige Gesetzestreue des Unternehmens und seiner Mitarbeiter gewährleistet wird bzw. werden soll, stellte der Referent anschließend überblicksartig dar. Im Rahmen der Vermeidung zukünftiger Straftaten werde den Themen „Werte“ und „Integrität“ erhebliche Bedeutung beigemessen, während Bestandteilen des Ethikbegriffes im Rahmen des Aufbaus einer Compliance-Struktur keine größere Relevanz zukomme.
Der Anschlussvortrag von Bock zum Thema „Wirtschaftsethik und Recht als Quellen präventiver Compliance?“ befasste sich einleitend mit vier Problemstellungen, die die Wirtschaftsethik zu bewältigen habe, und deren positive Beantwortung gleichermaßen Voraussetzung für einen Gleichklang und eine Funktionsfähigkeit von Ethik und Recht seien. Probleme lägen danach in der Legitimation allgemeinverbindlicher Normen der Wirtschaftsethik, in deren Beliebigkeit und Vagheit sowie in ihrer Wandelbarkeit im Lichte der Rechtsgeschichte bzw. der „Unrechtsgeschichte“ und auch in der (wirtschaftlichen) Nachteiligkeit ethischen Handelns. Diese Problemstellungen, so Bock, beträfen nicht nur die Wirtschaftsethik, sondern gleichermaßen auch das Recht. Der Referent kam zu dem Zwischenergebnis, dass Wirtschaftsethik sowohl Rechtsbefolgung als auch eine Investition in die Zukunft, aber auch eine „strafbare Geldverschwendung“ im Lichte des § 266 StGB darstellen könne. Alle drei Auswirkungen könnten parallel auftreten. Zur Konkretisierung von Compliance könne die Wirtschaftsethik aufgrund dieser Vielschichtigkeit jedoch wenig beitragen.
Der Themenblock endete mit der aus der Perspektive des Strafrechts durch Gaedigk und aus der Perspektive des Zivilrechts durch Annuß beleuchteten Frage der „Rechtlichen Grenzen der Privatisierung der repressiven Compliance (Internal Investigations und Whistleblowing)“. Schon diese Terminologie wurde von Gaedigk unter dem Aspekt kritisiert, dass Strafverfolgung Aufgabe der Ermittlungsbehörden sei und bleibe. Insbesondere sei zu betonen, dass die Entscheidung, wie in einem Ermittlungsverfahren weiter vorgegangen werde, allein die Staatsanwaltschaft treffe. Geadigk, Oberstaatsanwältin in Hamburg, wagte sich eigener Aussage zufolge mit ihrem Vortrag in die „Höhle des Löwen“ und erntete in der Tat für ihre Thesen keine ungeteilte Zustimmung. Sie betonte nochmals die Legitimation staatsanwaltschaftlicher Zwangsmaßnahmen, und zwar auch dann, wenn das betroffene Unternehmen Kooperationsbereitschaft signalisiert und beispielsweise Herausgabe bestimmter Unterlagen angekündigt habe. Befragt nach der steigenden Anzahl von internen Ermittlungen durch Unternehmen und deren Bewertung äußerte die Referentin, dass die anfängliche Begeisterung nunmehr einer gewissen „Katerstimmung“ gewichen sei, da der Versuch der Einflussnahme der Unternehmen auf die Ermittlungen und deren Ergebnisse unverkennbar sei. Man habe häufig mit einer „Salamitaktik“ der Unternehmen zu kämpfen, bei der nur sukzessive Informationen und Unterlagen geliefert würden. Sie jedenfalls trete der Tendenz entgegen, dass die Staatsanwaltschaft lediglich als „Prüfinstanz“ und nicht mehr als Ermittlungsbehörde angesehen werde.
Die anschließend von Annuß beleuchtete Perspektive des Zivilrechts stellte sich als ein Parforceritt durch die mannigfaltigen Fallstricke für Unternehmen und Berater im Rahmen von Internal Investigations dar. Diese von Annuß als „Sternstunde der Gesetzesverletzung“ bezeichneten Maßnahmen seien unter zahlreichen gesetzlichen Vorgaben kritisch zu beleuchten, so unter den Problempunkten Datenschutz, Missachtung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates, Rechte der Mitarbeiter bei der Durchführung von Gesprächen und der Weitergabe von Ermittlungsergebnissen an die Staatsanwaltschaft. Zweifelhaft seien zudem die bei Unternehmen sehr populären Amnestieprogramme, insbesondere unter haftungsrechtlichen Aspekten der Unternehmensführung.
II. Podiumsdiskussion
Die abendliche Podiumsdiskussion zum Thema „Rechtsstaatliche und ethische Fragen der Delegation der Strafverfolgung auf (betroffene) Private – Internal Investigations, Whistleblowing, Kronzeugenregelung, Selbstanzeigen“, die von Korte geleitet wurde, war mit durchaus namhaften Vertretern aus Theorie und Praxis besetzt: Frau Hohmann-Dennhardt und den Herren Fischer, Jahn und Taschke. Sie litt jedoch etwas unter der Ausgestaltung mehr als Referatsplattform denn als Podiumsdiskussion. Die insofern nur bedingt lebhafte Auseinandersetzung innerhalb des Podiums wurde durch Fischer dankenswerterweise mit Leben gefüllt, nachdem auch er seine Äußerung zunächst mit den Worten einleitete, dass er im Grunde genommen keinerlei Ahnung von dem Thema der Veranstaltung habe und sich wundere, warum er überhaupt eingeladen sei. Das Gros der Teilnehmer ließ anschließend – zu vorgerückter Stunde – den ersten Tag der Neujahrstagung bei Diskussionen und Gesprächen bis spät in der Nacht an der Bar ausklingen.
III. Themenblock 2: Ethik, Sportrecht, Sportgerichtsbarkeitund Sportstrafrecht
Der zweite Tag begann sportlich, dies sowohl thematisch als auch zeitlich um 09:15 Uhr. Der Themenblock wurde von Bannenberg moderiert und genoss insofern hohe Aktualität, als gerade in der Nacht zuvor die Fortsetzung der „Dopingbeichte“ des ehemaligen siebenfachen Tour de France Siegers Lance Armstrong im Fernsehen ausgestrahlt worden war. Bevor das Panel in das hochaktuelle Thema einstieg, wurde zunächst Frau Dr. Katja Rödiger der WisteV Preis 2012 für ihre wirtschaftsstrafrechtliche Dissertation zum Thema „Strafverfolgung von Unternehmen, Internal Investigations und strafrechtliche Verwertbarkeit von Mitarbeitergeständnissen – Untersuchungen am Beispiel der Siemenskorruptionsaffäre“ verliehen.
Mühlbauer gab sodann in dem ersten Vortrag zum Thema „Praxis des Dopingstrafrechts“ einen nachdenklich stimmenden Einblick in die Praxis des Leistungs- und insbesondere des Breitensports. Darüber hinaus stellte sie die dem Nicht-Fachmann wenig geläufigen Straftatbestände der § 95 ff. AMG einschließlich ihrer Anwendungsschwierigkeiten dar. (Kraftsport-)Doping lässt demnach offenbar nicht nur die Muskeln wachsen, sondern auch die Eingangszahlen bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft München I. Aus Sicht der Referentin besteht gleichwohl gesetzgeberischer Nachholbedarf hinsichtlich der Strafbarkeit des Besitzes auch von geringeren Mengen und vom Handeltreiben mit Dopingmitteln insgesamt – was eine weitere Annäherung an das Betäubungsmittelstrafrecht mit sich brächte – und einer Kronzeugenregelung.
Im Anschluss referierte Prokop zur Frage des „Betrugs durch Sportdoping“ und der Frage der Strafbarkeit gem. § 263 StGB nach Offenbarwerden eines Dopingdelikts. Er lieferte für die Strafbarkeitsfrage relevante Einblicke aus der Praxis des Sports und erläuterte die daraus resultierenden Rechtsprobleme. Gedopt werde i.d.R. zu Trainingszeiten, um dort die Intensität zu erhöhen, und nicht unmittelbar im oder vor dem Wettkampf, so der Referent. Um eine Betrugsstrafbarkeit des dopenden Sportlers zu begründen, müssten die Vertragspartner des Sportlers – Veranstalter, Sponsoren etc. – beispielsweise Erklärungen des Athleten in die jeweiligen Verträge aufnehmen, dass er auch in der Trainingsphase nicht gedopt habe.
Der infolge terminlicher Friktionen vorgezogene Vortrag von Haas zum Thema „Privatisierung der Strafverfolgung im (internationalen) Sportrecht“ führte die Zuhörer in die Art und Weise der Schiedsgerichtsbarkeit im internationalen Sportrecht in Lausanne ein, zu der alle sportrechtlichen Streitigkeiten weltweit gelangen. Infolgedessen gelte für alle Nationen ein einheitlicher Standard, der durch staatliche Institutionen zumindest (aber auch nur) minimal kontrolliert werde. Dem Vorteil des einheitlichen Standards durch eine privatisierte Sportgerichtsbarkeit stünden jedoch auf der Sollseite die faktischen Grenzen des Systems entgegen. So sei es beispielsweise im aktuellen Dopingthema nicht möglich, die Hintermänner des Systems zu fassen. Aufgrund der „Flucht in die Schiedsgerichtsbarkeit“ komme zudem eine Zuhilfenahme staatlicher Institutionen bei solchen Fällen nicht mehr in Betracht.
Momsen befasste sich im Anschluss mit der Frage „Manipulation von Sportwetten und Schiedsrichterbestechung: Straflose Korruption im Sport?“. Dass die Manipulation von Sportwetten unter dem Gesichtspunkt des § 263 StGB strafbar sei, stehe außer Frage. Zu erörtern sei jedoch, ob noch eine Strafbarkeit unter korruptionsrechtlichen Aspekten in Betracht komme. Als Ergebnis hielt der Referent jedoch fest, dass das sogenannte „Match-Fixing“ und damit die Manipulation eines Ergebnisses bzw. der ausführenden Belegschaft einer Sportveranstaltung in allen denkbaren Facetten sowohl mangels Handelns im geschäftlichen Verkehr als auch aufgrund fehlender Amtsträgereigenschaft nicht unter das deutsche Korruptionsstrafrecht falle. Dies sei insbesondere deshalb interessant, da von der weltweiten Manipulation von Sportwetten oder auch der Schiedsrichterbestechung erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen ausgingen. Die hier bestehende Strafbarkeitslücke sei deshalb nicht tolerabel. Seinen Vortrag schloss Momsen mit der Forderung nach einem eigenen Straftatbestand der Schiedsrichterbestechung, nicht zuletzt aufgrund der erheblichen Praxisrelevanz dieser Fälle.
Der anschließende Vortrag von Pieth und Schenk zum Thema „Praxis der Selbstregulierung und Selbstreinigung im Wirtschaftsbetrieb Sport am Beispiel der FIFA“ offenbarte erhebliche Defizite in der Selbstregulierung des Weltfußballverbandes. Mangels Einflusses staatlicher Gewalt sei der status quo gekennzeichnet von „Wildwestmethoden“ und „Patronage“ als Folge übermäßigen Liquiditätszuflusses, mangelnder Regularien und der Ausgestaltung von Sportdachverbänden als NPO (non profit organisation). Diese Defizite führten zu einem Nachhol- und Regulierungsbedarf bei den Sportverbänden, der nach dem Vorbild internationaler Großunternehmen in punkto Compliance, Buchführung und anwendbaren Normen und Regularien ausgestaltet werden müsste. Ziel sei hier die Herstellung von Transparenz und Demokratie. In Anbetracht der von Pieth zuvor geschilderten Ausgangslage handelt es sich dabei jedoch um ein sehr ehrgeiziges Ziel, dessen Verwirklichung noch in weiter Ferne zu vermuten ist. Ebenfalls einen nachdenklich stimmenden Praxiseinblick gab die Referentin Schenk, die die Monopolstellung der Sportverbände kritisierte und auf die sogenannte „Inzucht“ der Verbände hinwies: Die Vorstände der Verbände seien alle ehemalige Aktive und damit Teil des Systems einschließlich der darin existenten Seilschaften. Der Wille zur Aufklärung und zur Neuerung sei dementsprechend eher gering. Zudem seien die Vorstände der Sportverbände sowie die Verbände selbst in einer Art Popularitätsfalle gefangen, die jegliche Fähigkeit zur Selbstkritik im Keim ersticke. Der aktuellen Tagespresse ist zu entnehmen, dass die u. a. von Pieth und Schenk geforderten Reformen allenfalls in Ansätzen von der FIFA umgesetzt werden und sich die Befürchtungen der Referenten bewahrheitet haben.
Thematisch an die Forderungen von Mühlbauer anknüpfend ging Rübenstahl auf das Dopingstrafrecht de lege ferenda ein. Während ein generelles, mengenunabhängiges Verbot des Besitzes von Dopingmitteln geplant sei, ferner auch der Umgang mit Dopingmitteln in verschiedensten Facetten unter Strafe gestellt werden solle, werde eine weitgehende Strafbarkeit des Handeltreibens vorerst nicht Gesetz werden. Rübenstahl nahm eine verfassungsrechtliche Einordnung möglicher strengerer Strafvorschriften vor.
IV. Themenblock 3: Steuergerechtigkeit und Strafbarkeitder Steuerhinterziehung
Am zweiten Tag der Veranstaltung, einem Samstag, ab 14:00 Uhr zum Themenblock „Steuergerechtigkeit und Strafbarkeit der Steuerhinterziehung“ zu referieren, erscheint prima facie als Herausforderung für Redner wie Zuhörer. Unter der Leitung von Wulf, der sich als Moderator, Fragensteller und Diskutant glänzend aufgelegt zeigte, schafften es Tappe, Bülte und Hechtner nichtsdestotrotz, eine Fülle von Informationen unterhaltsam zu präsentieren. Dass Steuern steuern, also nicht nur finanzieren, sondern auch gestalten, erläuterte Tappe u.a. anhand einprägsamer historischer Beispiele wie der „Mordsteuer“, die vom verantwortlichen Ermittler für nicht aufgeklärte Tötungsdelikte zu leisten war. Zielgerichtet schiffte der Referent auf das Kernproblem der Steuerung durch Entlastung von Steuern zu, für die es gute Gründe – etwa den Umweltschutz – gebe, die aber schlechte Folgen zeitigen können, wie die Durchbrechung des Grundsatzes der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Bülte forderte juristische Kategorien für die Antwort auf die Frage, ob es strafbar sei, ein ungerechtes Steuergesetz zu verletzen. Er fand diese in der Differenzierung zwischen vom Bundesverfassungsgericht als nichtig festgestellten Steuergesetzen auf der einen Seite – mit der Folge fehlender Strafbarkeit – und mit der Verfassung unvereinbaren Steuergesetzen auf der anderen Seite, die aber mit einer befristeten Weitergeltungsanordnung versehen würden – hier sei ein Verstoß strafbar.
In seinem Referat über die „Gerechtigkeits- und Anwendungsfragen der Selbstanzeige sowie von Amnestieregelungen im Steuerstrafrecht“ beschäftigte sich der Ökonom Hüchtner u.a. mit dem (endgültig gescheiterten?) Steuerabkommen Deutschlands mit der Schweiz. Um die Frage der persönlichen Steuergerechtigkeit beantworten zu können, brauche der Ökonom Daten. Solche würden seitens der Politik auch auf Anfrage selten herausgegeben, man müsse „sich da einen Abgeordneten greifen“, so die sympathische, direkte und basisdemokratische Herangehensweise des Ökonomen, der anschließend entsprechende Daten präsentieren konnte. Der Referent berichtete sodann zum Thema Selbstanzeige u.a. auch über die Arbeitsgemeinschaft „Zweifelsfragen Schwarzgeldbekämpfungsgesetz“, in der offene Anwendungsfragen für die Praxis beantwortet würden.
Zusammenfassend darf gesagt werden, dass es absolut lohnenswert war, auch den letzten Teil der insgesamt wieder sehr gelungenen Neujahrstagung aufmerksam zu verfolgen.
[:en]
Die diesjährige WisteV-wistra Neujahrstagung 2013, die wie üblich bereits lange im Vorfeld ausgebucht war und auf dementsprechend reges Interesse stieß, befasste sich mit dem Thema „Wirtschaftsethik und Privatisierungstendenzen des Wirtschaftsstrafrechts“.
Die wirtschaftsethischen Fragen der dargebotenen Vorträge und Diskussionen bezogen sich weniger auf den Bereich der durch sogenannte „Internal Investigations“ bekannten Privatisierungsmaßnahmen im Wirtschaftsstrafrecht, als vielmehr auf den Kern des präventiven Aspekts der wirtschaftsstrafrechtlichen Praxis, namentlich des Compliancegerechten Verhaltens.
Einleitend stellte Salditt den jüngsten Fall einer umfangreichen Durchsuchungsmaßnahme in der Deutschen Bank Zentrale in Frankfurt am Main dar. Die auf der Grundlage der Maßnahme an das Auditorium gestellte Frage, ob es zulässig oder auch ethisch vertretbar sei, dass sich der Chef der Deutschen Bank im Anschluss an die Durchsuchungsmaßnahme bei dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes über die Art und Weise der Durchsuchung beschwerte, veranlasste Salditt dazu, den Begriff Wirtschaftsethik als „Ethik des Widerspruchs“ zu bezeichnen. Er machte deutlich, dass sowohl bundes- als auch landesrechtlich ein Recht auf Petition und ein sogenanntes „Notrufrecht des Bürgers“ bestehe, was derlei Schritte durchaus beinhalten könne. Dieser Aufhänger diente als Überleitung zu den thematisch dominierenden Fragen der Privatisierung wirtschaftsstrafrechtlicher Ermittlungen. Problematisch sei, dass bei privatrechtlichen Ermittlungen der schützende Rahmen der Gesetzesvorgaben entfalle. Jedem aktiv oder passiv von internen Ermittlungen bei Privatunternehmen Betroffenen müsse klar sein, dass deren Durchführung nicht nur unter gesetzlichen Maßgaben kritisch zu beleuchten sei, sondern auch oder sogar erst recht unter ethischen Gesichtspunkten.
I. Themenblock 1: Privatisierung der Strafverfolgung
– Wirtschaftsethische Orientierung, Selbstregulierung
und Selbstreinigung durch Compliance im Wirtschaftsleben?
An die Einleitung schloss sich im ersten Themenblock, der von Bussmann moderiert wurde, der Vortrag von Grüninger zum Thema „Effizienz der Wirtschaftsethik in der Praxis: Präventionswirkung oder nicht?“ an. Während Grüninger die Frage der Präventionswirkung der Wirtschaftsethik aus Sicht der Wirtschaftsethik selbst beurteilte bzw. referierte, betrachtete der Anschlussvortrag von Moosmayer die Frage aus Sicht der Unternehmenspraxis, hier einem Unternehmen, das aufgrund der Ereignisse in der Vergangenheit sowohl mit der Aufarbeitung von strafrechtlich relevanten Fällen durch eigene, als auch durch staatliche Ermittlungsmaßnahmen betroffen war und umfangreiche Präventivmaßnahmen getroffen hat.
Grüninger begann seinen Blick auf die Wirtschaftsethik zunächst lapidar mit dem Eingeständnis, dass es ihm bis heute nicht gelungen sei, herauszufinden, worüber er eigentlich vortragen solle, warf aber dann die These auf, dass moralische Maßstäbe für die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems unabdingbar seien. Während die Wirtschaftsethik in der Theorie eine Identifizierungs- und Implementierungsaufgabe im Wirtschaftssystem habe, bestehe in der Praxis das Problem, dass ein Unternehmen rechtlich beispielsweise für Menschenrechtsverletzungen in seiner Produktionskette kaum haftbar gemacht werden könne. Allenfalls ein moralischer Druck, der auf den Unternehmen laste, könne zur Durchsetzung und Beachtung (wirtschafts-)ethischer Herausforderungen führen, wobei die gern verwendete Terminologie der sogenannten „Corporate Social Responsibility“ (CSR) oftmals nicht mehr als ein Etikett vieler Unternehmen sei, bei dem der Teufel im Detail stecke. Insofern warf Grüninger die Frage auf, ob Verantwortungsmanagement im Unternehmen tatsächlich die Befürwortung und das Leben ethisch moralischer Maßstäbe beinhalte, oder ob es letztlich nichts anderem diene als der Enthaftung des Vorstands und somit als Marketing-Gag zu qualifizieren sei. Dementsprechend sei es sehr wohl ein Unterschied, ob ein Unternehmen mit unternehmensinterner Compliance Bestechung verhindern wolle, oder ob es die Begehung von Korruptionsstraftraten aus wirtschaftsethischen Gründen verbiete. Um eine Brücke zwischen Compliance- und Ethikmanagement im Unternehmen zu schlagen, schlug der Referent vor, Compliance-Programme an der Werteidentität eines Unternehmens auszurichten und forderte, dass wirksame Compliance auf dem Fundament eines umfassenden Ethik- und Wertemanagements, dem sämtliche Führungsorgane zu folgen hätten, basieren müsse.
Auch Moosmayer eröffnete seinen Vortrag mit der Aussage, dass er ein „Problem mit dem Begriff Ethik“ habe: Er, Moosmayer, sehe die Problematik, dass ein Unternehmen und dessen Umfeld stets auf Gewinnerzielung ausgerichtet sei, wogegen per se der Vorwurf unethischen Handelns erhoben werde. Ethik und Gewinnerzielungsabsicht seien nach seiner Ansicht schwer miteinander vereinbar. Die zentrale Frage im Unternehmen sei aber nicht die nach der Ethik, sondern vielmehr, ob die geltenden Gesetze eingehalten würden. Wie und in welchem Umfang Gesetzesverstöße in der Vergangenheit im Unternehmen Siemens aufgearbeitet worden sind und wie die zukünftige Gesetzestreue des Unternehmens und seiner Mitarbeiter gewährleistet wird bzw. werden soll, stellte der Referent anschließend überblicksartig dar. Im Rahmen der Vermeidung zukünftiger Straftaten werde den Themen „Werte“ und „Integrität“ erhebliche Bedeutung beigemessen, während Bestandteilen des Ethikbegriffes im Rahmen des Aufbaus einer Compliance-Struktur keine größere Relevanz zukomme.
Der Anschlussvortrag von Bock zum Thema „Wirtschaftsethik und Recht als Quellen präventiver Compliance?“ befasste sich einleitend mit vier Problemstellungen, die die Wirtschaftsethik zu bewältigen habe, und deren positive Beantwortung gleichermaßen Voraussetzung für einen Gleichklang und eine Funktionsfähigkeit von Ethik und Recht seien. Probleme lägen danach in der Legitimation allgemeinverbindlicher Normen der Wirtschaftsethik, in deren Beliebigkeit und Vagheit sowie in ihrer Wandelbarkeit im Lichte der Rechtsgeschichte bzw. der „Unrechtsgeschichte“ und auch in der (wirtschaftlichen) Nachteiligkeit ethischen Handelns. Diese Problemstellungen, so Bock, beträfen nicht nur die Wirtschaftsethik, sondern gleichermaßen auch das Recht. Der Referent kam zu dem Zwischenergebnis, dass Wirtschaftsethik sowohl Rechtsbefolgung als auch eine Investition in die Zukunft, aber auch eine „strafbare Geldverschwendung“ im Lichte des § 266 StGB darstellen könne. Alle drei Auswirkungen könnten parallel auftreten. Zur Konkretisierung von Compliance könne die Wirtschaftsethik aufgrund dieser Vielschichtigkeit jedoch wenig beitragen.
Der Themenblock endete mit der aus der Perspektive des Strafrechts durch Gaedigk und aus der Perspektive des Zivilrechts durch Annuß beleuchteten Frage der „Rechtlichen Grenzen der Privatisierung der repressiven Compliance (Internal Investigations und Whistleblowing)“. Schon diese Terminologie wurde von Gaedigk unter dem Aspekt kritisiert, dass Strafverfolgung Aufgabe der Ermittlungsbehörden sei und bleibe. Insbesondere sei zu betonen, dass die Entscheidung, wie in einem Ermittlungsverfahren weiter vorgegangen werde, allein die Staatsanwaltschaft treffe. Geadigk, Oberstaatsanwältin in Hamburg, wagte sich eigener Aussage zufolge mit ihrem Vortrag in die „Höhle des Löwen“ und erntete in der Tat für ihre Thesen keine ungeteilte Zustimmung. Sie betonte nochmals die Legitimation staatsanwaltschaftlicher Zwangsmaßnahmen, und zwar auch dann, wenn das betroffene Unternehmen Kooperationsbereitschaft signalisiert und beispielsweise Herausgabe bestimmter Unterlagen angekündigt habe. Befragt nach der steigenden Anzahl von internen Ermittlungen durch Unternehmen und deren Bewertung äußerte die Referentin, dass die anfängliche Begeisterung nunmehr einer gewissen „Katerstimmung“ gewichen sei, da der Versuch der Einflussnahme der Unternehmen auf die Ermittlungen und deren Ergebnisse unverkennbar sei. Man habe häufig mit einer „Salamitaktik“ der Unternehmen zu kämpfen, bei der nur sukzessive Informationen und Unterlagen geliefert würden. Sie jedenfalls trete der Tendenz entgegen, dass die Staatsanwaltschaft lediglich als „Prüfinstanz“ und nicht mehr als Ermittlungsbehörde angesehen werde.
Die anschließend von Annuß beleuchtete Perspektive des Zivilrechts stellte sich als ein Parforceritt durch die mannigfaltigen Fallstricke für Unternehmen und Berater im Rahmen von Internal Investigations dar. Diese von Annuß als „Sternstunde der Gesetzesverletzung“ bezeichneten Maßnahmen seien unter zahlreichen gesetzlichen Vorgaben kritisch zu beleuchten, so unter den Problempunkten Datenschutz, Missachtung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates, Rechte der Mitarbeiter bei der Durchführung von Gesprächen und der Weitergabe von Ermittlungsergebnissen an die Staatsanwaltschaft. Zweifelhaft seien zudem die bei Unternehmen sehr populären Amnestieprogramme, insbesondere unter haftungsrechtlichen Aspekten der Unternehmensführung.
II. Podiumsdiskussion
Die abendliche Podiumsdiskussion zum Thema „Rechtsstaatliche und ethische Fragen der Delegation der Strafverfolgung auf (betroffene) Private – Internal Investigations, Whistleblowing, Kronzeugenregelung, Selbstanzeigen“, die von Korte geleitet wurde, war mit durchaus namhaften Vertretern aus Theorie und Praxis besetzt: Frau Hohmann-Dennhardt und den Herren Fischer, Jahn und Taschke. Sie litt jedoch etwas unter der Ausgestaltung mehr als Referatsplattform denn als Podiumsdiskussion. Die insofern nur bedingt lebhafte Auseinandersetzung innerhalb des Podiums wurde durch Fischer dankenswerterweise mit Leben gefüllt, nachdem auch er seine Äußerung zunächst mit den Worten einleitete, dass er im Grunde genommen keinerlei Ahnung von dem Thema der Veranstaltung habe und sich wundere, warum er überhaupt eingeladen sei. Das Gros der Teilnehmer ließ anschließend – zu vorgerückter Stunde – den ersten Tag der Neujahrstagung bei Diskussionen und Gesprächen bis spät in der Nacht an der Bar ausklingen.
III. Themenblock 2: Ethik, Sportrecht, Sportgerichtsbarkeit
und Sportstrafrecht
Der zweite Tag begann sportlich, dies sowohl thematisch als auch zeitlich um 09:15 Uhr. Der Themenblock wurde von Bannenberg moderiert und genoss insofern hohe Aktualität, als gerade in der Nacht zuvor die Fortsetzung der „Dopingbeichte“ des ehemaligen siebenfachen Tour de France Siegers Lance Armstrong im Fernsehen ausgestrahlt worden war. Bevor das Panel in das hochaktuelle Thema einstieg, wurde zunächst Frau Dr. Katja Rödiger der WisteV Preis 2012 für ihre wirtschaftsstrafrechtliche Dissertation zum Thema „Strafverfolgung von Unternehmen, Internal Investigations und strafrechtliche Verwertbarkeit von Mitarbeitergeständnissen – Untersuchungen am Beispiel der Siemenskorruptionsaffäre“ verliehen.
Mühlbauer gab sodann in dem ersten Vortrag zum Thema „Praxis des Dopingstrafrechts“ einen nachdenklich stimmenden Einblick in die Praxis des Leistungs- und insbesondere des Breitensports. Darüber hinaus stellte sie die dem Nicht-Fachmann wenig geläufigen Straftatbestände der § 95 ff. AMG einschließlich ihrer Anwendungsschwierigkeiten dar. (Kraftsport-)Doping lässt demnach offenbar nicht nur die Muskeln wachsen, sondern auch die Eingangszahlen bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft München I. Aus Sicht der Referentin besteht gleichwohl gesetzgeberischer Nachholbedarf hinsichtlich der Strafbarkeit des Besitzes auch von geringeren Mengen und vom Handeltreiben mit Dopingmitteln insgesamt – was eine weitere Annäherung an das Betäubungsmittelstrafrecht mit sich brächte – und einer Kronzeugenregelung.
Im Anschluss referierte Prokop zur Frage des „Betrugs durch Sportdoping“ und der Frage der Strafbarkeit gem. § 263 StGB nach Offenbarwerden eines Dopingdelikts. Er lieferte für die Strafbarkeitsfrage relevante Einblicke aus der Praxis des Sports und erläuterte die daraus resultierenden Rechtsprobleme. Gedopt werde i.d.R. zu Trainingszeiten, um dort die Intensität zu erhöhen, und nicht unmittelbar im oder vor dem Wettkampf, so der Referent. Um eine Betrugsstrafbarkeit des dopenden Sportlers zu begründen, müssten die Vertragspartner des Sportlers – Veranstalter, Sponsoren etc. – beispielsweise Erklärungen des Athleten in die jeweiligen Verträge aufnehmen, dass er auch in der Trainingsphase nicht gedopt habe.
Der infolge terminlicher Friktionen vorgezogene Vortrag von Haas zum Thema „Privatisierung der Strafverfolgung im (internationalen) Sportrecht“ führte die Zuhörer in die Art und Weise der Schiedsgerichtsbarkeit im internationalen Sportrecht in Lausanne ein, zu der alle sportrechtlichen Streitigkeiten weltweit gelangen. Infolgedessen gelte für alle Nationen ein einheitlicher Standard, der durch staatliche Institutionen zumindest (aber auch nur) minimal kontrolliert werde. Dem Vorteil des einheitlichen Standards durch eine privatisierte Sportgerichtsbarkeit stünden jedoch auf der Sollseite die faktischen Grenzen des Systems entgegen. So sei es beispielsweise im aktuellen Dopingthema nicht möglich, die Hintermänner des Systems zu fassen. Aufgrund der „Flucht in die Schiedsgerichtsbarkeit“ komme zudem eine Zuhilfenahme staatlicher Institutionen bei solchen Fällen nicht mehr in Betracht.
Momsen befasste sich im Anschluss mit der Frage „Manipulation von Sportwetten und Schiedsrichterbestechung: Straflose Korruption im Sport?“. Dass die Manipulation von Sportwetten unter dem Gesichtspunkt des § 263 StGB strafbar sei, stehe außer Frage. Zu erörtern sei jedoch, ob noch eine Strafbarkeit unter korruptionsrechtlichen Aspekten in Betracht komme. Als Ergebnis hielt der Referent jedoch fest, dass das sogenannte „Match-Fixing“ und damit die Manipulation eines Ergebnisses bzw. der ausführenden Belegschaft einer Sportveranstaltung in allen denkbaren Facetten sowohl mangels Handelns im geschäftlichen Verkehr als auch aufgrund fehlender Amtsträgereigenschaft nicht unter das deutsche Korruptionsstrafrecht falle. Dies sei insbesondere deshalb interessant, da von der weltweiten Manipulation von Sportwetten oder auch der Schiedsrichterbestechung erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen ausgingen. Die hier bestehende Strafbarkeitslücke sei deshalb nicht tolerabel. Seinen Vortrag schloss Momsen mit der Forderung nach einem eigenen Straftatbestand der Schiedsrichterbestechung, nicht zuletzt aufgrund der erheblichen Praxisrelevanz dieser Fälle.
Der anschließende Vortrag von Pieth und Schenk zum Thema „Praxis der Selbstregulierung und Selbstreinigung im Wirtschaftsbetrieb Sport am Beispiel der FIFA“ offenbarte erhebliche Defizite in der Selbstregulierung des Weltfußballverbandes. Mangels Einflusses staatlicher Gewalt sei der status quo gekennzeichnet von „Wildwestmethoden“ und „Patronage“ als Folge übermäßigen Liquiditätszuflusses, mangelnder Regularien und der Ausgestaltung von Sportdachverbänden als NPO (non profit organisation). Diese Defizite führten zu einem Nachhol- und Regulierungsbedarf bei den Sportverbänden, der nach dem Vorbild internationaler Großunternehmen in punkto Compliance, Buchführung und anwendbaren Normen und Regularien ausgestaltet werden müsste. Ziel sei hier die Herstellung von Transparenz und Demokratie. In Anbetracht der von Pieth zuvor geschilderten Ausgangslage handelt es sich dabei jedoch um ein sehr ehrgeiziges Ziel, dessen Verwirklichung noch in weiter Ferne zu vermuten ist. Ebenfalls einen nachdenklich stimmenden Praxiseinblick gab die Referentin Schenk, die die Monopolstellung der Sportverbände kritisierte und auf die sogenannte „Inzucht“ der Verbände hinwies: Die Vorstände der Verbände seien alle ehemalige Aktive und damit Teil des Systems einschließlich der darin existenten Seilschaften. Der Wille zur Aufklärung und zur Neuerung sei dementsprechend eher gering. Zudem seien die Vorstände der Sportverbände sowie die Verbände selbst in einer Art Popularitätsfalle gefangen, die jegliche Fähigkeit zur Selbstkritik im Keim ersticke. Der aktuellen Tagespresse ist zu entnehmen, dass die u. a. von Pieth und Schenk geforderten Reformen allenfalls in Ansätzen von der FIFA umgesetzt werden und sich die Befürchtungen der Referenten bewahrheitet haben.
Thematisch an die Forderungen von Mühlbauer anknüpfend ging Rübenstahl auf das Dopingstrafrecht de lege ferenda ein. Während ein generelles, mengenunabhängiges Verbot des Besitzes von Dopingmitteln geplant sei, ferner auch der Umgang mit Dopingmitteln in verschiedensten Facetten unter Strafe gestellt werden solle, werde eine weitgehende Strafbarkeit des Handeltreibens vorerst nicht Gesetz werden. Rübenstahl nahm eine verfassungsrechtliche Einordnung möglicher strengerer Strafvorschriften vor.
IV. Themenblock 3: Steuergerechtigkeit und Strafbarkeit
der Steuerhinterziehung
Am zweiten Tag der Veranstaltung, einem Samstag, ab 14:00 Uhr zum Themenblock „Steuergerechtigkeit und Strafbarkeit der Steuerhinterziehung“ zu referieren, erscheint prima facie als Herausforderung für Redner wie Zuhörer. Unter der Leitung von Wulf, der sich als Moderator, Fragensteller und Diskutant glänzend aufgelegt zeigte, schafften es Tappe, Bülte und Hechtner nichtsdestotrotz, eine Fülle von Informationen unterhaltsam zu präsentieren. Dass Steuern steuern, also nicht nur finanzieren, sondern auch gestalten, erläuterte Tappe u.a. anhand einprägsamer historischer Beispiele wie der „Mordsteuer“, die vom verantwortlichen Ermittler für nicht aufgeklärte Tötungsdelikte zu leisten war. Zielgerichtet schiffte der Referent auf das Kernproblem der Steuerung durch Entlastung von Steuern zu, für die es gute Gründe – etwa den Umweltschutz – gebe, die aber schlechte Folgen zeitigen können, wie die Durchbrechung des Grundsatzes der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Bülte forderte juristische Kategorien für die Antwort auf die Frage, ob es strafbar sei, ein ungerechtes Steuergesetz zu verletzen. Er fand diese in der Differenzierung zwischen vom Bundesverfassungsgericht als nichtig festgestellten Steuergesetzen auf der einen Seite – mit der Folge fehlender Strafbarkeit – und mit der Verfassung unvereinbaren Steuergesetzen auf der anderen Seite, die aber mit einer befristeten Weitergeltungsanordnung versehen würden – hier sei ein Verstoß strafbar.
In seinem Referat über die „Gerechtigkeits- und Anwendungsfragen der Selbstanzeige sowie von Amnestieregelungen im Steuerstrafrecht“ beschäftigte sich der Ökonom Hüchtner u.a. mit dem (endgültig gescheiterten?) Steuerabkommen Deutschlands mit der Schweiz. Um die Frage der persönlichen Steuergerechtigkeit beantworten zu können, brauche der Ökonom Daten. Solche würden seitens der Politik auch auf Anfrage selten herausgegeben, man müsse „sich da einen Abgeordneten greifen“, so die sympathische, direkte und basisdemokratische Herangehensweise des Ökonomen, der anschließend entsprechende Daten präsentieren konnte. Der Referent berichtete sodann zum Thema Selbstanzeige u.a. auch über die Arbeitsgemeinschaft „Zweifelsfragen Schwarzgeldbekämpfungsgesetz“, in der offene Anwendungsfragen für die Praxis beantwortet würden.
Zusammenfassend darf gesagt werden, dass es absolut lohnenswert war, auch den letzten Teil der insgesamt wieder sehr gelungenen Neujahrstagung aufmerksam zu verfolgen.