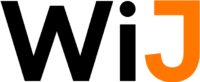Compliance und Justiz
Bestandsaufnahme, Fehlerquellen und Reformansätze
Ein Tagungsbericht zur WisteV-wistra-Neujahrstagung 2015
Die sechste Neujahrstagung der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung (WisteV) und der Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) fand am 16. und 17.01.2015 zum diesjährigen Thema „Compliance in der Justiz“ im Westin Grand in Frankfurt am Main statt.Nahezu 200 Experten – darunter Strafverteidiger, Staatsanwälte, Richter und Wissenschaftler – folgten der Einladung zu bereichernden Vorträgen und spannenden Diskussionen.
Die Überschrift suggeriert, dass Compliance und Justiz getrennte Dinge seien. Streng genommen stimmt das, sofern Compliance als Instrument von und für Unternehmen begriffen wird. Versteht man Compliance allerdings als generelle Rechtstreue, dann enthält der Begriff, wie Prof. Dr. Franz Salditt deutlich machte, eigentlich nichts Neues, vielmehr müsse sich die Justiz immer rechtstreu verhalten. Dies könne allerdings nur dann funktionieren, wenn die Revisionsgerichte die Verletzung von Kontrollfunktionen, also Compliance-Verstöße, überprüfen würden. Besondere Herausforderungen seien nach Dr. Thomas Nuzinger, Mitglied des Tagungsausschusses der WisteV, die gegenwärtige Medienberichterstattung sowie ein gewisser Unmut über vermeintlich tief liegende Fehler im Strafverfahren.
I. Bestandsaufnahme: Praktische Probleme und Probleme der Praxis deutscher Wirtschaftsstrafverfahren
Gegenstand des ersten Themenblocks war die Frage nach einer etwaigen Überforderung und/oder Überlastung der deutschen Strafjustiz in Wirtschaftsstrafsachen sowie eine mögliche Missachtung der gesetzlichen Vorgaben.
Prof. Dr. Hendrik Schneider diagnostizierte eine Krankheit des „Patienten“ Justiz, wenngleich kein Infarkt drohe. Belegt werde dies durch die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik sowie der Richterstatistik des Bundesamtes für Justiz. Die Anzahl der Tatverdächtigen sei demnach rückläufig und die Anzahl der Richter sowie der Staatsanwälte konstant, was keinen Rückschluss auf eine Überbelastung zulasse. Aus der durchschnittlich hohen Verfahrensdauer im Rahmen der Wirtschaftsdelikte folge allerdings das Erfordernis von prozessualen „Überdruckventilen“, wie etwa § 153a StPO. Diese Ventile könnten allerdings ihren Zweck verfehlen, sofern sie durch den Misskredit der Öffentlichkeit oder durch Formalisierungsanforderungen verstopft würden.
Diskussionsleiter OStA Raymung Weyand bemängelte die eingeschränkte Aussagefähigkeit der Statistiken, da die große Zahl der Teilzeitstellen nicht berücksichtigt worden sei. Schneider stimmte zu, dass diese im Rahmen einer detaillierteren – noch ausstehenden – Untersuchung, die zur Überprüfung seiner Thesen erforderlich sei, berücksichtigt werden müsste.
RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn bezweifelte, ob die Dauer der Erledigung einen Rückschluss auf die Komplexität zulasse. Berichts- und Dokumentationspflichten seien in diesem Zusammenhang immer erforderlich und daher von der Komplexität unabhängig. LOStA Dr. Ewald Brandt fügte hinsichtlich der Statistiken hinzu, dass der Vakanzenstand in Hamburg 10 bis 15 % betrage und die absolute Zahl der Stellen nicht repräsentativ sei um die Praxis vollständig widerzuspiegeln. Dr. Matthias Korte thematisierte, ob das materielle Recht zur Überlastung führen würde und fragte, inwiefern die Diskussion durch neue Tatbestände tangiert werde. Schneider wies darauf hin, dass § 299 StGB vormals im UWG normiert war und durch die Einführung in das Kernstrafrecht auch dementsprechend angewendet werde. Zudem prognostizierte Schneider eine Ausdehnung durch einen künftigen § 299a StGB. Eine Nichtanwendung sei in der Praxis nicht vorstellbar.
Brandt stellte in seinem Referat eingangs den Unterschied zwischen einer Überlastung und einer Überforderung fest. Die deutsche Strafjustiz habe mehrfach gezeigt, dass sie hochkomplizierte Wirtschaftssachen bewältigen könne. Insofern liege keine Überforderung vor. Gleichwohl entstehe vielfach der Anschein der Überforderung, vermehrt im Rahmen von Vermögensdelikten, da die oft auftretenden neuen Begehungsweisen eine besondere Herausforderung darstellten. Es sei jedoch unbestritten, dass die Strafjustiz hoch belastet und in großen Teilen auch überlastet sei. Die Belastung sei darauf zurückzuführen, dass sich Inhalte, durch vermehrt internationale Bezüge sowie technische Kenntnisse, geändert hätten und Dokumentations- und Benachrichtigungspflichten ohne Personalausgleich ausgeweitet werden würden. Gerade das Wirtschaftsstrafverfahren sei durch die Bindung von ohnehin schon knappen Personalressourcen hoch belastet, was zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit – als Konsequenz von Überlastung – führe. Dies wirke sich auch auf die Anzahl der Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO aus, dem ein hohes Dunkelfeld, bedingt durch den notgedrungen geringen Ermittlungsaufwand, bescheinigt werden könne. Negative Auswirkungen für den Rechtsstaat seien, so Brandt, die Aushöhlung des Legalitätsprinzips, die mangelnde Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sowie der verheerende Gewöhnungseffekt, Straftaten und deren Sanktionierung in bestimmten Deliktsbereichen zur Verhandlungssache zu deklarieren. Lösungsansätze seien die Ausgrenzung von nachrangigen Delikten im Wege der Einbeziehung von Vermögensstraftaten in den Katalog der Privatklagedelikte, die Konkretisierung von Straftatbeständen sowie eine Straffung des Prozessrechts, etwa durch die Erleichterung bei der Zurückweisung von Befangenheitsanträgen oder die Möglichkeit der Ablehnung von Anträgen, sofern diese nur der Verfahrensverzögerung dienen.
RiLG Dr. Andreas Sturm präsentierte anschließend einen umfassenden Einblick in die empirische Erhebung der „Altenhain-Studie“, die zur Grundlage der Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts im Verständigungsurteil vom 19.03.2013 wurde. Gründe für Absprachen in Strafverfahren, jenseits der Empirie, seien externe Ursachen, wie die stetige Ausweitung des materiellen Strafrechts, zunehmend komplexere Lebenssachverhalte sowie begrenzte Ressourcen der Justiz. Auch die StPO könne gerade im Hinblick auf die überbordende Anzahl von Anträgen im Rahmen der Konfliktverteidigung nicht schritthalten. Ergänzend sei Richtern keine ausreichende Auslegung bzw. Kommentierung zu § 257c StPO zugänglich, weshalb einzelne Merkmale unklar blieben. Gegen eine Besserung dieses Zustands spreche die Empirie an sich, da seit der Erhebung Altenhains aus dem Jahre 2007 keine wesentliche Änderung bewirkt worden sei. Zudem fehle es an einer dem Rechtsanwender gewinnbringenden juristischen Auseinandersetzung, die nicht die Bindungswirkung des Bundesverfassungsgerichtsurteils, sondern die Umsetzung in der Praxis debattiere. Für eine Besserung spreche, dass vermehrt Rechtsmittel eingelegt werden würden und das Bewusstsein in der Justiz steige. Bei weiterer Nonkonformität bestehe allerdings die Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht die Verständigung untersagen könnte.
In der anschließenden Diskussion über die zwei vorangegangenen Referate drückte Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann seine Erschütterung hinsichtlich des Abspracheverhaltens aus, das für die Wissenschaft inakzeptabel sei. Der Deal sei der Einzug der kontinuierlichen Missachtung von Verfahrensvorschriften in das Strafrecht gewesen. Dr. Eren Basar merkte an, dass die Überlastung der Staatsanwaltschaften für die Verteidigung Fluch und Segen aber zugleich ein Teil der Verteidigungsstrategie seien. Dr. Oliver Kipper forderte, dass sich die Justiz Standards setzen müsse. Wenn die Staatsanwaltschaften den Mangel in einem Unternehmen genauso sähen wie die Verteidiger Mängel bei der Justiz feststellen würden, dann wäre ein Compliance-Verstoß evident.
Unter der Moderation von Prof. Dr. Joachim Jahn diskutierten Dr. Sven Thomas und Prof. Dr. Thomas Rönnau über die Anwendung des § 153a StPO im Wirtschaftsstrafverfahren.
Thomas relativierte die zunächst behaupteten tatsächlichen sowie rechtlichen Schwierigkeiten, da der Richter das Recht kenne und daher keine schwierige Rechtslage bestehe. Vielmehr führe die Anwendung von § 153a StPO vor dem Hintergrund von Ressourcen und Ergebnissen zu Effizienz und erfülle zudem eine Korrektivfunktion gegenüber dem materiellen Recht. Thomas hob auch bestehende Zweifel der Strafkammern im Hinblick auf eine Verurteilung sowie eines Freispruchs hervor, da beides dem Betroffenen im Einzelfall nicht gerecht werden könnte. Die Bereitschaft des Beschuldigten zur Anwendung des § 153a StPO sei ebenfalls durch Opportunitätserwägungen geprägt. Unter Hinzuziehung des ökonomischen Konzepts der Opportunitätskosten, die dem Verzicht auf ein konkretes Geschäft entsprechen, beschrieb Thomas die Kosten für den Betroffenen im Strafverfahren in Form von Arbeitskosten, Verlust der Lebensqualität und der Risikofreiheit außerhalb des Gerichts, also der persönlichen Perspektive.
Rönnau äußerte erhebliche Bedenken hinsichtlich der gegenwärtigen Anwendung des § 153a StPO. Die Allgemeinheit sei als ein wesentlicher Beteiligter des Verfahrens von dem Schulterschluss der Verfahrensbeteiligten ausgeschlossen. Daneben würden wirtschaftliche Erwägungen bei Unternehmen die Anwendung des § 153a StPO fördern. Ein Kernproblem bliebe die Gleichbehandlung im Hinblick auf mehrere Verfahren. Es stehe zudem die Frage im Raum, wie Recht noch zu steuern sei, wenn bei schwierigen Verfahren regelmäßig die Einstellung folge.
Nach Joachim Jahns Anmerkung, dass es für die Verständigung im Gegensatz zu § 153a StPO Regeln gebe, verwies Thomas auf die Anwendung des § 153a StPO im Rahmen des nicht-öffentlichen Ermittlungsverfahrens. Es sei unklar, welche Regularien gefunden werden könnten um das Verfahren transparenter zu gestalten. Davon abgesehen beziehe sich die Verständigung im Gegensatz zu § 153a StPO im Ergebnis auf den Schuldspruch.
Nach Rönnau müssten im Lichte der Transparenz Begründungspflichten verankert werden, da bei hohen Einstellungszahlungen ein erhebliches Interesse an den Begründungen bestehe. Die durch den Gesetzgeber vorgenommene „behutsame Ausdehnung“ sei nicht eingehalten worden und auch die gegenwärtige Anwendung auf Fälle mit mittlerer Schuld sei fraglich, da eine vermehrte Anwendung des § 153a StPO auf umfangreiche Fälle des Wirtschaftsstrafrechts zu beobachten sei. Insgesamt erzeuge § 153a StPO daher keinen Rechtsfrieden für die Allgemeinheit, da diese nicht bei der informellen Erledigung mitwirken könne. Die Beteiligung der Öffentlichkeit sei aber eine Grundprämisse des Strafrechts.
In der anschließenden Diskussion kommentierte Prof. Dr. Björn Gercke, dass auch die Wissenschaft die Entscheidung der Beteiligten akzeptieren müsse, auf eine Einstellung hinzuwirken. Darüber hinaus könne ein formelles Korsett der Sache nicht gerecht werden, da § 153a StPO in speziellen Situationen angewendet werden würde. Rönnau entgegnete, dass genau deshalb die Rechtssicherheit und Rechtskultur erheblich leide. Dr. Hanno Durth kritisierte, dass eine Verrechtlichung des § 153a StPO die Ökonomisierung des Rechts rückgängig machen würde und nicht der Gleichbehandlung diene. Auch die Ressourcenprobleme der Justiz könnten nur durch die gegenwärtige Anwendung des § 153a StPO gemildert werden. Matthias Jahn gab zu bedenken, dass es einen Dritten in diesem Zusammenhang nicht gebe und auch nicht geben solle. In der rechtspolitischen Diskussion um die Verständigung in Strafsachen sei ein Vetorecht des Nebenklägers diskutiert, allerdings mit der Begründung versagt worden, das Opfer lasse sich dieses nur unter besonderen, häufig unzumutbaren Gegenleistungen abhandeln. BVerfGE 133, 168 habe festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft die öffentlichen Belange im Bereich des § 153a StPO und der Verständigung zur Geltung bringen solle. Es bedürfe keiner Korrektur, allerdings sei ein Kriterienkatalog auf Ebene der RistBV denkbar. Nach StA Folker Bittmann seien überbordende Vorschriften eher abzubauen als aufzustocken. Demnach sei eine Verbürokratisierung des § 153a StPO nicht sachdienlich und der falsche Weg.
Gegen die Einführung eines Kriterienkatalogs spreche nach Thomas, dass auch andere Kataloge, etwa im Bereich der Strafzumessung, unbeachtet blieben. Die Rechtsunsicherheit sei zudem ein grundsätzliches Problem und auch z.B. nach den Entscheidungen des BGH zu § 266 StGB präsent. Rönnau unterstellte den Verteidigern ein grundsätzliches Interesse an Rechtssicherheit, das durch die gegenwärtige Anwendung des § 153a StPO leide. Außerdem hätten die Staatsanwaltschaften finanzielle Interessen und nicht die Allgemeinheit im Blick. Eine Kontrolle sei bei diesen Verfahren schon aus rechtsstaatlichen Gründen erforderlich.
II. Fehlerquellen im deutschen Wirtschaftsstrafprozess
Der zweite Themenblock widmete sich der Frage, was die Gründe für die im ersten Themenblock erörterten Fragen und Probleme sein könnten.
Das Referat „Lässt die Rechtswissenschaft die Justiz alleine?“ von Prof. Dr. Jens Bülte widmete sich den Forderungen der Praxis nach verständlicheren und konstruktiveren Publikationen, sowie einer redlichen, gewissenhaften und unvoreingenommenen Wissenschaft.
Jeder universitäre Rechtswissenschaftler habe zwar das Recht, seine Kunst im Elfenbeinturm zu betreiben, allerdings dürfe er sich dann nicht wundern, wenn sich außerhalb der Wissenschaft niemand für seine Konstrukte interessiere. Die gemeinsamen Ziele von Wissenschaft und Praxis seien die Fortentwicklung und Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen, effektiven und vor allem am Grundrechtsschutz und dem Verfassungsrecht ausgerichteten Strafrechts bzw. einer solchen Strafrechtspflege. Die Wissenschaft habe daher, so Bülte, eine gewisse Pflicht gegenüber der Justiz, da durch Annahme und Beurteilung einer aktuellen Rechtsproblematik, Verantwortung kraft tatsächlicher Übernahme begründet werde. Im eigenen Interesse müsse sie verständlich sein, um den Anspruch der Wahrnehmung zu erheben.
Destruktive Kritik an der Rechtsprechung sei damit zu begründen, dass Wissenschaft, im Gegensatz zur Justiz, nicht lösungsorientiert arbeiten müsse. Gerade bei öffentlichkeitswirksamen Verfahren, sei die Justiz jedoch gefangen zwischen Einzelgerechtigkeit im Fokus von Medien und Politik einerseits und Systemgerechtigkeit, gefordert von der Wissenschaft, andererseits. Dies führe völlig zu Recht zu dem Ruf nach konstruktiver Kritik und dem Beistand der Wissenschaft.
Grundsatz zur Annäherung an die Wahrheit und der vernünftigen Diskussion sei nicht das Wissen des Einzelnen sondern eine Abwägung des Verfügbaren. Darüber hinaus dürfe nur unabhängige Wissenschaft auch Wissenschaftsfreiheit beanspruchen. Abhängigkeit führe dagegen zum Verlust ihrer Existenzberechtigung und ihrem Wesenskern.
In der Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Praxis dürften verfassungsrechtliche Gründe, wie etwa das Verschleifungsverbot – gerade in der wirtschaftsstrafrechtlichen Diskussion –, nicht zum Vehikel einer strafrechtsdogmatischen Diskussion gemacht werden. Jeder Fehlgebrauch des Verfassungswidrigkeitsarguments schwäche den Grundrechtsschutz und erweise dem Kampf um das Recht einen Bärendienst.
Auf die Frage des Diskussionsleiters RA Alexander Sättele, ob die Wissenschaft Möglichkeiten der konstruktiven Teilnahme verschenke, wies Bülte auf die in Österreich vorgesehene Kommunikation bei Gesetzesvorhaben zwischen Gesetzgeber und Fakultäten hin. Korte wandte ein, dass dies auch in Deutschland institutionalisiert sei und auf Vorschläge der Strafrechtslehrer gewartet werde. Bei neuer Gesetzgebung werde in den Kommentierungen jedoch nur auf die Verfassungswidrigkeit Bezug genommen, insofern lasse vielmehr die Literatur die Praktiker alleine. Nach Schünemann seien die Strafrechtslehrer- und lehrerinnen mit ca. 200 Personen ein vielstimmiger Chor und organisatorisch unstrukturiert. Eine Lösung könnten Anfragen an die öffentliche Behörde der Universtäten sein, die zur Stellungnahme verpflichtet wären. Die sog. Hearings im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren seien aber lediglich Alibi-Veranstaltungen, da die Professoren nach den Lagern der Fraktionen ausgesucht würden. Die Wissenschaft befände sich daher in einem Zustand der Marginalisierung.
Es folgte das Referat von Schünemann zu dem Thema „Überfordert die Komplexität der Wirklichkeit die Juristen?“.
Ein prinzipielles Problem für die Anwendung des Strafrechts auf individuelles menschliches Handeln im Rahmen von Wirtschaftsunternehmen existiere in Wahrheit nicht, da das Strafrecht mit seiner Suche nach individueller Verantwortlichkeit auch den kollektiven Interaktionsmustern gerecht werden könne. Die These vom Wirtschaftsunternehmen als ein strafrechtlich nicht direkt beeinflussbares autopoetisches System hätte mit der Realität des Lebens wenig zu tun. Vielmehr würden die dogmatischen Grundsätze der objektiven Zurechnung und das Schuldprinzip dazu führen, dass Individuen nicht etwa in fehlerhafter Weise für von ihnen nicht kontrollierte systemische Prozesse verantwortlich gemacht werden könnten.
Durch die international einmalige Machtstellung des deutschen Strafrichters trete eine besondere Be- und Überlastung auf, deren Effekte sich durchweg in einer asymmetrisch-einseitigen Weise zuungunsten des Angeklagten auswirken würden. Dieser Inertia– oder Urteilsperseveranz-Effekt beruhe darauf, dass dem Richter aufgrund der durch die Ermittlungsbehörden zusammengestellten einseitigen Ermittlungsakten eine unbefangene Würdigung des Beweisergebnisses der Hauptverhandlung unmöglich sei. Dies verstärke sich auch durch den Schulterschluss-Effekt zwischen Richter und Staatsanwalt. Der sog. Kothurn-Effekt, der noch nicht durch sozialwissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen worden sei, bestätige sich durch Alltagsbeobachtungen im Strafprozess. Anders als in Zivilprozessen operiere der Richter im Strafverfahren von Anfang an gegenüber einem durch die Anklage moralisch deklassierten Angeklagten, dessen krampfhafte Versuche sich herauszuwinden, seine moralische Minderwertigkeit eher noch bestätigen und dadurch den Richter auffordern würde, den Ausflüchten nicht voreilig auf den Leim zu gehen, sondern alle logisch haltbaren Möglichkeiten der Verurteilung auszuschöpfen. Zusammengefasst sei der Eröffnungsbeschluss im deutschen Strafprozess eine self-fulfilling prophecy, was durch eine seit langem unter 4 % liegende Freispruchquote statistisch bestätigt werde.
Durch die enorme, häufig abnorme Komplexität der Wirtschaftsstrafverfahren dränge sich zunächst der Verdacht auf, dass eine Kompensation der Objektivität der richterlichen Tatsachenfeststellung zerstörenden Effekte hier noch viel schwieriger zu sein scheine als im allgemeinen Strafverfahren. Dieser Verdacht entschärfe sich aber vor dem Hintergrund der Dominanz des Urkundenbeweises im Wirtschaftsstrafverfahren, im Gegensatz zu der informationsdeformierenden Kraft der Glaubwürdigkeitsbeurteilung von Zeugen und der Interpretation ihrer Aussagen.
Die vor rund 200 Jahren geschaffene Struktur des Strafverfahrens lasse eine Rekonstruktion der Komplexität des heutigen Wirtschaftslebens nicht zu. Vielmehr sei das Modell einer alleinigen Urteilsfindung durch die Hauptverhandlung zur Aufarbeitung der überkomplexen Wirtschaftskriminalität nicht mehr geeignet. Zudem würden die durch das Verständigungsgesetz legalisierten Urteilsabsprachen keinen in rechtsstaatlicher Weise auf die Ermittlung der materiellen Wahrheit ausgerichteten Strafprozess mehr übrig lassen.
Ein denkbarer Ansatz zur Bewältigung des Komplexitätsproblems in Wirtschaftsstrafsachen liege, so Schünemann, in einem Einbau unternehmensinterner Ermittlungen in das Ermittlungsverfahren, was aber vom Staat naturgemäß nur verlangt werden könne, wenn er das Unternehmen von jeder strafrechtlichen oder strafrechtsähnlichen Verantwortlichkeit befreie. Die Einführung eines Unternehmensstrafrechts sei dagegen kontraproduktiv. Das neue 4. Aufklärungsparadigma – nach dem 1. Paradigma des Gottesurteils, dem 2. Paradigma des Inquisitionsverfahrens und dem 3. Paradigma des hauptverhandlungszentrierten reformierten Strafverfahrens –, bestehe in der Mitwirkung des Unternehmens als Ermittlungshilfsperson der Staatsanwaltschaft.
Salditt wandte ein, dass beschuldigte Vorstände das Unternehmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nicht vertreten würden, weshalb Unternehmen auch keine Hilfspersonen sein könnten. OStA Dr. Peter Schneiderhahn hob mögliche Gefahren einer Verschmelzung von Ermittlungsverfahren und Internal Investigations hinsichtlich eines weiteren Ressourcenabbaus, der Verletzung des Legalitätsprinzips, der Erstbefassung der Arbeitsgerichte und der Marginalisierung der Beschuldigtenrechte hervor. Dr. Thomas Helck kritisierte die unzureichende Ausbildung der Staatsanwälte und Richter. Gerade Berufsanfänger litten an Überlastung. Auch bleibe im Zusammenhang von Ermittlungsverfahren und Internal Investigations die Frage der Kostentragung.
Der anschließende Vortrag von Schneiderhan widmete sich möglichen strukturellen Fehlerquellen. Schneiderhan bescheinigte der deutschen Justiz ein hohes Maß an Professionalität und eine im internationalen Vergleich hervorzuhebende Korruptionsfreiheit. Es lägen keine strukturellen Fehlerquellen und daher auch kein grundlegender Änderungsbedarf vor. Jedoch seien drei Fehlerquellen im materiellen Recht auszumachen, die nicht richtig ausgeführt würden. Der Gesetzgeber lasse die Justiz bei der Anwendung einiger Normen des materiellen Rechts alleine oder erlasse unklare Gesetze. Der Gleichlauf der Rechtsordnung sei zudem nicht gesichert, da das Strafrecht auf zivil-, wirtschaftliche- und steuerrechtliche Grundentscheidungen zurückgreifen müsse. Auch sei der starke Einfluss des Unionsrechts auf das deutsche Strafrecht – etwa im Arzneimittelgesetz – eine Problemursache.
Eine Fehlerquelle des Strafprozessrechts sei die gesetzlich gewollte unvollständige Beweiserhebung durch § 160a StPO, die fehlende Vorratsdatenspeicherung sowie eine unsichere Beweiserhebung durch veraltete Regelungen zur Sicherung von elektronischen Daten. Dem Strafverfahren fehle es darüber hinaus an einer Konzentrationsmöglichkeit auf die wesentlichen Fragen des Prozesses zum Zweck der Verfahrensvereinfachung. Im Hinblick auf die bisherigen Vorträge wurde bei den Fehlerquellen in der Justizverwaltung betont, dass Staatsanwälte im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts schlichtweg keine Zeit für Fortbildungsmaßnahmen hätten.
In der anschließenden Diskussion bemerkte Dr. Tobias Rudolph, dass das strukturelle Problem ein „Wir-Denken“ der Richter und Staatsanwälte sei. Zudem ließen oftmals sachfremde Erwägungen im Rahmen der §§ 257c, 153a StPO den Verdacht der Korruption zu, da der Begriff sehr weit reiche. Es sollten daher Mechanismen geschaffen werden, die eine partielle Kontrolle zulassen könnten.
III. Reformansätze
Im dritten Themenblock wurden mögliche Reformansätze vorgetragen und diskutiert.
RA PD Dr. Gerson Trüg referierte zunächst zu dem Thema „Alternativen zum (auf Individuen gemünzten) Strafrecht: Verwaltungssanktionen, Bußgelder, Unternehmensstrafrecht?“. Der Mehrwert eines Unternehmensstrafrechts sei kritisch zu beurteilen. Selbst wenn das Individualstrafrecht formal entlastet werden würde, führe dies nicht zu einer Rückbesinnung auf die ultima ratio Funktion und gewährleiste keine einschränkende Anwendung des Strafrechts. Vielmehr würde strafrechtliche Sanktionierung auf beiden Ebenen umgesetzt werden. Auch der Strafzweck sei vor dem Hintergrund der ungeklärten Präventionswirkung problematisch. Strafen könnten auch Stakeholder und damit Unschuldige treffen. Ein Unternehmensstrafrecht laufe darüber hinaus dem sozialethischen Verständnis von Schuld, unter Bezugnahme der Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, zuwider. Es bliebe die Frage nach schuldunabhängigen Kriterien.
Bülte und Trüg diskutierten im Anschluss über die divergierenden verfassungsrechtlichen Argumente und die unterschiedlichen Interpretationen des Lissabon-Urteils im Hinblick auf den Geltungsbereich des Schuldprinzips. Auch die Betroffenheit der Stakeholder wurde unterschiedlich bewertet.
RiBGH Dr. Ralf Eschelbach referierte zur Stärkung von justizinternen Kontrollmechanismen. Durch die überwiegende Erledigung von Wirtschaftsstrafverfahren im Vorverfahren und die damit verbundene geringe Zahl der Revisionen würden neue Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu Fragen der Beweisgewinnung und Beweisverwertung verhindert. Die Revision leiste daher keinen effektiven Rechtsschutz gegen Eingriffsmaßnahmen. Hauptschauplatz des Strafverfahrens sei das Vorverfahren, das bisher allerdings nicht partizipatorisch ausgestattet und im Hinblick auf die Durchsetzung effektiven Rechtsschutzes defizitär sei. Die das Vorverfahren dominierende Verdachtshypothese sei gegen Einwendungen zunehmend abgeschottet. Mittel der neutralen Kontrolle des Verdachts durch eine Gesamtschau seien vor Anklageerhebung nicht gegeben, da eine gemäß Art. 97 GG neutrale Kontrollinstanz zu diesem Zeitpunkt nicht bestehe. Der Ermittlungsrichter sei an einer Verzögerung des Verfahrens nicht interessiert, was regelmäßig zur Stattgabe der Eingriffsmaßnahmen – ohne detaillierte Prüfung – führe. Zur Stärkung interner Kontrollmechanismen und des Rechtsschutzes, den der Richtervorbehalt nicht gewähre, müssten den Ermittlungsrichter justizinterne Kontrollmaßnahmen treffen, die insbesondere Informations-, Dokumentations- und Begründungspflichten umfassen und der Kontrolle des Rechtsmittelverfahrens unterliegen könnten.
Effektive Rechtsfolgen bei fehlerhafter Eingriffsgestattung seien, so Eschelbach, bislang nicht vorgesehen oder nicht realisierbar, weil Beweisverwertungsverbote, durch fehlende positivrechtliche Regelung oder Unanwendbarkeit im Vorverfahren, meist nicht anerkannt würden. Auf der Rechtsfolgenebene sei daher die Aktivierung und gesetzliche Strukturierung des Systems der Beweisverwertungsverbote zu fordern, die zur faktischen Disziplinierung führen und durch eine absolute Wirkung, auch im Vorverfahren, Anwendung finden könnten. Dies sei etwa denkbar, wenn die wirtschaftliche Existenzgefährdung von Unternehmen, etwa durch Beschlagnahme der EDV, mit der Totalausforschung von Individuen verglichen und damit die Verletzung eines grundrechtlichen Kernbereichs durch übermäßige Verfahrensbelastung begründet werden könnte. De lege ferenda könnte an die Stelle eines einzelnen Ermittlungsrichters ein Kollegialgericht als Kontrollorgan treten.
Bittmann wandte ein, dass man fordern könne, dass Ermittler die Tatsachen punktiert für den Richter zusammenfassen. Es sei nicht zu erwarten, dass der Richter in die Asservate gehe. Eine solche Zusammenfassung erfülle nach Eschelbach aber nicht die Kontrollfunktion und die klaren Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts.
VRiBGH Prof. Dr. Thomas Fischer referierte zur Dogmatik des § 339 StGB und zu strukturellen Problemen seiner Anwendung. Er widmete sich zunächst den Waldheimer Prozessen im Lichte der Rechtsbeugung und problematisierte im Anschluss die Tatbestandsmerkmale des § 339 StGB. Das Schutzgut sei nicht die Unabhängigkeit des Richters oder die Belastung der Justiz, sondern die Gleichmäßigkeit der Rechtsanwendung und der Willkürschutz. Die Feststellung des BGH, dass vorsätzliche Willkür nicht ausreiche, habe zur Nichtanwendung des § 339 StGB geführt. Die Perspektive der Justiz lasse demnach eine Anwendung der Rechtsbeugung nur auf Richter zu, die mitunter pathologisch völlig außerhalb des Rechts agieren würden. Grundsätzlich wolle der gewöhnliche Rechtsbeuger jedoch eigentlich für Gerechtigkeit sorgen, da das Bewusstsein fehle, formale Regeln zu verletzen.
Bedingt vorsätzlich handele der Täter, wenn er positive Kenntnis über die elementare Bedeutung der Rechtsnorm für das Entscheidungsprogramm habe. Demnach sei die falsche Auslegung materieller Tatbestände sowie die fehlerhafte Anwendung von Normen, die wesentliche Verfahrensrechte im Sinne der absoluten Revisionsgründe – ausgenommen Nr. 7 – sichern, von § 339 StGB umfasst. Dies gelte auch, so Fischer, bei unvertretbaren Ermessensentscheidungen, da dann die Grenze elementaren Rechtsbruchs erreicht sei. Auch eine Verletzung der formellen Voraussetzungen des § 257c StPO sei erfasst. Bei kollegialen Entscheidungen seien beisitzende Richter dazu verpflichtet rechtsbeugende Entscheidungen anzuzeigen. Denkbar wären auch Teilnahmekonstellationen im Sinne der Anstiftung für den Verteidiger oder der Beihilfe durch die Staatsanwaltschaft.
Auf die Nachfrage Rolf Köllners, wer eine Verletzung des § 339 StGB verfolgen würde, bescheinigte Fischer der deutschen Richterschaft ein gestiegenes Bewusstsein für die Problemlage und prognostizierte einige Präzedenzfälle, die diese Entwicklung zukünftig unterstützen würden.
IV. Der Versuch eines Fazits
Wie steht es nun um das Verhältnis von Compliance und Justiz? Compliance ist originär im Unternehmenszusammenhang bekannt und auch dort etabliert. Rechtstreue ähnelt aber auch der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Dabei geht es um formelle Verfahren, aber auch um absolute Grenzen. Compliance und Justiz liegen daher nicht so weit voneinander entfernt, wie dies auf den ersten Blick anmutet. Einfacher wird es aber dadurch nicht.
Die Tagung hat eine Fülle von Problemen hervorgebracht, die für sich genommen eine Tagung wert sind. Im Folgenden sollen aber drei Aspekte gesondert gewürdigt werden.
Erstens, das „Überdruckventil“ § 153a StPO. Die wahrnehmbare Belastung der Justiz bei Wirtschaftsstrafsachen wird durch entsprechende prozessuale Mechanismen zwar faktisch entschärft. Deren gegenwärtige Anwendung, allen voran die des § 153a StPO, polarisiert aber Wissenschaft und Praxis. Während die Wissenschaft die Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien beklagt, lechzt die Justiz wegen langwieriger Verfahren nach Entlastung, wobei die Verteidigung um den Verlust einer aussichtsreichen Verhandlungsstrategie bangt. Die jeweiligen Parteien stöbern dabei nach bereits vielfach erwähnten, aber nach wie vor beständigen Gründen für und gegen die Anwendung des § 153a StPO, die aufgrund der doch schon langen Debatte bereits abgehandelt erschienen. Aber weit gefehlt. Medienwirksame Strafverfahren verhelfen dem Wortgefecht zu ungebremster Brisanz und rufen bereits verstaubte Kritik auf die Tagesordnung zurück. Ist § 153a StPO ein notwendiges Instrument um die Justiz vor dem Kollaps zu retten? Sind Millionenzahlungen noch vom Grundgedanken des § 153a StPO gedeckt oder ist die Anwendung bei komplexen Wirtschaftsstrafsachen eher eine rechtswidrige Ausdehnung und ein fauler Kompromiss, geprägt durch wechselseitige Opportunitätserwägungen, die dem Selbstverständnis eines rechtsstaatlichen Strafrechts zuwider laufen? Compliance in der Justiz kann mehr Transparenz meinen. Transparenz, die Dokumentation- und Begründungspflichten erfordert, um mehr Kontrolle zu ermöglichen, und § 153a StPO nicht zur freien Wildbahn verkommen lässt. Es bleibt dann aber die Frage, wie viel Formalisierung mit der Ökonomisierung des Rechts vereinbar ist.
Zweitens, mögliche Ermittlungshilfspersonen. Die vorsichtig angedachte Kooperation von unternehmensinternen Ermittlungen und Ermittlungsverfahren zur Bewältigung der Komplexität in Wirtschaftsstrafverfahren – als ein viertes Aufklärungsparadigma – erwägt dagegen eine Nutzung der Compliance durch die Justiz und wirft wesentliche Grundfragen zur Anwendung von strafprozessualen Beschuldigtenrechten im Lichte arbeitsrechtlicher Zuständigkeiten auf. Ungeachtet des Legalitäts- und Offizialprinzips muss dann bei einer direkten Beteiligung der Strafverfolgungsbehörden die unmittelbare Anwendung der StPO folgen, um die Grundprinzipien des Strafprozesses nicht auszuhöhlen.
Drittens, die Sanktionierung der Justiz. Neben der schwierigen Diskussion, ob justizinterne Kontrollmechanismen erweitert und entsprechende Dokumentationspflichten – gerade im Ermittlungsverfahren – greifen sollten, hält das positive Recht mit § 339 StGB bereits eine repressive, vielleicht auch präventive Compliance-Lösung bereit. Bleiben die einzelnen Tatbestandsmerkmale auch umstritten, so ermöglichen sie es doch ‚non-compliant‘-Verhalten in der Justiz zu sanktionieren. Bei dem doch so oft beobachteten freudigen Schulterschluss der Protagonisten bleibt allerdings die bekannte Frage nach der Kontrolle der Kontrolleure.
Bestandsaufnahme, Fehlerquellen und Reformansätze
Ein Tagungsbericht zur WisteV-wistra-Neujahrstagung 2015
Die sechste Neujahrstagung der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung (WisteV) und der Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) fand am 16. und 17.01.2015 zum diesjährigen Thema „Compliance in der Justiz“ im Westin Grand in Frankfurt am Main statt.Nahezu 200 Experten – darunter Strafverteidiger, Staatsanwälte, Richter und Wissenschaftler – folgten der Einladung zu bereichernden Vorträgen und spannenden Diskussionen.
Die Überschrift suggeriert, dass Compliance und Justiz getrennte Dinge seien. Streng genommen stimmt das, sofern Compliance als Instrument von und für Unternehmen begriffen wird. Versteht man Compliance allerdings als generelle Rechtstreue, dann enthält der Begriff, wie Prof. Dr. Franz Salditt deutlich machte, eigentlich nichts Neues, vielmehr müsse sich die Justiz immer rechtstreu verhalten. Dies könne allerdings nur dann funktionieren, wenn die Revisionsgerichte die Verletzung von Kontrollfunktionen, also Compliance-Verstöße, überprüfen würden. Besondere Herausforderungen seien nach Dr. Thomas Nuzinger, Mitglied des Tagungsausschusses der WisteV, die gegenwärtige Medienberichterstattung sowie ein gewisser Unmut über vermeintlich tief liegende Fehler im Strafverfahren.
I. Bestandsaufnahme: Praktische Probleme und Probleme der Praxis deutscher Wirtschaftsstrafverfahren
Gegenstand des ersten Themenblocks war die Frage nach einer etwaigen Überforderung und/oder Überlastung der deutschen Strafjustiz in Wirtschaftsstrafsachen sowie eine mögliche Missachtung der gesetzlichen Vorgaben.
Prof. Dr. Hendrik Schneider diagnostizierte eine Krankheit des „Patienten“ Justiz, wenngleich kein Infarkt drohe. Belegt werde dies durch die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik sowie der Richterstatistik des Bundesamtes für Justiz. Die Anzahl der Tatverdächtigen sei demnach rückläufig und die Anzahl der Richter sowie der Staatsanwälte konstant, was keinen Rückschluss auf eine Überbelastung zulasse. Aus der durchschnittlich hohen Verfahrensdauer im Rahmen der Wirtschaftsdelikte folge allerdings das Erfordernis von prozessualen „Überdruckventilen“, wie etwa § 153a StPO. Diese Ventile könnten allerdings ihren Zweck verfehlen, sofern sie durch den Misskredit der Öffentlichkeit oder durch Formalisierungsanforderungen verstopft würden.
Diskussionsleiter OStA Raymung Weyand bemängelte die eingeschränkte Aussagefähigkeit der Statistiken, da die große Zahl der Teilzeitstellen nicht berücksichtigt worden sei. Schneider stimmte zu, dass diese im Rahmen einer detaillierteren – noch ausstehenden – Untersuchung, die zur Überprüfung seiner Thesen erforderlich sei, berücksichtigt werden müsste.
RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn bezweifelte, ob die Dauer der Erledigung einen Rückschluss auf die Komplexität zulasse. Berichts- und Dokumentationspflichten seien in diesem Zusammenhang immer erforderlich und daher von der Komplexität unabhängig. LOStA Dr. Ewald Brandt fügte hinsichtlich der Statistiken hinzu, dass der Vakanzenstand in Hamburg 10 bis 15 % betrage und die absolute Zahl der Stellen nicht repräsentativ sei um die Praxis vollständig widerzuspiegeln. Dr. Matthias Korte thematisierte, ob das materielle Recht zur Überlastung führen würde und fragte, inwiefern die Diskussion durch neue Tatbestände tangiert werde. Schneider wies darauf hin, dass § 299 StGB vormals im UWG normiert war und durch die Einführung in das Kernstrafrecht auch dementsprechend angewendet werde. Zudem prognostizierte Schneider eine Ausdehnung durch einen künftigen § 299a StGB. Eine Nichtanwendung sei in der Praxis nicht vorstellbar.
Brandt stellte in seinem Referat eingangs den Unterschied zwischen einer Überlastung und einer Überforderung fest. Die deutsche Strafjustiz habe mehrfach gezeigt, dass sie hochkomplizierte Wirtschaftssachen bewältigen könne. Insofern liege keine Überforderung vor. Gleichwohl entstehe vielfach der Anschein der Überforderung, vermehrt im Rahmen von Vermögensdelikten, da die oft auftretenden neuen Begehungsweisen eine besondere Herausforderung darstellten. Es sei jedoch unbestritten, dass die Strafjustiz hoch belastet und in großen Teilen auch überlastet sei. Die Belastung sei darauf zurückzuführen, dass sich Inhalte, durch vermehrt internationale Bezüge sowie technische Kenntnisse, geändert hätten und Dokumentations- und Benachrichtigungspflichten ohne Personalausgleich ausgeweitet werden würden. Gerade das Wirtschaftsstrafverfahren sei durch die Bindung von ohnehin schon knappen Personalressourcen hoch belastet, was zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit – als Konsequenz von Überlastung – führe. Dies wirke sich auch auf die Anzahl der Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO aus, dem ein hohes Dunkelfeld, bedingt durch den notgedrungen geringen Ermittlungsaufwand, bescheinigt werden könne. Negative Auswirkungen für den Rechtsstaat seien, so Brandt, die Aushöhlung des Legalitätsprinzips, die mangelnde Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sowie der verheerende Gewöhnungseffekt, Straftaten und deren Sanktionierung in bestimmten Deliktsbereichen zur Verhandlungssache zu deklarieren. Lösungsansätze seien die Ausgrenzung von nachrangigen Delikten im Wege der Einbeziehung von Vermögensstraftaten in den Katalog der Privatklagedelikte, die Konkretisierung von Straftatbeständen sowie eine Straffung des Prozessrechts, etwa durch die Erleichterung bei der Zurückweisung von Befangenheitsanträgen oder die Möglichkeit der Ablehnung von Anträgen, sofern diese nur der Verfahrensverzögerung dienen.
RiLG Dr. Andreas Sturm präsentierte anschließend einen umfassenden Einblick in die empirische Erhebung der „Altenhain-Studie“, die zur Grundlage der Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts im Verständigungsurteil vom 19.03.2013 wurde. Gründe für Absprachen in Strafverfahren, jenseits der Empirie, seien externe Ursachen, wie die stetige Ausweitung des materiellen Strafrechts, zunehmend komplexere Lebenssachverhalte sowie begrenzte Ressourcen der Justiz. Auch die StPO könne gerade im Hinblick auf die überbordende Anzahl von Anträgen im Rahmen der Konfliktverteidigung nicht schritthalten. Ergänzend sei Richtern keine ausreichende Auslegung bzw. Kommentierung zu § 257c StPO zugänglich, weshalb einzelne Merkmale unklar blieben. Gegen eine Besserung dieses Zustands spreche die Empirie an sich, da seit der Erhebung Altenhains aus dem Jahre 2007 keine wesentliche Änderung bewirkt worden sei. Zudem fehle es an einer dem Rechtsanwender gewinnbringenden juristischen Auseinandersetzung, die nicht die Bindungswirkung des Bundesverfassungsgerichtsurteils, sondern die Umsetzung in der Praxis debattiere. Für eine Besserung spreche, dass vermehrt Rechtsmittel eingelegt werden würden und das Bewusstsein in der Justiz steige. Bei weiterer Nonkonformität bestehe allerdings die Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht die Verständigung untersagen könnte.
In der anschließenden Diskussion über die zwei vorangegangenen Referate drückte Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann seine Erschütterung hinsichtlich des Abspracheverhaltens aus, das für die Wissenschaft inakzeptabel sei. Der Deal sei der Einzug der kontinuierlichen Missachtung von Verfahrensvorschriften in das Strafrecht gewesen. Dr. Eren Basar merkte an, dass die Überlastung der Staatsanwaltschaften für die Verteidigung Fluch und Segen aber zugleich ein Teil der Verteidigungsstrategie seien. Dr. Oliver Kipper forderte, dass sich die Justiz Standards setzen müsse. Wenn die Staatsanwaltschaften den Mangel in einem Unternehmen genauso sähen wie die Verteidiger Mängel bei der Justiz feststellen würden, dann wäre ein Compliance-Verstoß evident.
Unter der Moderation von Prof. Dr. Joachim Jahn diskutierten Dr. Sven Thomas und Prof. Dr. Thomas Rönnau über die Anwendung des § 153a StPO im Wirtschaftsstrafverfahren.
Thomas relativierte die zunächst behaupteten tatsächlichen sowie rechtlichen Schwierigkeiten, da der Richter das Recht kenne und daher keine schwierige Rechtslage bestehe. Vielmehr führe die Anwendung von § 153a StPO vor dem Hintergrund von Ressourcen und Ergebnissen zu Effizienz und erfülle zudem eine Korrektivfunktion gegenüber dem materiellen Recht. Thomas hob auch bestehende Zweifel der Strafkammern im Hinblick auf eine Verurteilung sowie eines Freispruchs hervor, da beides dem Betroffenen im Einzelfall nicht gerecht werden könnte. Die Bereitschaft des Beschuldigten zur Anwendung des § 153a StPO sei ebenfalls durch Opportunitätserwägungen geprägt. Unter Hinzuziehung des ökonomischen Konzepts der Opportunitätskosten, die dem Verzicht auf ein konkretes Geschäft entsprechen, beschrieb Thomas die Kosten für den Betroffenen im Strafverfahren in Form von Arbeitskosten, Verlust der Lebensqualität und der Risikofreiheit außerhalb des Gerichts, also der persönlichen Perspektive.
Rönnau äußerte erhebliche Bedenken hinsichtlich der gegenwärtigen Anwendung des § 153a StPO. Die Allgemeinheit sei als ein wesentlicher Beteiligter des Verfahrens von dem Schulterschluss der Verfahrensbeteiligten ausgeschlossen. Daneben würden wirtschaftliche Erwägungen bei Unternehmen die Anwendung des § 153a StPO fördern. Ein Kernproblem bliebe die Gleichbehandlung im Hinblick auf mehrere Verfahren. Es stehe zudem die Frage im Raum, wie Recht noch zu steuern sei, wenn bei schwierigen Verfahren regelmäßig die Einstellung folge.
Nach Joachim Jahns Anmerkung, dass es für die Verständigung im Gegensatz zu § 153a StPO Regeln gebe, verwies Thomas auf die Anwendung des § 153a StPO im Rahmen des nicht-öffentlichen Ermittlungsverfahrens. Es sei unklar, welche Regularien gefunden werden könnten um das Verfahren transparenter zu gestalten. Davon abgesehen beziehe sich die Verständigung im Gegensatz zu § 153a StPO im Ergebnis auf den Schuldspruch.
Nach Rönnau müssten im Lichte der Transparenz Begründungspflichten verankert werden, da bei hohen Einstellungszahlungen ein erhebliches Interesse an den Begründungen bestehe. Die durch den Gesetzgeber vorgenommene „behutsame Ausdehnung“ sei nicht eingehalten worden und auch die gegenwärtige Anwendung auf Fälle mit mittlerer Schuld sei fraglich, da eine vermehrte Anwendung des § 153a StPO auf umfangreiche Fälle des Wirtschaftsstrafrechts zu beobachten sei. Insgesamt erzeuge § 153a StPO daher keinen Rechtsfrieden für die Allgemeinheit, da diese nicht bei der informellen Erledigung mitwirken könne. Die Beteiligung der Öffentlichkeit sei aber eine Grundprämisse des Strafrechts.
In der anschließenden Diskussion kommentierte Prof. Dr. Björn Gercke, dass auch die Wissenschaft die Entscheidung der Beteiligten akzeptieren müsse, auf eine Einstellung hinzuwirken. Darüber hinaus könne ein formelles Korsett der Sache nicht gerecht werden, da § 153a StPO in speziellen Situationen angewendet werden würde. Rönnau entgegnete, dass genau deshalb die Rechtssicherheit und Rechtskultur erheblich leide. Dr. Hanno Durth kritisierte, dass eine Verrechtlichung des § 153a StPO die Ökonomisierung des Rechts rückgängig machen würde und nicht der Gleichbehandlung diene. Auch die Ressourcenprobleme der Justiz könnten nur durch die gegenwärtige Anwendung des § 153a StPO gemildert werden. Matthias Jahn gab zu bedenken, dass es einen Dritten in diesem Zusammenhang nicht gebe und auch nicht geben solle. In der rechtspolitischen Diskussion um die Verständigung in Strafsachen sei ein Vetorecht des Nebenklägers diskutiert, allerdings mit der Begründung versagt worden, das Opfer lasse sich dieses nur unter besonderen, häufig unzumutbaren Gegenleistungen abhandeln. BVerfGE 133, 168 habe festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft die öffentlichen Belange im Bereich des § 153a StPO und der Verständigung zur Geltung bringen solle. Es bedürfe keiner Korrektur, allerdings sei ein Kriterienkatalog auf Ebene der RistBV denkbar. Nach StA Folker Bittmann seien überbordende Vorschriften eher abzubauen als aufzustocken. Demnach sei eine Verbürokratisierung des § 153a StPO nicht sachdienlich und der falsche Weg.
Gegen die Einführung eines Kriterienkatalogs spreche nach Thomas, dass auch andere Kataloge, etwa im Bereich der Strafzumessung, unbeachtet blieben. Die Rechtsunsicherheit sei zudem ein grundsätzliches Problem und auch z.B. nach den Entscheidungen des BGH zu § 266 StGB präsent. Rönnau unterstellte den Verteidigern ein grundsätzliches Interesse an Rechtssicherheit, das durch die gegenwärtige Anwendung des § 153a StPO leide. Außerdem hätten die Staatsanwaltschaften finanzielle Interessen und nicht die Allgemeinheit im Blick. Eine Kontrolle sei bei diesen Verfahren schon aus rechtsstaatlichen Gründen erforderlich.
II. Fehlerquellen im deutschen Wirtschaftsstrafprozess
Der zweite Themenblock widmete sich der Frage, was die Gründe für die im ersten Themenblock erörterten Fragen und Probleme sein könnten.
Das Referat „Lässt die Rechtswissenschaft die Justiz alleine?“ von Prof. Dr. Jens Bülte widmete sich den Forderungen der Praxis nach verständlicheren und konstruktiveren Publikationen, sowie einer redlichen, gewissenhaften und unvoreingenommenen Wissenschaft.
Jeder universitäre Rechtswissenschaftler habe zwar das Recht, seine Kunst im Elfenbeinturm zu betreiben, allerdings dürfe er sich dann nicht wundern, wenn sich außerhalb der Wissenschaft niemand für seine Konstrukte interessiere. Die gemeinsamen Ziele von Wissenschaft und Praxis seien die Fortentwicklung und Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen, effektiven und vor allem am Grundrechtsschutz und dem Verfassungsrecht ausgerichteten Strafrechts bzw. einer solchen Strafrechtspflege. Die Wissenschaft habe daher, so Bülte, eine gewisse Pflicht gegenüber der Justiz, da durch Annahme und Beurteilung einer aktuellen Rechtsproblematik, Verantwortung kraft tatsächlicher Übernahme begründet werde. Im eigenen Interesse müsse sie verständlich sein, um den Anspruch der Wahrnehmung zu erheben.
Destruktive Kritik an der Rechtsprechung sei damit zu begründen, dass Wissenschaft, im Gegensatz zur Justiz, nicht lösungsorientiert arbeiten müsse. Gerade bei öffentlichkeitswirksamen Verfahren, sei die Justiz jedoch gefangen zwischen Einzelgerechtigkeit im Fokus von Medien und Politik einerseits und Systemgerechtigkeit, gefordert von der Wissenschaft, andererseits. Dies führe völlig zu Recht zu dem Ruf nach konstruktiver Kritik und dem Beistand der Wissenschaft.
Grundsatz zur Annäherung an die Wahrheit und der vernünftigen Diskussion sei nicht das Wissen des Einzelnen sondern eine Abwägung des Verfügbaren. Darüber hinaus dürfe nur unabhängige Wissenschaft auch Wissenschaftsfreiheit beanspruchen. Abhängigkeit führe dagegen zum Verlust ihrer Existenzberechtigung und ihrem Wesenskern.
In der Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Praxis dürften verfassungsrechtliche Gründe, wie etwa das Verschleifungsverbot – gerade in der wirtschaftsstrafrechtlichen Diskussion –, nicht zum Vehikel einer strafrechtsdogmatischen Diskussion gemacht werden. Jeder Fehlgebrauch des Verfassungswidrigkeitsarguments schwäche den Grundrechtsschutz und erweise dem Kampf um das Recht einen Bärendienst.
Auf die Frage des Diskussionsleiters RA Alexander Sättele, ob die Wissenschaft Möglichkeiten der konstruktiven Teilnahme verschenke, wies Bülte auf die in Österreich vorgesehene Kommunikation bei Gesetzesvorhaben zwischen Gesetzgeber und Fakultäten hin. Korte wandte ein, dass dies auch in Deutschland institutionalisiert sei und auf Vorschläge der Strafrechtslehrer gewartet werde. Bei neuer Gesetzgebung werde in den Kommentierungen jedoch nur auf die Verfassungswidrigkeit Bezug genommen, insofern lasse vielmehr die Literatur die Praktiker alleine. Nach Schünemann seien die Strafrechtslehrer- und lehrerinnen mit ca. 200 Personen ein vielstimmiger Chor und organisatorisch unstrukturiert. Eine Lösung könnten Anfragen an die öffentliche Behörde der Universtäten sein, die zur Stellungnahme verpflichtet wären. Die sog. Hearings im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren seien aber lediglich Alibi-Veranstaltungen, da die Professoren nach den Lagern der Fraktionen ausgesucht würden. Die Wissenschaft befände sich daher in einem Zustand der Marginalisierung.
Es folgte das Referat von Schünemann zu dem Thema „Überfordert die Komplexität der Wirklichkeit die Juristen?“.
Ein prinzipielles Problem für die Anwendung des Strafrechts auf individuelles menschliches Handeln im Rahmen von Wirtschaftsunternehmen existiere in Wahrheit nicht, da das Strafrecht mit seiner Suche nach individueller Verantwortlichkeit auch den kollektiven Interaktionsmustern gerecht werden könne. Die These vom Wirtschaftsunternehmen als ein strafrechtlich nicht direkt beeinflussbares autopoetisches System hätte mit der Realität des Lebens wenig zu tun. Vielmehr würden die dogmatischen Grundsätze der objektiven Zurechnung und das Schuldprinzip dazu führen, dass Individuen nicht etwa in fehlerhafter Weise für von ihnen nicht kontrollierte systemische Prozesse verantwortlich gemacht werden könnten.
Durch die international einmalige Machtstellung des deutschen Strafrichters trete eine besondere Be- und Überlastung auf, deren Effekte sich durchweg in einer asymmetrisch-einseitigen Weise zuungunsten des Angeklagten auswirken würden. Dieser Inertia– oder Urteilsperseveranz-Effekt beruhe darauf, dass dem Richter aufgrund der durch die Ermittlungsbehörden zusammengestellten einseitigen Ermittlungsakten eine unbefangene Würdigung des Beweisergebnisses der Hauptverhandlung unmöglich sei. Dies verstärke sich auch durch den Schulterschluss-Effekt zwischen Richter und Staatsanwalt. Der sog. Kothurn-Effekt, der noch nicht durch sozialwissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen worden sei, bestätige sich durch Alltagsbeobachtungen im Strafprozess. Anders als in Zivilprozessen operiere der Richter im Strafverfahren von Anfang an gegenüber einem durch die Anklage moralisch deklassierten Angeklagten, dessen krampfhafte Versuche sich herauszuwinden, seine moralische Minderwertigkeit eher noch bestätigen und dadurch den Richter auffordern würde, den Ausflüchten nicht voreilig auf den Leim zu gehen, sondern alle logisch haltbaren Möglichkeiten der Verurteilung auszuschöpfen. Zusammengefasst sei der Eröffnungsbeschluss im deutschen Strafprozess eine self-fulfilling prophecy, was durch eine seit langem unter 4 % liegende Freispruchquote statistisch bestätigt werde.
Durch die enorme, häufig abnorme Komplexität der Wirtschaftsstrafverfahren dränge sich zunächst der Verdacht auf, dass eine Kompensation der Objektivität der richterlichen Tatsachenfeststellung zerstörenden Effekte hier noch viel schwieriger zu sein scheine als im allgemeinen Strafverfahren. Dieser Verdacht entschärfe sich aber vor dem Hintergrund der Dominanz des Urkundenbeweises im Wirtschaftsstrafverfahren, im Gegensatz zu der informationsdeformierenden Kraft der Glaubwürdigkeitsbeurteilung von Zeugen und der Interpretation ihrer Aussagen.
Die vor rund 200 Jahren geschaffene Struktur des Strafverfahrens lasse eine Rekonstruktion der Komplexität des heutigen Wirtschaftslebens nicht zu. Vielmehr sei das Modell einer alleinigen Urteilsfindung durch die Hauptverhandlung zur Aufarbeitung der überkomplexen Wirtschaftskriminalität nicht mehr geeignet. Zudem würden die durch das Verständigungsgesetz legalisierten Urteilsabsprachen keinen in rechtsstaatlicher Weise auf die Ermittlung der materiellen Wahrheit ausgerichteten Strafprozess mehr übrig lassen.
Ein denkbarer Ansatz zur Bewältigung des Komplexitätsproblems in Wirtschaftsstrafsachen liege, so Schünemann, in einem Einbau unternehmensinterner Ermittlungen in das Ermittlungsverfahren, was aber vom Staat naturgemäß nur verlangt werden könne, wenn er das Unternehmen von jeder strafrechtlichen oder strafrechtsähnlichen Verantwortlichkeit befreie. Die Einführung eines Unternehmensstrafrechts sei dagegen kontraproduktiv. Das neue 4. Aufklärungsparadigma – nach dem 1. Paradigma des Gottesurteils, dem 2. Paradigma des Inquisitionsverfahrens und dem 3. Paradigma des hauptverhandlungszentrierten reformierten Strafverfahrens –, bestehe in der Mitwirkung des Unternehmens als Ermittlungshilfsperson der Staatsanwaltschaft.
Salditt wandte ein, dass beschuldigte Vorstände das Unternehmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nicht vertreten würden, weshalb Unternehmen auch keine Hilfspersonen sein könnten. OStA Dr. Peter Schneiderhahn hob mögliche Gefahren einer Verschmelzung von Ermittlungsverfahren und Internal Investigations hinsichtlich eines weiteren Ressourcenabbaus, der Verletzung des Legalitätsprinzips, der Erstbefassung der Arbeitsgerichte und der Marginalisierung der Beschuldigtenrechte hervor. Dr. Thomas Helck kritisierte die unzureichende Ausbildung der Staatsanwälte und Richter. Gerade Berufsanfänger litten an Überlastung. Auch bleibe im Zusammenhang von Ermittlungsverfahren und Internal Investigations die Frage der Kostentragung.
Der anschließende Vortrag von Schneiderhan widmete sich möglichen strukturellen Fehlerquellen. Schneiderhan bescheinigte der deutschen Justiz ein hohes Maß an Professionalität und eine im internationalen Vergleich hervorzuhebende Korruptionsfreiheit. Es lägen keine strukturellen Fehlerquellen und daher auch kein grundlegender Änderungsbedarf vor. Jedoch seien drei Fehlerquellen im materiellen Recht auszumachen, die nicht richtig ausgeführt würden. Der Gesetzgeber lasse die Justiz bei der Anwendung einiger Normen des materiellen Rechts alleine oder erlasse unklare Gesetze. Der Gleichlauf der Rechtsordnung sei zudem nicht gesichert, da das Strafrecht auf zivil-, wirtschaftliche- und steuerrechtliche Grundentscheidungen zurückgreifen müsse. Auch sei der starke Einfluss des Unionsrechts auf das deutsche Strafrecht – etwa im Arzneimittelgesetz – eine Problemursache.
Eine Fehlerquelle des Strafprozessrechts sei die gesetzlich gewollte unvollständige Beweiserhebung durch § 160a StPO, die fehlende Vorratsdatenspeicherung sowie eine unsichere Beweiserhebung durch veraltete Regelungen zur Sicherung von elektronischen Daten. Dem Strafverfahren fehle es darüber hinaus an einer Konzentrationsmöglichkeit auf die wesentlichen Fragen des Prozesses zum Zweck der Verfahrensvereinfachung. Im Hinblick auf die bisherigen Vorträge wurde bei den Fehlerquellen in der Justizverwaltung betont, dass Staatsanwälte im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts schlichtweg keine Zeit für Fortbildungsmaßnahmen hätten.
In der anschließenden Diskussion bemerkte Dr. Tobias Rudolph, dass das strukturelle Problem ein „Wir-Denken“ der Richter und Staatsanwälte sei. Zudem ließen oftmals sachfremde Erwägungen im Rahmen der §§ 257c, 153a StPO den Verdacht der Korruption zu, da der Begriff sehr weit reiche. Es sollten daher Mechanismen geschaffen werden, die eine partielle Kontrolle zulassen könnten.
III. Reformansätze
Im dritten Themenblock wurden mögliche Reformansätze vorgetragen und diskutiert.
RA PD Dr. Gerson Trüg referierte zunächst zu dem Thema „Alternativen zum (auf Individuen gemünzten) Strafrecht: Verwaltungssanktionen, Bußgelder, Unternehmensstrafrecht?“. Der Mehrwert eines Unternehmensstrafrechts sei kritisch zu beurteilen. Selbst wenn das Individualstrafrecht formal entlastet werden würde, führe dies nicht zu einer Rückbesinnung auf die ultima ratio Funktion und gewährleiste keine einschränkende Anwendung des Strafrechts. Vielmehr würde strafrechtliche Sanktionierung auf beiden Ebenen umgesetzt werden. Auch der Strafzweck sei vor dem Hintergrund der ungeklärten Präventionswirkung problematisch. Strafen könnten auch Stakeholder und damit Unschuldige treffen. Ein Unternehmensstrafrecht laufe darüber hinaus dem sozialethischen Verständnis von Schuld, unter Bezugnahme der Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, zuwider. Es bliebe die Frage nach schuldunabhängigen Kriterien.
Bülte und Trüg diskutierten im Anschluss über die divergierenden verfassungsrechtlichen Argumente und die unterschiedlichen Interpretationen des Lissabon-Urteils im Hinblick auf den Geltungsbereich des Schuldprinzips. Auch die Betroffenheit der Stakeholder wurde unterschiedlich bewertet.
RiBGH Dr. Ralf Eschelbach referierte zur Stärkung von justizinternen Kontrollmechanismen. Durch die überwiegende Erledigung von Wirtschaftsstrafverfahren im Vorverfahren und die damit verbundene geringe Zahl der Revisionen würden neue Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu Fragen der Beweisgewinnung und Beweisverwertung verhindert. Die Revision leiste daher keinen effektiven Rechtsschutz gegen Eingriffsmaßnahmen. Hauptschauplatz des Strafverfahrens sei das Vorverfahren, das bisher allerdings nicht partizipatorisch ausgestattet und im Hinblick auf die Durchsetzung effektiven Rechtsschutzes defizitär sei. Die das Vorverfahren dominierende Verdachtshypothese sei gegen Einwendungen zunehmend abgeschottet. Mittel der neutralen Kontrolle des Verdachts durch eine Gesamtschau seien vor Anklageerhebung nicht gegeben, da eine gemäß Art. 97 GG neutrale Kontrollinstanz zu diesem Zeitpunkt nicht bestehe. Der Ermittlungsrichter sei an einer Verzögerung des Verfahrens nicht interessiert, was regelmäßig zur Stattgabe der Eingriffsmaßnahmen – ohne detaillierte Prüfung – führe. Zur Stärkung interner Kontrollmechanismen und des Rechtsschutzes, den der Richtervorbehalt nicht gewähre, müssten den Ermittlungsrichter justizinterne Kontrollmaßnahmen treffen, die insbesondere Informations-, Dokumentations- und Begründungspflichten umfassen und der Kontrolle des Rechtsmittelverfahrens unterliegen könnten.
Effektive Rechtsfolgen bei fehlerhafter Eingriffsgestattung seien, so Eschelbach, bislang nicht vorgesehen oder nicht realisierbar, weil Beweisverwertungsverbote, durch fehlende positivrechtliche Regelung oder Unanwendbarkeit im Vorverfahren, meist nicht anerkannt würden. Auf der Rechtsfolgenebene sei daher die Aktivierung und gesetzliche Strukturierung des Systems der Beweisverwertungsverbote zu fordern, die zur faktischen Disziplinierung führen und durch eine absolute Wirkung, auch im Vorverfahren, Anwendung finden könnten. Dies sei etwa denkbar, wenn die wirtschaftliche Existenzgefährdung von Unternehmen, etwa durch Beschlagnahme der EDV, mit der Totalausforschung von Individuen verglichen und damit die Verletzung eines grundrechtlichen Kernbereichs durch übermäßige Verfahrensbelastung begründet werden könnte. De lege ferenda könnte an die Stelle eines einzelnen Ermittlungsrichters ein Kollegialgericht als Kontrollorgan treten.
Bittmann wandte ein, dass man fordern könne, dass Ermittler die Tatsachen punktiert für den Richter zusammenfassen. Es sei nicht zu erwarten, dass der Richter in die Asservate gehe. Eine solche Zusammenfassung erfülle nach Eschelbach aber nicht die Kontrollfunktion und die klaren Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts.
VRiBGH Prof. Dr. Thomas Fischer referierte zur Dogmatik des § 339 StGB und zu strukturellen Problemen seiner Anwendung. Er widmete sich zunächst den Waldheimer Prozessen im Lichte der Rechtsbeugung und problematisierte im Anschluss die Tatbestandsmerkmale des § 339 StGB. Das Schutzgut sei nicht die Unabhängigkeit des Richters oder die Belastung der Justiz, sondern die Gleichmäßigkeit der Rechtsanwendung und der Willkürschutz. Die Feststellung des BGH, dass vorsätzliche Willkür nicht ausreiche, habe zur Nichtanwendung des § 339 StGB geführt. Die Perspektive der Justiz lasse demnach eine Anwendung der Rechtsbeugung nur auf Richter zu, die mitunter pathologisch völlig außerhalb des Rechts agieren würden. Grundsätzlich wolle der gewöhnliche Rechtsbeuger jedoch eigentlich für Gerechtigkeit sorgen, da das Bewusstsein fehle, formale Regeln zu verletzen.
Bedingt vorsätzlich handele der Täter, wenn er positive Kenntnis über die elementare Bedeutung der Rechtsnorm für das Entscheidungsprogramm habe. Demnach sei die falsche Auslegung materieller Tatbestände sowie die fehlerhafte Anwendung von Normen, die wesentliche Verfahrensrechte im Sinne der absoluten Revisionsgründe – ausgenommen Nr. 7 – sichern, von § 339 StGB umfasst. Dies gelte auch, so Fischer, bei unvertretbaren Ermessensentscheidungen, da dann die Grenze elementaren Rechtsbruchs erreicht sei. Auch eine Verletzung der formellen Voraussetzungen des § 257c StPO sei erfasst. Bei kollegialen Entscheidungen seien beisitzende Richter dazu verpflichtet rechtsbeugende Entscheidungen anzuzeigen. Denkbar wären auch Teilnahmekonstellationen im Sinne der Anstiftung für den Verteidiger oder der Beihilfe durch die Staatsanwaltschaft.
Auf die Nachfrage Rolf Köllners, wer eine Verletzung des § 339 StGB verfolgen würde, bescheinigte Fischer der deutschen Richterschaft ein gestiegenes Bewusstsein für die Problemlage und prognostizierte einige Präzedenzfälle, die diese Entwicklung zukünftig unterstützen würden.
IV. Der Versuch eines Fazits
Wie steht es nun um das Verhältnis von Compliance und Justiz? Compliance ist originär im Unternehmenszusammenhang bekannt und auch dort etabliert. Rechtstreue ähnelt aber auch der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Dabei geht es um formelle Verfahren, aber auch um absolute Grenzen. Compliance und Justiz liegen daher nicht so weit voneinander entfernt, wie dies auf den ersten Blick anmutet. Einfacher wird es aber dadurch nicht.
Die Tagung hat eine Fülle von Problemen hervorgebracht, die für sich genommen eine Tagung wert sind. Im Folgenden sollen aber drei Aspekte gesondert gewürdigt werden.
Erstens, das „Überdruckventil“ § 153a StPO. Die wahrnehmbare Belastung der Justiz bei Wirtschaftsstrafsachen wird durch entsprechende prozessuale Mechanismen zwar faktisch entschärft. Deren gegenwärtige Anwendung, allen voran die des § 153a StPO, polarisiert aber Wissenschaft und Praxis. Während die Wissenschaft die Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien beklagt, lechzt die Justiz wegen langwieriger Verfahren nach Entlastung, wobei die Verteidigung um den Verlust einer aussichtsreichen Verhandlungsstrategie bangt. Die jeweiligen Parteien stöbern dabei nach bereits vielfach erwähnten, aber nach wie vor beständigen Gründen für und gegen die Anwendung des § 153a StPO, die aufgrund der doch schon langen Debatte bereits abgehandelt erschienen. Aber weit gefehlt. Medienwirksame Strafverfahren verhelfen dem Wortgefecht zu ungebremster Brisanz und rufen bereits verstaubte Kritik auf die Tagesordnung zurück. Ist § 153a StPO ein notwendiges Instrument um die Justiz vor dem Kollaps zu retten? Sind Millionenzahlungen noch vom Grundgedanken des § 153a StPO gedeckt oder ist die Anwendung bei komplexen Wirtschaftsstrafsachen eher eine rechtswidrige Ausdehnung und ein fauler Kompromiss, geprägt durch wechselseitige Opportunitätserwägungen, die dem Selbstverständnis eines rechtsstaatlichen Strafrechts zuwider laufen? Compliance in der Justiz kann mehr Transparenz meinen. Transparenz, die Dokumentation- und Begründungspflichten erfordert, um mehr Kontrolle zu ermöglichen, und § 153a StPO nicht zur freien Wildbahn verkommen lässt. Es bleibt dann aber die Frage, wie viel Formalisierung mit der Ökonomisierung des Rechts vereinbar ist.
Zweitens, mögliche Ermittlungshilfspersonen. Die vorsichtig angedachte Kooperation von unternehmensinternen Ermittlungen und Ermittlungsverfahren zur Bewältigung der Komplexität in Wirtschaftsstrafverfahren – als ein viertes Aufklärungsparadigma – erwägt dagegen eine Nutzung der Compliance durch die Justiz und wirft wesentliche Grundfragen zur Anwendung von strafprozessualen Beschuldigtenrechten im Lichte arbeitsrechtlicher Zuständigkeiten auf. Ungeachtet des Legalitäts- und Offizialprinzips muss dann bei einer direkten Beteiligung der Strafverfolgungsbehörden die unmittelbare Anwendung der StPO folgen, um die Grundprinzipien des Strafprozesses nicht auszuhöhlen.
Drittens, die Sanktionierung der Justiz. Neben der schwierigen Diskussion, ob justizinterne Kontrollmechanismen erweitert und entsprechende Dokumentationspflichten – gerade im Ermittlungsverfahren – greifen sollten, hält das positive Recht mit § 339 StGB bereits eine repressive, vielleicht auch präventive Compliance-Lösung bereit. Bleiben die einzelnen Tatbestandsmerkmale auch umstritten, so ermöglichen sie es doch ‚non-compliant‘-Verhalten in der Justiz zu sanktionieren. Bei dem doch so oft beobachteten freudigen Schulterschluss der Protagonisten bleibt allerdings die bekannte Frage nach der Kontrolle der Kontrolleure.