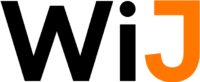Tagungsbericht: „Aktuelle Entwicklungen im Kapitalmarktstraf- und -ordnungswidrigkeitenrecht“ in der Börse Düsseldorf
I. Einleitung
Am 4. Februar 2015 organisierten die Börse Düsseldorf und WisteV e.V. einen Vortrags- und Diskussionsabend, der zwei jüngere Entwicklungen aufgriff, die für Sanktionen im Kapitalmarktrecht eine wichtige Rolle spielen: Im November 2013 hat die BaFin ihre „WpHG-Bußgeldleitlinien“ veröffentlicht; sie gewährt damit Einblick in die Praxis der Sanktionierung von Verstößen gem. § 39 WpHG und ermöglicht eine offene Diskussion. Ebenfalls im November 2013 hat der dritte Strafsenat des BGH (Urteil v. 27.11.2013 – 3 StR 5/13) bestimmt, was das erlangte Etwas gem. § 73 Abs. 1 S. 1 StGB im Falle einer handelsgestützten Marktmanipulation ist. Unter der Moderation durch RA Dr. Philipp Gehrmann hörten die Gäste drei Vorträge von Vertretern aus Wissenschaft und Praxis zu diesen praxisrelevanten Themen.
II. Sebastian Röthig: Die Rolle des Handelsüberwachungsstelle bei der Marktaufsicht
Röthig, Leiter der Handelsüberwachungsstelle der Börse Düsseldorf, stellte seine Arbeit bei Verfolgung von Verstößen gegen das Kapitalmarktrecht vor. Gem. § 7 BörsG muss jede Börse eine Handelsüberwachungsstelle (HÜSt) einrichten. Die HÜSt ist dazu verpflichtet, umfassend alle Daten zu sammeln, die an der Börse anfallen. Sie untersucht diese Daten computergestützt mit Hilfe von Algorithmen nach auffälligen Handelsmustern; zugleich nimmt sie auch manuelle Prüfungen vor. Der HÜSt stehen dabei umfangreiche Rechte zu, auch ohne besonderen Anlass Informationen von Personen einzuholen, die an der Börse registriert sind und Einblick in ihre Daten zu nehmen. Entsteht ein Anfangsverdacht für eine Straftat, so sind auch Ermittlungen gegenüber Dritten möglich. Das betrifft vor allem Banken, die sich gegenüber der HÜSt nicht auf das Bankgeheimnis berufen können.
Der HÜSt obliegt lediglich Ermittlung und Bewertung des Sachverhalts, eine Sanktion darf sie nicht aussprechen. Sie hat den Vorgang dazu ggf. an die zuständige Stelle abzugeben; als solche kommen die Börsengeschäftsführung, die BaFin und damit letztlich die Staatsanwaltschaft in Betracht. Die Mitarbeiter der HÜSt sind nach der Abgabe weiterhin unterstützend tätig, etwa als Sachverständige.
Röthig führte weiter aus, dass die Anforderungen an die HÜSt und auch die Überwachung der Marktteilnehmer durch die stark zunehmende Regulierung des Kapitalmarktes gestiegen sind. Melde- und Dokumentationspflichten wurden ausgeweitet, neue Indikatoren zur Marktpreismanipulation eingeführt. Zudem verschiebt sich der Tätigkeitsschwerpunkt der HÜSt hin zu einer präventiv orientierten Überwachung. Zukünftig soll die HÜSt auffällige Vorgänge bereits bei Verdacht auf einen Gesetzesverstoß an die Aufsichtsbehörde oder Geschäftsführung weiterleiten, wo aktuell nur festgestellte Tatsachen ausreichend sind.
Auf Nachfrage aus dem Publikum erklärte Röthig, dass es sich bei dem Ermittlungsverfahren der HÜSt um ein verwaltungsrechtliches Verfahren handelt und kein strafrechtliches, so dass der Betroffene nicht durch die Beschuldigtenrechte der StPO geschützt ist. Wird er zu einem verdächtigen Vorgang vernommen, so wird seine Aussage protokolliert. Der Betroffene muss dieses Protokoll weder genehmigen, noch erhält er eine Kopie.
III. Prof. Dr. Martin Paul Waßmer: Der Verfall im Kapitalmarktstrafrecht
„Crime doesn‘t pay.“ Mit diesen Worten eröffnete Waßmer, Strafrechtlehrer in Köln, seinen Vortrag zu der höchst umstrittenen Frage, was das erlangte Etwas im Sinne des § 73 Abs. 1 S. 1 StGB ist. Waßmer zeichnete zunächst die Historie der Vorschrift nach: Der Verfall wurde mit der StGB-Reform im Jahre 1975 in das Gesetz eingefügt und bezog sich in seiner alten Fassung auf den „Vermögensvorteil“, der aus oder für die Tat erlangt worden war; daraus leitete sich das Netto-Prinzip ab, das dazu führte, dass sich der Verfall auf den Betrag nach Abzug der Kosten beschränkte. Mit der zunehmenden Bedeutung des Verfalls, gerade auch wegen der erheblichen fiskalischen Interessen aufgrund hoher Vermögenswerte in Wirtschaftsstrafsachen, kam jedoch bei dem Gesetzgeber die Ansicht auf, dass das Nettoprinzip in seiner Anwendung zu kompliziert sei, und er vereinfachte es aus „kriminalpolitischen Gründen“, um „Missverständnissen“ vorzubeugen. So wurde aus dem Vermögensvorteil im Jahre 1992 das Merkmal des „erlangten Etwas“. Damit war dem sog. Brutto-Prinzip der Weg geebnet. Danach kann der Kosteneinsatz des Unternehmens bei der Anordnung des Verfalls unberücksichtigt bleiben. Das Unternehmen muss dadurch z.T. deutlich mehr als den erlangten Vermögensteil abführen.
Waßmer stellte im Folgenden die Anwendungsprobleme des Verfalls im Zusammenhang mit Straftaten nach § 38 WpHG dar, die sich trotz der scheinbar eindeutigen Hinwendung des Gesetzes zum Brutto-Prinzip ergeben. Hier ist mit Blick auf die jüngste Rechtsprechung des BGH vor allem die Frage von Bedeutung, ob das getätigte Geschäft an sich erlaubt ist und nur aufgrund weiterer Umstände strafrechtliche Relevanz hat, oder ob das Geschäft selbst bereits verboten ist. Ein Beispiel für den ersten Fall ist der Insiderhandel gem. § 14 WpHG. Hier soll nach der Rechtsauffassung des 5. Strafsenats des BGH (5 StR 224/09) nur der durch die Insiderinformation gewonnene Sondervorteil dem Verfall unterliegen, weil das Geschäft, der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, an sich erlaubt ist und nur durch den Einsatz der Insiderinformation strafbar wird. Folglich unterwirft der Senat nur den daraus erlangten Sondervorteil dem Verfall. Anders liegt es etwa bei einer handelsgestützten Marktmanipulation gem. § 20a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG: Hier sanktioniert das Gesetz bereits den Handel als solchen, weil der Handel selbst zur Marktmanipulation führt; deshalb unterliegt dort das gesamte Vermögen dem Verfall. Dies hat der BGH in dem eingangs genannten Urteil entschieden.
Im Abschluss nahm Waßmer noch kritisch zur Ansicht der Rechtsprechung Stellung, wonach der Verfall keinen Strafcharakter habe. Dies sei im Hinblick auf die Zweckrichtung und Wirkung unrichtig. Weiter ging Waßmer auf zivilrechtliche Fragestellungen ein: Zu nennen sind Schadensersatzansprüche der Betroffenen, die der Anordnung des Verfalls entgegenstehen können. Hier stellt sich nicht selten die Frage, ob die Vorschriften des Kapitalmarktrechts drittschützende Wirkung im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB haben, was jedenfalls bei § 38 WpHG nicht der Fall ist. In Betracht komme somit allenfalls ein Anspruch aus § 826 BGB. Eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung liegt nach der Rechtsprechung des BGH jedoch nicht schon deshalb vor, weil der Täter in strafbarer Weise gehandelt hat. Hinzukommen müsse eine besondere Verwerflichkeit. Weiter kritisiert Waßmer, dass von dem Adhäsionsverfahren potentiell geschädigter Anleger zu wenig Gebrauch gemacht werde. Die Gerichte lehnten entsprechende Anträge zumeist mit der Begründung ab, das Verfahren sei dafür zu komplex. Das sei indes nicht nachvollziehbar, weil das Fehlen eines zivilrechtlichen Anspruchs Voraussetzung für den Verfall ist. Waßmer spricht sich zudem dafür aus, potentiell Geschädigten regelmäßig Akteinsicht gem. § 406e StPO zu gewähren, wenn sie Schadensersatzansprüche aus § 826 BGB verfolgen wollen. Die wohl h.M. lehne dies jedoch aufgrund der allgemeinen, überindividuellen Schutzrichtung des § 38 WpHG ab.
IV. Rechtsanwalt Dr. Tobias Eggers: Die Bußgeldleitlinien der BaFin
Die BaFin veröffentlichte Ende 2013 ihre Leitlinien zur Bußgeldbemessung im WpHG. Sie folgt damit dem Vorbild des Bundeskartellamtes, das im Jahre 2006 – ebenfalls ohne gesetzliche Grundlage – seine Richtlinien offen gelegt hat. Einleitend wies Eggers auf wichtige Eckpunkte hin: Die Bußgeldrichtlinien sind reines Binnenrecht der BaFin und haben keine gesetzliche Bindungswirkung, vor allem nicht gegenüber Gerichten, die im Streitfall ein eigenständige Entscheidung treffen. Es handelt sich um normkonkretisierende Vorschriften zu § 17 Abs. 3 OWiG. Ihr Ziel ist eine gleichmäßige Rechtsanwendung und die Offenlegung soll zugleich eine Diskussion über ihren Inhalt ermöglichen. Ein Bedarf nach Gleichbehandlung rührt vor allem daher, dass die BaFin, anders als die Staatsanwaltschaft, bei der Verfolgung von Rechtsverstößen nicht an das Legalitätsprinzip gebunden ist und Zweckmäßigkeitsentscheidungen treffen darf. Dies könne ein Grund sein, warum die BaFin vornehmlich gegen finanzstärkere Unternehmen und nicht gegen Privatpersonen vorgeht.
Eggers legte im Folgenden dar, dass § 17 Abs. 3 OWiG grundsätzlich eine sehr flexible Handhabung ermögliche und dem Rechtsanwender Freiheit bei der Beachtung tat- und täterbezogener Kriterien lasse. Demgegenüber versuche die BaFin die Abbildung eines schematischen Regelfalls. Zu diesem Zwecke errechnet die BaFin zunächst in zwei Schritten einen Grundbetrag. Hierzu unterscheidet sie im ersten Schritt nach der Marktkapitalisierung des Emittenten und trennt sie in vier Gruppen; die kleinste Gruppe verläuft bis zu EUR 10 Mio., die größte beginnt ab EUR 4 Mrd. Dabei gilt: je höher die Kapitalisierung, desto höher der Grundbetrag. In einem zweiten Schritt wird nach Gewicht des Gesetzesverstoßes unterschieden, einerseits zwischen Vorsatz und Leichtfertigkeit, andererseits werden die Verstöße als leicht, mittel oder schwer eingestuft. Die so errechneten Grundbeträge beginnen bei EUR 40.000,00 und enden bei EUR 750.000,00. Nach dieser groben Einordnung erfolgt die einzelfallbezogene Anpassung anhand täterbezogener Umstände. Hierbei wendet die BaFin das Doppelverwertungsverbot des § 46 Abs. 3 StGB analog an.
Nach der Darstellung des Verfahrens ging Eggers auf einige bedenkenswerte Punkte ein: Die Kategorisierung der Emittenten sei zu grob; beispielsweise fallen in die zweitkleinste Gruppe Unternehmen mit einer Kapitalisierung zwischen EUR 10-500 Mio. Diese Gruppe erfasse sowohl kleinere Unternehmen als auch größere, die eine eigenständige Rechtsabteilung unterhalten können. Die Richtlinie differenziere hier nicht ausreichend. Umgekehrt könne die Richtlinie dort zu Differenzierungen führen, wo sie nach der gesetzgeberischen Wertung nicht stattfinden sollen. Eine wesentliche Schwäche des Systems liegt nach Ansicht Eggers‘ darin, dass die Richtlinien unter dem Deckmantel der Gleichbehandlung zu einer durchschnittlichen Erhöhung der Bußgelder führen; die Grundbeträge seien teilweise zu hoch angesetzt. Zudem bestehe die Gefahr, dass Gerichte die Leitlinien zur Arbeitsvereinfachung übernehmen und vorgefasste Meinungen über die angemessene Höhe von Bußgeldern entwickeln; dieser Effekt könne sich selbst beschleunigen, weil mehr Betroffenen gegen zu hohe Bußgelder gerichtlich vorgehen und die Gerichte diese zunehmend schematisch abarbeiten. Eggers bemängelte weiter, dass die Richtlinien Compliance-Gesichtspunkte der Unternehmen nicht berücksichtigen. Zuletzt hält er die Anwendung des Doppelverwertungsverbots für fehlerhaft; dies beziehe sich nur auf Tatbestandsmerkmale und keine innenrechtlichen Richtlinien und könne den Betroffenen sogar benachteiligen. Dies sei etwa bei fehlenden Compliance-Regeln der Fall: Sie können auf Tatebene zu einer Bußgelderhöhung führen, weil der Betroffene es unterlassen hat, Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten zu treffen. Auf Täterebene könnten sie ihn begünstigen, weil der Täter sich nicht über Compliance-Regeln hinwegsetzen musste; bei strikter Anwendung des Doppelverwertungsverbots sei letzteres aber nicht mehr zu berücksichtigen.
V. Fazit
Die Räumlichkeiten der Börse Düsseldorf boten den thematisch passenden Rahmen für die Diskussion, an der sich etwa 40 Zuhörer aus Rechtsanwaltschaft, Behördenvertreter, Syndikusanwälte und Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsunternehmen beteiligten. Mit Blick auf die Dynamik des Wertpapieraufsichts- und -strafrechts wird der Diskurs zu den angesprochenen sowie zahlreichen anderen Aspekten dieses Bereichs nicht abreißen. Nachdem bereits im Jahr 2012 aktuelle kapitalmarktstrafrechtliche Themen in der Börse Düsseldorf besprochen wurden, könnte die diesjährige Veranstaltung eine kleine Tradition begründet haben.
I. Einleitung
Am 4. Februar 2015 organisierten die Börse Düsseldorf und WisteV e.V. einen Vortrags- und Diskussionsabend, der zwei jüngere Entwicklungen aufgriff, die für Sanktionen im Kapitalmarktrecht eine wichtige Rolle spielen: Im November 2013 hat die BaFin ihre „WpHG-Bußgeldleitlinien“ veröffentlicht; sie gewährt damit Einblick in die Praxis der Sanktionierung von Verstößen gem. § 39 WpHG und ermöglicht eine offene Diskussion. Ebenfalls im November 2013 hat der dritte Strafsenat des BGH (Urteil v. 27.11.2013 – 3 StR 5/13) bestimmt, was das erlangte Etwas gem. § 73 Abs. 1 S. 1 StGB im Falle einer handelsgestützten Marktmanipulation ist. Unter der Moderation durch RA Dr. Philipp Gehrmann hörten die Gäste drei Vorträge von Vertretern aus Wissenschaft und Praxis zu diesen praxisrelevanten Themen.
II. Sebastian Röthig: Die Rolle des Handelsüberwachungsstelle bei der Marktaufsicht
Röthig, Leiter der Handelsüberwachungsstelle der Börse Düsseldorf, stellte seine Arbeit bei Verfolgung von Verstößen gegen das Kapitalmarktrecht vor. Gem. § 7 BörsG muss jede Börse eine Handelsüberwachungsstelle (HÜSt) einrichten. Die HÜSt ist dazu verpflichtet, umfassend alle Daten zu sammeln, die an der Börse anfallen. Sie untersucht diese Daten computergestützt mit Hilfe von Algorithmen nach auffälligen Handelsmustern; zugleich nimmt sie auch manuelle Prüfungen vor. Der HÜSt stehen dabei umfangreiche Rechte zu, auch ohne besonderen Anlass Informationen von Personen einzuholen, die an der Börse registriert sind und Einblick in ihre Daten zu nehmen. Entsteht ein Anfangsverdacht für eine Straftat, so sind auch Ermittlungen gegenüber Dritten möglich. Das betrifft vor allem Banken, die sich gegenüber der HÜSt nicht auf das Bankgeheimnis berufen können.
Der HÜSt obliegt lediglich Ermittlung und Bewertung des Sachverhalts, eine Sanktion darf sie nicht aussprechen. Sie hat den Vorgang dazu ggf. an die zuständige Stelle abzugeben; als solche kommen die Börsengeschäftsführung, die BaFin und damit letztlich die Staatsanwaltschaft in Betracht. Die Mitarbeiter der HÜSt sind nach der Abgabe weiterhin unterstützend tätig, etwa als Sachverständige.
Röthig führte weiter aus, dass die Anforderungen an die HÜSt und auch die Überwachung der Marktteilnehmer durch die stark zunehmende Regulierung des Kapitalmarktes gestiegen sind. Melde- und Dokumentationspflichten wurden ausgeweitet, neue Indikatoren zur Marktpreismanipulation eingeführt. Zudem verschiebt sich der Tätigkeitsschwerpunkt der HÜSt hin zu einer präventiv orientierten Überwachung. Zukünftig soll die HÜSt auffällige Vorgänge bereits bei Verdacht auf einen Gesetzesverstoß an die Aufsichtsbehörde oder Geschäftsführung weiterleiten, wo aktuell nur festgestellte Tatsachen ausreichend sind.
Auf Nachfrage aus dem Publikum erklärte Röthig, dass es sich bei dem Ermittlungsverfahren der HÜSt um ein verwaltungsrechtliches Verfahren handelt und kein strafrechtliches, so dass der Betroffene nicht durch die Beschuldigtenrechte der StPO geschützt ist. Wird er zu einem verdächtigen Vorgang vernommen, so wird seine Aussage protokolliert. Der Betroffene muss dieses Protokoll weder genehmigen, noch erhält er eine Kopie.
III. Prof. Dr. Martin Paul Waßmer: Der Verfall im Kapitalmarktstrafrecht
„Crime doesn‘t pay.“ Mit diesen Worten eröffnete Waßmer, Strafrechtlehrer in Köln, seinen Vortrag zu der höchst umstrittenen Frage, was das erlangte Etwas im Sinne des § 73 Abs. 1 S. 1 StGB ist. Waßmer zeichnete zunächst die Historie der Vorschrift nach: Der Verfall wurde mit der StGB-Reform im Jahre 1975 in das Gesetz eingefügt und bezog sich in seiner alten Fassung auf den „Vermögensvorteil“, der aus oder für die Tat erlangt worden war; daraus leitete sich das Netto-Prinzip ab, das dazu führte, dass sich der Verfall auf den Betrag nach Abzug der Kosten beschränkte. Mit der zunehmenden Bedeutung des Verfalls, gerade auch wegen der erheblichen fiskalischen Interessen aufgrund hoher Vermögenswerte in Wirtschaftsstrafsachen, kam jedoch bei dem Gesetzgeber die Ansicht auf, dass das Nettoprinzip in seiner Anwendung zu kompliziert sei, und er vereinfachte es aus „kriminalpolitischen Gründen“, um „Missverständnissen“ vorzubeugen. So wurde aus dem Vermögensvorteil im Jahre 1992 das Merkmal des „erlangten Etwas“. Damit war dem sog. Brutto-Prinzip der Weg geebnet. Danach kann der Kosteneinsatz des Unternehmens bei der Anordnung des Verfalls unberücksichtigt bleiben. Das Unternehmen muss dadurch z.T. deutlich mehr als den erlangten Vermögensteil abführen.
Waßmer stellte im Folgenden die Anwendungsprobleme des Verfalls im Zusammenhang mit Straftaten nach § 38 WpHG dar, die sich trotz der scheinbar eindeutigen Hinwendung des Gesetzes zum Brutto-Prinzip ergeben. Hier ist mit Blick auf die jüngste Rechtsprechung des BGH vor allem die Frage von Bedeutung, ob das getätigte Geschäft an sich erlaubt ist und nur aufgrund weiterer Umstände strafrechtliche Relevanz hat, oder ob das Geschäft selbst bereits verboten ist. Ein Beispiel für den ersten Fall ist der Insiderhandel gem. § 14 WpHG. Hier soll nach der Rechtsauffassung des 5. Strafsenats des BGH (5 StR 224/09) nur der durch die Insiderinformation gewonnene Sondervorteil dem Verfall unterliegen, weil das Geschäft, der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, an sich erlaubt ist und nur durch den Einsatz der Insiderinformation strafbar wird. Folglich unterwirft der Senat nur den daraus erlangten Sondervorteil dem Verfall. Anders liegt es etwa bei einer handelsgestützten Marktmanipulation gem. § 20a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG: Hier sanktioniert das Gesetz bereits den Handel als solchen, weil der Handel selbst zur Marktmanipulation führt; deshalb unterliegt dort das gesamte Vermögen dem Verfall. Dies hat der BGH in dem eingangs genannten Urteil entschieden.
Im Abschluss nahm Waßmer noch kritisch zur Ansicht der Rechtsprechung Stellung, wonach der Verfall keinen Strafcharakter habe. Dies sei im Hinblick auf die Zweckrichtung und Wirkung unrichtig. Weiter ging Waßmer auf zivilrechtliche Fragestellungen ein: Zu nennen sind Schadensersatzansprüche der Betroffenen, die der Anordnung des Verfalls entgegenstehen können. Hier stellt sich nicht selten die Frage, ob die Vorschriften des Kapitalmarktrechts drittschützende Wirkung im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB haben, was jedenfalls bei § 38 WpHG nicht der Fall ist. In Betracht komme somit allenfalls ein Anspruch aus § 826 BGB. Eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung liegt nach der Rechtsprechung des BGH jedoch nicht schon deshalb vor, weil der Täter in strafbarer Weise gehandelt hat. Hinzukommen müsse eine besondere Verwerflichkeit. Weiter kritisiert Waßmer, dass von dem Adhäsionsverfahren potentiell geschädigter Anleger zu wenig Gebrauch gemacht werde. Die Gerichte lehnten entsprechende Anträge zumeist mit der Begründung ab, das Verfahren sei dafür zu komplex. Das sei indes nicht nachvollziehbar, weil das Fehlen eines zivilrechtlichen Anspruchs Voraussetzung für den Verfall ist. Waßmer spricht sich zudem dafür aus, potentiell Geschädigten regelmäßig Akteinsicht gem. § 406e StPO zu gewähren, wenn sie Schadensersatzansprüche aus § 826 BGB verfolgen wollen. Die wohl h.M. lehne dies jedoch aufgrund der allgemeinen, überindividuellen Schutzrichtung des § 38 WpHG ab.
IV. Rechtsanwalt Dr. Tobias Eggers: Die Bußgeldleitlinien der BaFin
Die BaFin veröffentlichte Ende 2013 ihre Leitlinien zur Bußgeldbemessung im WpHG. Sie folgt damit dem Vorbild des Bundeskartellamtes, das im Jahre 2006 – ebenfalls ohne gesetzliche Grundlage – seine Richtlinien offen gelegt hat. Einleitend wies Eggers auf wichtige Eckpunkte hin: Die Bußgeldrichtlinien sind reines Binnenrecht der BaFin und haben keine gesetzliche Bindungswirkung, vor allem nicht gegenüber Gerichten, die im Streitfall ein eigenständige Entscheidung treffen. Es handelt sich um normkonkretisierende Vorschriften zu § 17 Abs. 3 OWiG. Ihr Ziel ist eine gleichmäßige Rechtsanwendung und die Offenlegung soll zugleich eine Diskussion über ihren Inhalt ermöglichen. Ein Bedarf nach Gleichbehandlung rührt vor allem daher, dass die BaFin, anders als die Staatsanwaltschaft, bei der Verfolgung von Rechtsverstößen nicht an das Legalitätsprinzip gebunden ist und Zweckmäßigkeitsentscheidungen treffen darf. Dies könne ein Grund sein, warum die BaFin vornehmlich gegen finanzstärkere Unternehmen und nicht gegen Privatpersonen vorgeht.
Eggers legte im Folgenden dar, dass § 17 Abs. 3 OWiG grundsätzlich eine sehr flexible Handhabung ermögliche und dem Rechtsanwender Freiheit bei der Beachtung tat- und täterbezogener Kriterien lasse. Demgegenüber versuche die BaFin die Abbildung eines schematischen Regelfalls. Zu diesem Zwecke errechnet die BaFin zunächst in zwei Schritten einen Grundbetrag. Hierzu unterscheidet sie im ersten Schritt nach der Marktkapitalisierung des Emittenten und trennt sie in vier Gruppen; die kleinste Gruppe verläuft bis zu EUR 10 Mio., die größte beginnt ab EUR 4 Mrd. Dabei gilt: je höher die Kapitalisierung, desto höher der Grundbetrag. In einem zweiten Schritt wird nach Gewicht des Gesetzesverstoßes unterschieden, einerseits zwischen Vorsatz und Leichtfertigkeit, andererseits werden die Verstöße als leicht, mittel oder schwer eingestuft. Die so errechneten Grundbeträge beginnen bei EUR 40.000,00 und enden bei EUR 750.000,00. Nach dieser groben Einordnung erfolgt die einzelfallbezogene Anpassung anhand täterbezogener Umstände. Hierbei wendet die BaFin das Doppelverwertungsverbot des § 46 Abs. 3 StGB analog an.
Nach der Darstellung des Verfahrens ging Eggers auf einige bedenkenswerte Punkte ein: Die Kategorisierung der Emittenten sei zu grob; beispielsweise fallen in die zweitkleinste Gruppe Unternehmen mit einer Kapitalisierung zwischen EUR 10-500 Mio. Diese Gruppe erfasse sowohl kleinere Unternehmen als auch größere, die eine eigenständige Rechtsabteilung unterhalten können. Die Richtlinie differenziere hier nicht ausreichend. Umgekehrt könne die Richtlinie dort zu Differenzierungen führen, wo sie nach der gesetzgeberischen Wertung nicht stattfinden sollen. Eine wesentliche Schwäche des Systems liegt nach Ansicht Eggers‘ darin, dass die Richtlinien unter dem Deckmantel der Gleichbehandlung zu einer durchschnittlichen Erhöhung der Bußgelder führen; die Grundbeträge seien teilweise zu hoch angesetzt. Zudem bestehe die Gefahr, dass Gerichte die Leitlinien zur Arbeitsvereinfachung übernehmen und vorgefasste Meinungen über die angemessene Höhe von Bußgeldern entwickeln; dieser Effekt könne sich selbst beschleunigen, weil mehr Betroffenen gegen zu hohe Bußgelder gerichtlich vorgehen und die Gerichte diese zunehmend schematisch abarbeiten. Eggers bemängelte weiter, dass die Richtlinien Compliance-Gesichtspunkte der Unternehmen nicht berücksichtigen. Zuletzt hält er die Anwendung des Doppelverwertungsverbots für fehlerhaft; dies beziehe sich nur auf Tatbestandsmerkmale und keine innenrechtlichen Richtlinien und könne den Betroffenen sogar benachteiligen. Dies sei etwa bei fehlenden Compliance-Regeln der Fall: Sie können auf Tatebene zu einer Bußgelderhöhung führen, weil der Betroffene es unterlassen hat, Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten zu treffen. Auf Täterebene könnten sie ihn begünstigen, weil der Täter sich nicht über Compliance-Regeln hinwegsetzen musste; bei strikter Anwendung des Doppelverwertungsverbots sei letzteres aber nicht mehr zu berücksichtigen.
V. Fazit
Die Räumlichkeiten der Börse Düsseldorf boten den thematisch passenden Rahmen für die Diskussion, an der sich etwa 40 Zuhörer aus Rechtsanwaltschaft, Behördenvertreter, Syndikusanwälte und Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsunternehmen beteiligten. Mit Blick auf die Dynamik des Wertpapieraufsichts- und -strafrechts wird der Diskurs zu den angesprochenen sowie zahlreichen anderen Aspekten dieses Bereichs nicht abreißen. Nachdem bereits im Jahr 2012 aktuelle kapitalmarktstrafrechtliche Themen in der Börse Düsseldorf besprochen wurden, könnte die diesjährige Veranstaltung eine kleine Tradition begründet haben.