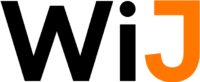Dirk Sauer / Sebastian Münkel: Absprachen im Strafprozess
2. Auflage, Heidelberg u.a. 2014, C.F.Müller-Verlag, 344 Seiten, 49,99 €
I. Die größte (potentielle) Bedrohung für einen Beschuldigten im Strafverfahren, der vor der Frage steht, ob er eine abgesprochene Verfahrensbeendigung anstreben oder ihr zumindest zustimmen soll, stellt letztlich nicht das Gericht und auch nicht der Staatsanwalt oder der Fahnder dar, sondern sein eigener Verteidiger, sofern dieser nicht über sämtliche relevanten rechtlichen und tatsächlichen Fragen vollständig informiert ist, klare Vorstellungen über Möglichkeiten und Gefahren, vor allem nachteilige Folgen einer einvernehmlichen Verfahrensbeendigung, vermissen lässt und vor allem, wenn sich dieser an rechtswidrigen „Deals“ beteiligt (Rn. 687). Wer so schreibt, ist seriös. Es ist nämlich viel schwieriger, sich selbst und seine eigene Gruppe in die Pflicht zu nehmen, als über andere Beteiligte herzuziehen: Dies geschieht in diesem Buch nicht, obwohl – nein: weil es speziell für Verteidiger geschrieben ist und ohne dass die Autoren, angesehene Mannheimer Rechtsanwälte, ihr Unbehagen an manchen Akteuren auf Seiten der Justiz verheimlichen würden. Im Gegenteil: Die Ausführungen enden mit einer situationsspezifischen Betrachtung konsensualer Möglichkeiten, deren Chancen wie Risiken (Rn. 665 ff.), und münden in Grundlinien eines Verhaltenskodex für Verteidiger (Rn. 785 ff.).
Die Verfasser sind aber nicht nur seriös, sondern auch kompetent – und liefern dafür als skeptische (Die Besonderheit des Verständigungsverfahrens besteht allein darin, daß man bei Absprachen zusätzliche <revisible> Verstöße begehen kann <!>, Rn. 388. Sinnvoll sind mit einem Geständnis verbundene Verständigungen nur in Haftsachen bei Aussicht auf eine Bewährungsstrafe, Rn. 704.) Befürworter sowohl von Absprachen (Vorwort S. VIII) als auch des Verständigungsgesetzes (Rn. 34) zahlreiche Beispiele. Zunächst entzaubern sie in bestechender Kürze den § 257c StPO nahezu nebenbei mit ihrer ins Schwarze treffenden Charakterisierung als lediglich verbindliche Ankündigung einer Strafmilderung im Falle eines Geständnisses (Rn. 30). Bereits dieser eine Satz schließt es aus, allein den Konsens als Grundlage für einen den Beschuldigten belastenden Verfahrensabschluss als ausreichend zu betrachten und steht damit zugleich jeder Verständigung über den Schuldspruch und folglich auch einer Einschränkung des Amtsermittlungsgrundsatzes entgegen. Wenn man so will, besteht das gesamte Programm in diesem Motto, während alle übrigen Ausführungen nur Facetten beleuchten.
Zu Recht lehnen Sauer/Münkel die Einordnung einer Verständigung als Vertrag ab: es handele sich um einen gerichtlichen Vorschlag (Rn. 53). Dafür lässt sich der Wortlaut des Gesetzes (§ 257c Abs. 3 S. 4 StPO) ebenso anführen wie die Möglichkeit der Abweichung unter Umständen (§ 257c Abs. 4 S. 1 und 2 StPO), die wahrlich nicht als Hürde bezeichnet werden können. Gleichwohl hängt das Zustandekommen einer das Gericht (wenn beide Verteidiger proklamieren, alle Beteiligten hätten sich an das gesprochene Wort zu halten, Rn. 106, so kann das de jure nicht für den Angeklagten gelten) zunächst bindenden Verständigung davon ab, dass sowohl Angeklagter als auch Staatsanwaltschaft seinem Vorschlag zustimmen (§ 257c Abs. 3 S. 4 StPO). Will man das Schließen einer solchen Übereinkunft mit guten Gründen nicht Vertrag nennen, so hat man allerdings eine begriffliche Lücke zu konstatieren, die zu schließen aber auch der Rezensent keinen überzeugenden Vorschlag zu unterbreiten vermag.
Bei aller gemäß Selbsteinschätzung konsens-freundlichen Grundhaltung, die man während der Lektüre häufig jedoch gar nicht spürt, lassen Sauer/Münkel an keiner Stelle ihres Werks Zweifel an ihrer entschiedenen Ablehnung jegliches Deals, verstanden als schnelle Regelung unter Hintanstellung des materiellen Rechts (zu eng Rn. 415: Umgehung von Schutzmechanismen, denn auch dem Angeklagten lästige Vorschriften sind einzuhalten). Im Gegenteil: sie beklagen, als Verteidiger oftmals vor der Wahl zu stehen, nur entweder ihrer persönlichen Überzeugung oder dem Interesse des Mandanten folgen zu können, wenn diesem seitens der Justiz eine (jedenfalls: scheinbar) entgegenkommende Regelung angeboten werde. Ihre lediglich beratende Funktion verlange zwar, den Bedürfnissen des Beschuldigten den Vorrang einzuräumen – aber eben nicht den unbedingten. Zunächst sei die offene Kommunikation mit dem Mandanten unumgänglich. Erachte es der Verteidiger danach für vertretbar, das Angebot einer Absprache anzunehmen, dürfe er seine eigene Überzeugung zurückstellen – andernfalls müsse er jedoch das Mandat niederlegen. Was beide Autoren als vertretbar ansehen, ist zwar einzelfallabhängig und entzieht sich daher einer generalisierenden Darstellung. Eine Grenze setzen sie jedoch absolut: Der Verteidiger dürfe seine Hand nicht für einen rechtswidrigen Deal reichen. Ohne dass sie dies so aussprächen, beschränken sie jedoch die Absolutheit dieser Grenze auf den materiellrechtlichen Inhalt einer Verständigung. Das zeigt sich daran, dass sie zwar mehrfach deutlich machen, wie sehr der Verteidiger auf die Einhaltung der Vorschriften zur Wahrung der Transparenz und Dokumentation zu dringen habe, aber eben auch völlig zu Recht daran festhalten, dass die originäre Verantwortung dafür bei der Justiz liege. Es darf in der Tat einem Verteidiger nicht verwehrt sein, der Wahrnehmung der Interessen seines Mandanten einen höheren Rang einzuräumen als der Einhaltung der seiner unmittelbaren Einflußsphäre entzogenen Formvorschriften.
Die Verfasser sehen verschiedene Ursachen für die gestiegene Attraktivität von Absprachen. Die meisten dürften zutreffen – und der Rechtstaatlichkeit nicht zur Zierde gereichen. Mit dem Strafzweck der Prävention stehe die Bestrafung in gewisser Weise unter einem Zweckmäßigkeitsvorbehalt. Je stärker die Prävention betont werde, desto mehr begünstige dies das Streben nach Konsens und damit das Opportunitätsprinzip (Rn. 57) – jenseits der Vorschriften der §§ 153 ff. StPO keine rechtliche Analyse, als faktische aber nicht von vorn herein abwegig. Mit Grund verweisen beide Autoren auch auf den sukzessiven Ausbau der prozessualen Rolle des Opfers. Schon längst könne keine Rede mehr davon sein, dass es keinen Anspruch auf Bestrafung gäbe (vom BVerfG jüngst jedoch wiederum so ausgesprochen, BVerfG, Nichtannahmebeschluß vom 6.10.2014 – 2 BvR 1568/12, Rn. 9, allerdings einschränkend auf grundsätzlich mit verschiedenen Ausnahmen, Rn. 10 – 13, gerichtet aber allein auf effektives Tätigwerden der Ermittlungsbehörden, Rn. 14 f.). Auch der Funktion der Befriedigung des Opfers wohne eine Tendenz zum Konsens inne (Rn. 58 – 61). Selbst der Einschätzung beider Verteidiger, die Vielzahl materieller Strafnormen verführe zu Einigungen, mag der Rezensent auch als Staatsanwalt nicht zu widersprechen. Diese Übereinstimmung dürfte allerdings umso mehr schwinden, je konkreter es um den Bedarf für bestimmte Strafnormen geht. Dass eine gewisse Abhilfe gegen den umständebedingten Druck zur Verständigung auf der Basis der aktuellen Rechtslage von einer besseren Ausstattung der Justiz (Rn. 823) unter Zurückdrängung von Ökonomisierungstendenzen (Rn. 71 f.) zu erwarten wäre, lässt sich zwar nicht bestreiten. Abgesehen vom fehlenden Realitätsbezug eines solchen Begehrens stellt sich aber doch auch die tieferreichende Frage, ob eine Intensivierung der Strafjustiz denn wirklich sinnvoll wäre. Strafe als ultima ratio zwingt vorrangig zur Suche nach angemessenen Lösungen im jeweiligen Sachrecht. Je wirksamer sich außerstrafrechtliche Regelungsmechanismen erweisen, desto eher kann eine offene Gesellschaft mit der Konzentration der Strafjustiz auf schweres Unrecht auskommen. An diesem Punkt sollten Verteidiger und Strafjustiz nachdrücklich ansetzen.
II. Das Werk setzt sich aus 6 Teilen zusammen: Teil 1 – Grundlagen: Für den Konsens, gegen den Deal (S. 1 – 41), Teil 2: Verfahrensbeendigende Verständigungen jenseits der Urteilsabsprache (S. 42 – 84), Teil 3: Die Urteilsabsprache nach der Reform der StPO (S. 85 – 195), Teil 4: Die Folgen der Verfahrensbeendigung (S. 196 – 254), Teil 5: Konsensuale Verfahrensweisen bei einzelnen Maßnahmen und Entscheidungen während des laufenden Strafverfahrens (S. 255 – 273) und Teil 6: Was man tun kann (oder lassen sollte): Praxishinweise (S. 274 – 333). Allein dieser Überblick zeigt, daß sich Sauer/Münkel keineswegs mit der Darstellung des geltenden Rechts zufriedengeben. Sie befassen sich vielmehr auch mit dem Phänomen des Konsenses sowie mit den Auswirkungen der Zulässigkeit von Absprachen auf die Statik des Strafprozesses und die dadurch eintretenden Veränderungen der Rolle des Verteidigers, der nicht mehr ausschließlich als Hürdenbauer gegenüber dem staatlichen Begehren auf Bestrafung seines Mandanten auftreten könne, sondern der vielfach die Aufgabe eines Organisators übernehmen müsse, um sämtliche Probleme des Beschuldigten, die sich um den Gegenstand des Strafverfahrens ranken, einer für diesen möglichst erträglichen Lösung zuzuführen, sich also auch um die Auswirkungen jenseits des eigentlichen Strafprozesses kümmern müsse (z.B. Rn. 720 – 731). Ihrer Warnung davor, sich auf Managementfunktionen zu beschränken und die genaue Kenntnis des Sachverhalts und der einschlägigen Rechtsfragen zu vernachlässigen, kann sich der Rezensent nur anschließen: ein Staatsanwalt, der auch Unschuldige bestraft wissen wollte, hätte seinen Beruf verfehlt. In der Tat verhält es sich gerade umgekehrt: Erst auf der Basis verlässlicher Durchdringung der Sach- und Rechtsfragen lässt sich sachgerecht diskutieren. Der Verteidiger im Zeitalter der Verständigung bedarf sogar erweiterter Rechtskenntnisse gegenüber demjenigen, der sich allein auf die Abwehr gegen den staatlichen Strafanspruch beschränkt.
Völlig zu Recht bestehen die Verfasser allerdings auch auf dem Fortbestand der Fähigkeit zur Verteidigung als Abwehrkampf. Sie machen dabei nicht den Eindruck, als propagierten sie diesen Stil, um mit sperrigem Verhalten die Justiz zu einem für den Angeklagten (zu) günstigen Urteil zu drängen. Vielmehr stellen sie bei ihrer Argumentation die Risiken sowohl eines Geständnisses als Vorleistung des Angeklagten (z.B. Rn. 104) als auch einer Verurteilung in den Vordergrund (ausführlich Rn. 676 – 687). Dass niemand ein (rechtlich geschütztes) Interesse an unnötiger Bestrafung hat, leuchtet unmittelbar ein. Besonders verdienstvoll ist es jedoch, dass Sauer/Münkel dabei nicht stehenbleiben, sondern sich zudem ausführlich mit außerstrafrechtlichen Konsequenzen einer Verurteilung befassen, unterteilt in berufsbezogene (Rn. 474 – 542: Gewerbeuntersagung; Auswirkungen auf die Organ- bzw. Beamtenstellung; Unzuverlässigkeit i.S. des Kreditwesen- und des Rechts der freien Berufe, insbesondere des Arztrechts) und sonstige (Rn. 543 – 565: Waffen-, Jagd- und Ausländerrecht) Folgen. Auch die zivilrechtliche Haftung gerät ihnen nicht aus dem Blickfeld.
Allerdings geraten die Autoren bei der Befassung mit den Folgen einer Verurteilung in ein Dilemma: diese Folgen, strafrechtliche wie außerstrafrechtliche, drohen nämlich nicht spezifisch bei einer verständigten Verurteilung, sondern aufgrund einer Bestrafung als solcher, also auch im Falle einer Verurteilung nach konfrontativer Verhandlung. Der Appell, sich nicht vorschnell zu verständigen, ist dennoch richtig, ja geboten: Der Verteidiger muss seinen Mandanten auch im Hinblick auf die außerstrafrechtlichen Folgen umfassend beraten, um gemeinsam mit ihm die Chancen und Risiken der verschiedenen möglichen Verteidigungsstrategien sachgerecht abwägen zu können. Das Ergebnis ist gleichwohl offen. Es kann nämlich aus Sicht des Beschuldigten durchaus sachgerecht sein, ein justizielles Angebot für eine Verständigung trotz der unangenehmen Nebenfolgen (irgendwann) anzunehmen. Das ist etwa dann der Fall, wenn andernfalls keine mildere strafrechtliche Sanktion zu erwarten steht, sich der Eintritt der außerstrafrechtlichen Folgen also aller Voraussicht nach sowieso nicht vermeiden lässt. Es mag an der Profession beider Autoren liegen, dass sie eine solche Situation zwar nicht aus den Augen verlieren, aber doch nur sehr diskret mit ihr umgehen (z.B. Rn. 816).
III. Die Ausführungen sind auf der Höhe der Zeit. An vielen Stellen bedurfte es der Ergänzung von Ausführungen der 1. Auflage (2008) im Hinblick auf die Grundsatzentscheidung des BVerfG vom 19.3.2013 (BVerfGE 133, 168 ff.) und dessen Adaption seitens des BGH (Betrachtung zulässiger Gegenstände einer Verständigung in Rn. 436 – 473). Zudem finden auch bereits die beiden Kammerbeschlüsse des BVerfG vom 26.8.2014 (NJW 2014, 3504 ff. bzw. NStZ 2014, 592 ff.) zum Gebot der Negativmitteilung bei § 243 Abs. 4 S. 1 StPO Erwähnung (Rn. 366), ebenso der Kammerbeschluss vom 25.8.2014, NJW 2014, 3506 f. (Rn. 355) zur Notwendigkeit der Belehrung gemäß § 257c Abs. 5 StPO vor Zustandekommen der Verständigung (danach, aber vor Abgabe des Geständnisses genügt nicht). Besonders hervorzuheben ist das Ringen beider Autoren um sachgerechte Lösungen. Dabei haben sie nicht nur das Interesse ihrer Mandanten im Kopf, sondern sind auch darauf bedacht, der Justiz nicht zu nahe zu treten. Selbst wenn dies nur mit dem Ziel geschehen sein sollte, unangenehmere Folgen für Beschuldigte tunlichst zu vermeiden, ist es des Hervorhebens wert: Nur das Verständnis für das Gegenüber erlaubt ein fruchtbares Gespräch und verstellt nicht von vorn herein die Aussicht auf gemeinsame Einsichten, sei es mit, sei es ohne konsentierte(n) Folgen.
IV. Sauer/Münkel verwenden unter Einschluss von §§ 153 ff. StPO und dem Strafbefehlsverfahren, dem sie sehr kritisch begegnen (Rn. 6 – 21), als Oberbegriff das Wort Absprache. Das ist deshalb angemessen, weil sich die konsensualen Elemente des Ermittlungs- und Strafverfahrens keineswegs auf die Urteilsverständigung beschränken. Teil 5 ist deshalb keineswegs zu Unrecht möglichen Absprachen im Ermittlungs- und Zwischenverfahren gewidmet. Der Verständlichkeit würde es allerdings dienen, für alle Fälle einer Absprache in der Hauptverhandlung, § 257c StPO, den spezielleren Begriff der Verständigung zu gebrauchen. Dies eröffnete zudem den Blick auf zwei stiefmütterlich behandelte Themen:
1. Der Anwendungsbereich der Erörterung (§§ 160b, 202a, 212 und 257b StPO) ist keineswegs gering! Diese ihre eigene Einschätzung (Rn. 92) strafen die Autoren in ihren nachfolgenden Ausführungen selbst Lügen: Zutreffend sind sie nämlich z.B. der Auffassung, dass die Themenbegrenzung für Verständigungen, § 257c StPO, für Erörterungen nicht gelten (Rn. 102), vielmehr jegliches zulässige Prozessverhalten zur Sprache gebracht werden darf (Rn. 106). Bedenkt man zudem, dass dies nicht nur für die Zeit vor der Hauptverhandlung gilt, sondern gemäß § 257b StPO auch während ihres Laufs, die Erörterung also auch dort neben der Verständigung einen eigenen Anwendungsbereich hat, ferner, dass zu den Verfahrensbeteiligten entgegen Sauer/Münkel nicht nur diejenigen gehören, welche über förmliche Rechte das Verfahren beeinflussen können, sondern z.B. auch die Gerichts- und die Bewährungshilfe (a.A. Rn. 97) sowie nicht-nebenklagebefugte Verletzte (zweifelnd Rn. 97 f.), so deutet sich an, was das BVerfG in seinem Grundsatzurteil vom 19.3.2013 meinte, als es die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer kommunikativen Verhandlungsführung als selbstverständlich bezeichnete (BVerfGE 133, 168, Rn. 106).
2. Bedarf es einer Rechtsgrundlage für Absprachen außerhalb der Verständigung gemäß § 257c StPO? Ausdrücklich thematisieren Sauer/Münkel diese Frage nicht, stehen aber fraglos auf dem Standpunkt, dass das Verständigungsgesetz Absprachen vor der Hauptverhandlung nicht entgegensteht. Das aber ist keineswegs selbstverständlich, ließ doch das BVerfG keinen Zweifel daran, dass Verständigungen nur und ausschließlich gemäß § 257c StPO zulässig sind. Im Ergebnis haben Sauer/Münkel jedoch völlig recht, wenngleich nur unter Modifikation ihrer Definition einer Absprache. Ihre Auffassung widerspricht dem BVerfG nicht und weist auch keinen Weg zur Umgehung des Verständigungsgesetzes in dessen Auslegung. Das folgt wiederum aus der Zulässigkeit einer kommunikativen Verhandlungsführung. Das BVerfG zog die Trennlinie bei der Verbindlichkeit: unverbindlichen Erörterungen auch der Sach- und Rechtslage stehe das Grundgesetz nicht entgegen (BVerfGE 133, 168, Rn. 106). Wiederum völlig zu Recht betonen Sauer/Münkel (Rn. 620), dass der Beschuldigte auf staatsanwaltschaftliche Zusagen zwar i.S. von fair trial vertrauen dürfe, dies aber nur im bestehenden Rechtsrahmen und i.S. vorläufiger Einschätzungen gelte. Das aber bedeutet – und davor warnen Sauer/Münkel (Rn. 103 f.) nicht ohne Grund, dass staatsanwaltschaftlichen Zusagen jenseits des selbstverständlichen Verbots der Irreführung (positiv: fair trial) eben gerade keine Verbindlichkeit innewohnt. Das wiederum ist kein Zufall: Verbindlichkeit kommt einer Entscheidung nur zu, wenn es das Gesetz bestimmt. Das gilt im Ermittlungsverfahren nur für Einstellungen nach § 153a Abs. 1 S. 5 StPO im Fall erfüllter Auflage. Im übrigen trägt jede solcher Absprachen und einseitigen staatsanwaltschaftlichen Zusagen den Charakter lediglich der Vorläufigkeit oder einer Ankündigung, kurz: der Unverbindlichkeit. Das steht zwar einer Definition der Absprache entgegen, welche ein Element der Bindung einschließt, nicht aber einer Vereinbarung, solange sie nur unverbindlich ist und bis zu einer mit Verbindlichkeit versehenen gesetzeskonformen Erklärung auch bleibt.
Erörterung und Verständigung sind demnach selbständige Rechtsinstitute: Eine Erörterung kann, muß aber keineswegs auf eine Verständigung i.S. von § 257c StPO abzielen. Diese Differenzierung gilt nicht nur im Ermittlungsverfahren, sondern allgemein. Sie charakterisiert die Erörterung, ganz gleich, in welchem Stadium sie erfolgt, und trägt, wie § 257b StPO zeigt, bis hinein in die Zeit der Hauptverhandlung: Erörtert werden darf alles – die Grenzen des § 257c StPO gelten nicht. Das schließt es allerdings nicht aus, auf Absprachen vor der Hauptverhandlung, die zwar als solche unverbindlich sind, die aber Folgen zeitigen sollen, die denen einer Verständigung gemäß § 257c StPO gleichen, einzelne Rechtsgedanken dieser Vorschrift entsprechend heranzuziehen. Geboten ist dies etwa bei intendierten Vorleistungen des Beschuldigten. So wird man z.B. verlangen müssen, daß ihn der Staatsanwalt umfassend belehrt, bevor er ein absprachebasiertes Geständnis entgegennimmt, ihn also auch darüber in Kenntnis setzt, daß er die Einhaltung von Zusagen nicht erzwingen kann. Sauer/Münkel (Rn. 103) sehen hierin ein der Lösung harrendes Problem und befürworten (de lege lata oder de lege ferenda?) Ausnahmen von der fehlenden Bindung etwa dergestalt, daß zugesagte Prozeßerklärungen als abgegeben gelten oder der staatsanwaltschaftliche Verstoß gegen faires Verhalten einen eigenständigen Einstellungsgrund bilde. Die auf den Strafanspruch als solchen bezogene, auch nur teilweise unmittelbare Rechtsverbindlichkeit staatsanwaltschaftlicher Zusagen kann aber nie über diejenige einer gerichtlichen Verständigung hinausgehen und dürfte, das Verfahren noch zusätzlich deutlich verkomplizierend, ähnlich festgeschriebene Verfahrensregeln wie § 257c StPO verlangen.
Das, was Sauer/Münkel vielfach unspezifisch Absprache nennen, heißt in der Terminologie des Verständnisgesetzes Erörterung. Sie und die Verständigung sind wesensverschieden: Ersterer wohnt eine Verbindlichkeit inne, die letzterer fehlt. Das sehen auch Sauer/Münkel nicht anders (Rn. 102; mißverständlich Rn. 106 a.E.). Deshalb sind sie völlig zu Recht der Ansicht, daß die Bestimmungen über die Erörterung (im wesentlichen) deklaratorischer Natur sind (Rn. 93, auch 652 und 663). Davon kann im Hinblick auf die Regelungen über die Zulässigkeit von Verständigungen in der Hauptverhandlung nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres die Rede sein. Das gilt auch in Ansehung und Anerkennung der Bedenken der Autoren gegen die Annahme einer Bindungswirkung der zustandegekommenen Verständigung (Rn. 244, 351 f. und 374 f.), die schon entfällt, wenn das Gericht bedeutsame Umstände übersehen hat oder sie hinzutreten. Der erzielten Verständigung fehlt jedoch nicht etwa jegliche Rechtswirkung: Sieht das Gericht die Voraussetzungen des § 257c Abs. 4 S. 1 StPO als gegeben an und will sich deshalb von der Verständigung lösen, so muß es dies in öffentlicher Hauptverhandlung bekanntgeben (vgl. BGH, NStZ 2013, 417 ff., Rn. 23). Die Folge davon besteht in der Unverwertbarkeit des verständigungsbasierten Geständnisses, § 257c Abs. 4 S. 3 StPO (Rn. 244). Damit wohnt aber der gemäß § 257c Abs. 3 StPO erreichten Verständigung eine zumindest vorläufige Bindung des Gerichts inne. Diese fehlt im Falle einer bloßen Erörterung, auch wenn das Gericht (ebenso wie die Staatsanwaltschaft) aus Gründen der Fairneß gehalten ist, eine Abweichung von einer bei einer Erörterung (zumindest einer solchen nach § 257b StPO während oder in der Hauptverhandlung) eingenommenen Rechtsauffassung ebenfalls vor dem Ende der Beweisaufnahme offenzulegen (Rn. 102, 176, 187, 261, 620 und 776). Auch Sauer/Münkel erkennen dem Merkmal der (beabsichtigten) Bindung Bedeutung zu, nämlich bei der Antwort auf die Frage, wann eine informelle und damit rechtswidrige Verständigung vorliegt (Rn. 418 und 420 a.E.). Inhaltlich grenzen sie diese damit gegenüber der zulässigen Erörterung ab. Das Kriterium der Bindung knüpft jedoch nicht an die Rechtswidrigkeit, sondern an die Verständigung als solche an.
Der gesetzliche Begriff der Verständigung beschränkt sich entgegen Sauer/Münkel, Rn. 622 (und passim) nicht allein auf do-ut-des-Vereinbarungen. Eine Verständigung wird in aller Regel ein aufeinander Zugehen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten einschließen. Begriffsnotwendig ist das jedoch nicht (a.A. Rn. 257), insbesondere nicht bei einer Verständigung im Hinblick auf das Prozeßverhalten, also ohne Vorschlag einer Strafspanne. Zulässig ist aber zudem, daß sich das Gericht mit den Beteiligten darüber verständigt, schlicht den Rahmen seiner Strafvorstellung zu offenbaren (was ihm auch im Rahmen einer Erörterung erlaubt wäre). Selbst wenn die Beteiligten nicht zustimmen, eine weitergehende Verständigung also nicht zustande kommt, aber keine weiteren Anträge gestellt werden, darf das Gericht (nach Erfüllung seiner Amtsaufklärungspflicht) ohne vorherigen Hinweis keine Strafe verhängen, die außerhalb des von ihm selbst gezogenen Rahmens liegt. Der Gesetzgeber mag sich von Verständigungen nach § 257c StPO die Schonung der knappen Ressource Justiz versprechen, hat aber die tatsächliche Minderung des Aufwands im konkreten Verfahren nicht zur Voraussetzung für eine zulässige Verständigung gemacht.
Sehr anerkennenswert ist das Bemühen um Beschreibung und Eingrenzung verständigungsfähiger Themen (Rn. 321): Zulässig sei eine Verständigung innerhalb des von ausdrücklichen und impliziten Verboten festgelegten Rahmens immer dann, wenn das Prozessverhalten bei Festlegung der Rechtsfolgen Berücksichtigung finden dürfe. Obwohl dies als Ausgangspunkt sachgerecht erscheint und das Erfordernis der Konnexität (dazu unten V 8) wahrt oder herstellt, dürfte es doch zu eng sein, weil das Gericht eine Gesamtbewertung vorzunehmen hat und z.B. die Wiedergutmachung sonstiger Geschädigter, also solcher aus nicht angeklagten Fällen, ebenfalls mildernd berücksichtigen darf und muß.
V. Aus der Fülle der zahlreich behandelten Einzelthemen und der dazu eingenommenen Positionen können hier nur einige aufgegriffen werden, weil sie entweder für die Praxis oder die Interpretation des Verständigungsgesetzes bedeutsam sind.
1. Die Dokumentationspflicht gemäß § 160b StPO erfaßt auch den gescheiterten Abspracheversuch (Rn. 100). Es ist zwar nicht ersichtlich, welche Bedeutung dies für das weitere Verfahren haben soll, entspricht aber der h.M. und wird für die Mitteilung gemäß § 243 Abs. 4 S. 1 StPO (dazu Rn. 278) vom BVerfG (NJW 2014, 3504 ff. bzw. NStZ 2014, 592 ff.) als Verfassungsgebot angesehen (allerdings nicht in dem Sinne, daß die Verfassung eine Negativmitteilung verlange, sondern nur derart, daß eine andere einfach-gesetzliche Auslegung der strafprozessualen Norm willkürlich i.S. von Art. 3 GG wäre).
2. Aus dem Verbot der Heimlichkeit von Absprachen, erst recht, von Verständigungen, folgern Sauer/Münkel (Rn. 102, auch 106) das Gebot der Hinzuziehung aller Beteiligten. Das bedarf der Spezifizierung. Zum einen ist es weder für Erörterungen noch für Verständigungen zwingend, jedes Gespräch in Gegenwart aller zu Beteiligenden zu führen. Einzelgespräche sind durchaus gestattet. Sie müssen nur anschließend offengelegt und in den Akten dokumentiert werden. Zum anderen ist der Kreis der Beteiligten variabel. Folgt man nicht dem sehr engen Verständnis der Beteiligten als allein diejenigen, die das Verfahren förmlich beeinflussen können (dazu bereits oben zu IV <1>), sondern gestattet der Staatsanwaltschaft in den Fällen des § 160b StPO, dem Gericht bei §§ 202a, 212 und 257b StPO die Erörterung mit allen Personen, die auch über bloße Informationsvermittlung für das Verfahren Relevantes beitragen zu können versprechen, so kann keine Rede davon sein, daß sie alle in jedem Fall der Erörterung beigezogen werden müßten. In abgewandelter Form gilt das auch für Verständigungsgespräche. An ihnen darf ein Nebenklägervertreter teilnehmen. Zwingend ist das jedoch nicht. Da das Zustandekommen einer Verständigung lediglich die Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten zu dem Vorschlag des Gerichts voraussetzt, § 257c Abs. 3 S. 4 StPO, ist nur die Mitwirkung dieser drei Beteiligten unbedingt erforderlich. Das bietet nun allerdings nicht etwa eine Rechtsgrundlage dafür, daß sich das Gericht mit der Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten hinter dem Rücken von dessen Verteidiger verständigen dürfte. Wenn der Angeklagte das wollte, wäre die Justiz daran sowieso nicht gehindert. § 257c Abs. 3 S. 4 StPO zielt aber nicht auf die Umgehung des Verteidigers. Ohne Störung des Vertrauensverhältnisses zum Angeklagten ist er selbstverständlich beizuziehen. Die Regelung zeigt jedoch, daß sich (entgegen OLG Naumburg, NStZ 2014, 116 f.) auch ein unverteidigter Angeklagter verständigen darf (Rn. 261).
3. Im Rahmen einer Verständigung darf weiterhin vom Gericht eine Einstellung gemäß § 154 Abs. 2 StPO und von der Staatsanwaltschaft das Stellen des darauf abzielenden Antrags zugesagt werden. Das gilt aber ausschließlich für eine oder mehrere verfahrensgegenständliche Tat(en), mangels Zuständigkeit des Gerichts aber nicht darüber hinaus (so auch Rn. 338). Diese für eine Verständigung gemäß § 257c StPO geltende Beschränkung hindert aber nicht, daß Verteidigung und Staatsanwaltschaft unabhängig von der Verständigung, wenn auch mit Blick auf diese, bipolar übereinkommen, daß die Staatsanwaltschaft ein weiteres Verfahren (oder auch mehrere) gemäß § 154 Abs. 1 StPO einstellt, wenn es tatsächlich zu einer (rechtskräftigen) Verurteilung gemäß der (zunächst:) in Aussicht genommenen Verständigung kommen sollte. Nur unter dieser Modifikation notwendiger verfahrensrechtlicher Trennung trifft die Auffassung der Autoren zu, insoweit habe sich durch das Verständigungsgesetz nichts geändert (Rn. 135).
4. Der Mehrwert der Rede von informellen Absprachen, Zusagen und gescheiterten Verständigungen in einem Atemzug (Rn. 213, s.a. Rn. 405 ff.) erschließt sich dem Rezensenten nicht. Wohl deshalb vermag er nicht einmal zu sagen, ob die Verfasser diese Ankündigung tatsächlich wahrgemacht und zwischen den drei Phänomenen tatsächlich nicht differenziert haben.
5. Sauer/Münkel halten auch den Verfall, ihn sichernde Maßnahmen nach §§ 111b ff. StPO und ein Fahrverbot für zulässige Gegenstände einer Verständigung (Rn. 254, 320 a.E. mit Fn. 114 und 657 a.E.). Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Wie die Rechtsprechung zum Bewährungsbeschluß zeigt, muß der Angeklagte vor seiner Zustimmung zum Verständigungsvorschlag des Gerichts über sämtliche Rechtsfolgen informiert sein, die ihn im Fall einer Verurteilung treffen. Das dürfte z.B. auch für die Entziehung der Fahrerlaubnis gelten.
Verhält es sich dergestalt, so besteht jedoch eine Kluft zwischen dem Verbot, den Angeklagten mit nicht verständigten Rechtsfolgen zu überraschen einerseits und dem Verbot, sich über den Schuldspruch und über Maßregeln zu verständigen andererseits. Sie läßt sich nur dadurch schließen, daß sich der Vorschlag des Gerichts, § 257c Abs. 3 S. 1 StPO, in zwei Teile mit ganz unterschiedlicher Rechtsqualität zu gliedern hat. Sinnvollerweise voranzustellen sein wird der rein informatorische Teil, in welchem das Gericht die Rechtsfolgen zumindest ihrer Art nach zu erwähnen hat, über die es allein, d.h. unabhängig vom Zustandekommen einer Verständigung im übrigen zu entscheiden hat und entscheiden will. Erst in den nachfolgenden zweiten, den konstitutiven Teil des Vorschlags, sind die Aspekte einschließlich der in Aussicht genommenen Spanne der Rechtsfolgen aufzunehmen, über die eine Verständigung zulässig ist und über die sich zu verständigen das Gericht auch bereit ist. Nur der zweite Teil beruht im Fall ihres Zustandekommens auf der Verständigung, während der erste Teil lediglich die Rahmenbedingungen nennt. Diese bleiben unverbindlich, auch wenn die Verständigung zustandekommt. Allerdings dürfen die Themen des ersten Teils, über die keine Verständigung zulässig ist, Gegenstand einer Erörterung, § 257b StPO, sein. Es bietet sich daher an, zunächst diese Rahmenbedingungen zu erörtern. Diese Erörterung ist protokollpflichtig, § 273 Abs. 1 S. 2 StPO. Darauf kann dann im ersten, dem rein informatorischen Teil des gerichtlichen Verständigungsvorschlags, verwiesen werden. Zu beachten ist dabei allerdings, daß das Gericht, falls es sich im Rahmen der Erörterung zu seinen Vorstellungen über die nicht verständigungsfähigen Rechtsfolgen geäußert haben sollte, von diesen nur abweichen darf, wenn es dies in öffentlicher Hauptverhandlung offengelegt hat.
Da der Verfall als solcher ebenso wie als Wertersatzverfall zwingend ist, kann er nicht Gegenstand einer Verständigung sein. Er gehört daher allein in den informatorischen Teil des Verständigungsvorschlags. Da aber Verfall nicht angeordnet werden darf, ohne daß das Gericht über die Voraussetzungen der Härteklauseln des § 73c StGB entschieden hat, wird zumindest die (Un-)Billigkeit verständigungsfähig sein und damit Eingang in den konstitutiven Teil finden dürfen. Letzteres wird man wohl auch für das Fahrverbot als Neben-, de lege ferenda evtl. auch als Hauptstrafe anzunehmen haben, während die Entziehung der Fahrerlaubnis nicht verständigungsfähig ist (und wohl auch nicht die Dauer der Sperrfrist).
6. Nach Sauer/Münkel (Rn. 279) ist in die Urteilsgründe gem. § 267 Abs. 3 StPO auch eine gescheiterte Verständigung aufzunehmen. Was davon abhängen soll, wird jedoch nicht recht deutlich. Allerdings stehen beide Autoren mit dieser Auffassung nicht allein da und liegt es im Zuge der derzeitigen Skepsis gegenüber der Verständigungspraxis, auch Unnötiges dokumentieren zu müssen. Wie ein Urteil oder auch nur der Strafausspruch nun aber auf einem etwaigen Verstoß beruhen können soll, ist dunkel – ohne daß der Rezensent jedoch über damit begründete Aufhebungen überrascht wäre. Auch für den Ausschluß des Rechtsmittelverzichts, § 302 Abs. 1 S. 2 StPO, soll eine gescheiterte Verständigung genügen (Rn. 284). Das mag so sein, ist aber von der Warnfunktion her nicht geboten.
7. Die Eignung gemäß § 257c Abs. 1 S. 1 StPO an die Erwartung zu knüpfen, ein Geständnis ermögliche ein Urteil (Rn. 307), ist zumindest dann kühn, wenn aus der Notwendigkeit einer nachfolgenden umfassenden Beweisaufnahme auf mangelnde Eignung geschlossen wird. Beide Autoren gehen zwar selbst nicht soweit, halten einen solchen Schluß aber immerhin für möglich. Er kollidierte jedoch mit dem Gebot der umfassenden Prüfung eines verständnisbasierten Geständnisses, falls nicht bereits eine für die Überzeugungsbildung des Gerichts ausreichende Beweisaufnahme vorausgegangen ist. Eignung wird man demnach in einem weiteren Sinne interpretieren müssen und sie immer dann zu bejahen haben, wenn sich das Gericht von einer Verständigung eine wie auch immer geartete Förderung des Verfahrens verspricht. Sie kann auch in einer bloßen Vergewisserung liegen.
8. § 257c Abs. 1 S. 1 StPO gestattet eine Verständigung sowohl über den weiteren Fortgang als auch über das Ergebnis des Verfahrens. Nach § 257c Abs. 2 S. 1 StPO dürfen Gegenstand einer Verständigung nur die Rechtsfolgen, sonstige verfahrensbezogene Maßnahmen sowie das Prozeßverhalten sein. Mißverständlich verlangt § 257c Abs. 2 S. 2 StPO allerdings für grundsätzlich jede Verständigung ein Geständnis. Reduziert man dessen Anwendungsbereich sinnvollerweise auf die Urteilsverständigung, so löst man damit auch die Verbindung zu § 257c Abs. 2 S. 1 StPO. Das öffnet den Blick für den Zusammenhang zwischen § 257c Abs. 1 S. 1 StPO und § 257c Abs. 2 S. 1 StPO. Dessen Alternative Prozeßverhalten läßt sich dann, wozu die Autoren schweigen, mit der Variante einer Verständigung über den Fortgang des Verfahrens, § 257c Abs. 1 S. 1 StPO, verknüpfen. Damit entfällt (entgegen Rn. 325) die Verbindung zwischen Prozeßverhalten und Urteilsverständigung. Auf diese Weise ist das Gebot der Konnexität (Rn. 328, auch 336 – 338) gewahrt und quälerische Überlegungen, ob es rechtlich zulässige Verbindungen zwischen Prozeßverhalten und Urteilsverständigung überhaupt geben kann (Rn. 322 – 328), stellen sich nicht mehr.
9. Mit der Auffassung, auf ein dem Verwertungsverbot nach § 257c Abs. 4 S. 4 StPO unterliegendes Geständnis dürfe auch nicht zu Lasten von Mitangeklagten zurückgegriffen werden (Rn. 378), vertreten die Autoren die h.M. Damit werden Dritte begünstigt, die an der Verständigung nicht beteiligt waren. Der Zweck, Schutz dessen, der sich nur der Verständigung wegen geständig eingelassen hat, verlangt dies allerdings nicht. Im Regelfall würde sich aber auch mit einer Verwertung des Geständnisses wenig ändern, denn ein quasi widerrufenes, rein verständnisbasiertes Geständnis birgt wenig bis keinen Erkenntniswert, auf den sich zu Lasten eines Dritten irgendetwas strafprozessual stützen ließe. Ein Unterschied besteht selbst dann nur (oder zumindest im wesentlichen) konstruktiv, wenn das Geständnis zu neuen Tatsachen und/oder Beweismitteln führte: Mangels Fernwirkung des Verwertungsverbots dürfen derartige Erkenntisse trotz Unverwertbarkeit des Geständnisses selbst in den Prozeß eingeführt werden.
10. Sauer/Münkel sehen ein Problem darin, daß die Staatsanwaltschaft entgegen ihrer Zusage im Rahmen einer Verständigung den Antrag auf Teil-Einstellung gemäß § 154 Abs. 2 StPO nicht stellen könnte, obwohl der Angeklagte sein Geständnis bereits abgelegt hat. Realistisch wird eine solche Verhaltensweise nur zu erwarten sein, wenn Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, ob die Äußerungen des Angeklagten als Geständnis angesehen werden können. Als Lösung schlagen beide vor, daß die Staatsanwaltschaft mit ihrem Antrag in Vorleistung trete. Diese Reihenfolge führt aber ebenfalls nicht zu einer größeren Sicherheit des Angeklagten, weil sowohl die Staatsanwaltschaft ihren Antrag wieder zurücknehmen als auch das Gericht sich der Bewertung der Staatsanwaltschaft anschließen kann. Der Beschuldigte muß daher mit diesem (von ihm selbst wesentlich beeinflußbaren) Risiko leben. Die Lösung sieht das Gesetz allein im auf die Lösung von der Verständigung folgenden Verwertungsverbot, § 257c Abs. 4 S. 4 StPO.
11. Die Unzulässigkeit, sich über das Vorliegen eines minderschweren Falles verständigen zu dürfen, führt die Autoren zu dem Vorschlag, sich auf der Basis eines Normalfalls zu verständigen und dem Gericht zu raten, sich von der Verständigung zu Gunsten des Angeklagten zu lösen, wenn das nachfolgende Geständnis Anhaltspunkte für die Annahme eines minder schweren Falles biete (Rn. 393). Damit allein ist es aber nicht getan, weil mit der Abstandnahme das Geständnis unverwertbar wird. Nur wer allein die Verwertung zu Lasten des Angeklagten verneint, sie zu seinen Gunsten aber zuläßt, hat hier kein Problem. Alle anderen müssen sich weitere Schritte überlegen. Sie können in einer neuerlichen Verständigung auf niedriger Basis liegen oder darin bestehen, daß von vorn herein zwei Spannen ins Auge gefaßt werden, die eine bei Bejahung des Normal-, die andere bei Annahme eines minder schweren Falls. Auf der Basis des Vorschlags von Sauer/Münkel hat es aber auch der Angeklagte in der Hand, sich selbst zu helfen: er kann sein Geständnis ganz oder teilweise wiederholen und sich damit völlig unabhängig von einer Verständigung einen Strafmilderungsgrund verschaffen. Hinzu kommt, daß die Frage des Vorliegens eines minderschweren Falls Gegenstand einer Erörterung gemäß § 257b StPO sein darf. Sie führt zwar zu keinen (bindenden) Ergebnissen, erlaubt aber den Verfahrensbeteilgten, ihr Prozeßverhalten auf die darin gewonnenen Erkenntnisse zu stützen.
VI. Der Lesegenuß wäre ungeschmälert, kämen die sorgfältigen, von tiefer Sachkenntnis der klugen, weil eindimensionalem Denken abholden Autoren zeugenden Gedanken auch in einem damit korrespondierenden Gewande daher. Vermutlich ist es eine Art Agio auf den sehr günstigen Preis, daß der Nutzer ein diese Bezeichnung rechtfertigendes Stichwortverzeichnis, der Leser nicht nur manche Korrektur schmerzlich vermißt und sich der Verdacht nicht unterdrücken läßt, bestimmte Worte einer Passage seien, was nie ganz vermeidbar ist, vom Schreibprogramm oder der Schreibkraft nicht genau verstanden worden, ohne daß dies aber kontrolliert, geschweige denn korrigiert worden wäre, sondern sich auch nach den Zeiten zurücksehnt, in denen es noch Lektoren gab, die für die Lesbarkeit Sorge trugen. Stilmängel (Der Revisionsführer tut … schildern, Rn. 391) und Sinnentstellendes (Sodann wird die Entscheidung des BVerfG vom 19.3.2013 verworfen <anstatt: auf sie verwiesen>, Rn. 423) stören nur punktuell, auch wenn sie sich in ähnlicher Weise wiederholen (Beispiele: Rn. 317, 617, 620, 655, 683 und 766). Zu verschmerzen ist auch, daß kurz vor der Schlußbetrachtung (ab Rn. 819) der Hoffnung Ausdruck verliehen wird, die Lektüre der folgenden Hinweise möge dem Leser Gewinn bringen (Rn. 818) – eine Formulierung, die man eher im Vorwort erwarten dürfte.
Weniger leicht nimmt es der Leser hingegen, wenn ihn (insbesondere in den ersten beiden Teilen) nicht nur eine Fülle von Hinweisen auf nachfolgende, vertiefende Ausführungen begleiten, sondern diese sich dort zwar finden, aber inhaltlich manchmal gar nicht wirklich weiterführen, und diese Darstellungstechnik zudem teilweise zu ersichtlich vermeidbaren Wiederholungen führt. Für die gewiß und hoffentlich nicht erst in 6 Jahren zu erwartende Neuauflage ist zu wünschen, daß unter teilweise radikaler Kürzung im Interesse einer verbesserten Konzentration zusammengeführt wird, was zusammengehört, sich bislang aber an unterschiedlichen Stellen findet. Da aufgrund nachlassender Aktualität sicherlich auch die Ausführungen pro & contra Absprache ebenso wie die Darstellung der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Verständigungsgesetzes knapper ausfallen können, sei hier zudem der Wunsch geäußert, daß der gewonnene Platz durch Aufnahme eines neuen Teils gefüllt werde, der sich der Kooperation zwischen Justiz und Verteidigung bei Führen von Internal Investigations widmet.
VII. Als Fazit läßt sich festhalten: Ungeachtet der angeführten, die äußere Darstellung betreffenden Wünsche handelt es sich um ein hochaktuelles Werk, das insbesondere für den als Verteidiger aktiven Nutzer, an den es sich vorrangig wendet, eine Fülle wertvoller Tipps bereithält, sich darauf aber keineswegs beschränkt, sondern jeden Leser, unabhängig von seiner Profession, ebenso zum Nach- wie aufgrund steter Anregungen auch zum Weiterdenken sowohl über Phänomene des Konsenses im Strafverfahren als solche als auch über das Verständnis des geltenden Rechts anregt.
2. Auflage, Heidelberg u.a. 2014, C.F.Müller-Verlag, 344 Seiten, 49,99 €
I. Die größte (potentielle) Bedrohung für einen Beschuldigten im Strafverfahren, der vor der Frage steht, ob er eine abgesprochene Verfahrensbeendigung anstreben oder ihr zumindest zustimmen soll, stellt letztlich nicht das Gericht und auch nicht der Staatsanwalt oder der Fahnder dar, sondern sein eigener Verteidiger, sofern dieser nicht über sämtliche relevanten rechtlichen und tatsächlichen Fragen vollständig informiert ist, klare Vorstellungen über Möglichkeiten und Gefahren, vor allem nachteilige Folgen einer einvernehmlichen Verfahrensbeendigung, vermissen lässt und vor allem, wenn sich dieser an rechtswidrigen „Deals“ beteiligt (Rn. 687). Wer so schreibt, ist seriös. Es ist nämlich viel schwieriger, sich selbst und seine eigene Gruppe in die Pflicht zu nehmen, als über andere Beteiligte herzuziehen: Dies geschieht in diesem Buch nicht, obwohl – nein: weil es speziell für Verteidiger geschrieben ist und ohne dass die Autoren, angesehene Mannheimer Rechtsanwälte, ihr Unbehagen an manchen Akteuren auf Seiten der Justiz verheimlichen würden. Im Gegenteil: Die Ausführungen enden mit einer situationsspezifischen Betrachtung konsensualer Möglichkeiten, deren Chancen wie Risiken (Rn. 665 ff.), und münden in Grundlinien eines Verhaltenskodex für Verteidiger (Rn. 785 ff.).
Die Verfasser sind aber nicht nur seriös, sondern auch kompetent – und liefern dafür als skeptische (Die Besonderheit des Verständigungsverfahrens besteht allein darin, daß man bei Absprachen zusätzliche <revisible> Verstöße begehen kann <!>, Rn. 388. Sinnvoll sind mit einem Geständnis verbundene Verständigungen nur in Haftsachen bei Aussicht auf eine Bewährungsstrafe, Rn. 704.) Befürworter sowohl von Absprachen (Vorwort S. VIII) als auch des Verständigungsgesetzes (Rn. 34) zahlreiche Beispiele. Zunächst entzaubern sie in bestechender Kürze den § 257c StPO nahezu nebenbei mit ihrer ins Schwarze treffenden Charakterisierung als lediglich verbindliche Ankündigung einer Strafmilderung im Falle eines Geständnisses (Rn. 30). Bereits dieser eine Satz schließt es aus, allein den Konsens als Grundlage für einen den Beschuldigten belastenden Verfahrensabschluss als ausreichend zu betrachten und steht damit zugleich jeder Verständigung über den Schuldspruch und folglich auch einer Einschränkung des Amtsermittlungsgrundsatzes entgegen. Wenn man so will, besteht das gesamte Programm in diesem Motto, während alle übrigen Ausführungen nur Facetten beleuchten.
Zu Recht lehnen Sauer/Münkel die Einordnung einer Verständigung als Vertrag ab: es handele sich um einen gerichtlichen Vorschlag (Rn. 53). Dafür lässt sich der Wortlaut des Gesetzes (§ 257c Abs. 3 S. 4 StPO) ebenso anführen wie die Möglichkeit der Abweichung unter Umständen (§ 257c Abs. 4 S. 1 und 2 StPO), die wahrlich nicht als Hürde bezeichnet werden können. Gleichwohl hängt das Zustandekommen einer das Gericht (wenn beide Verteidiger proklamieren, alle Beteiligten hätten sich an das gesprochene Wort zu halten, Rn. 106, so kann das de jure nicht für den Angeklagten gelten) zunächst bindenden Verständigung davon ab, dass sowohl Angeklagter als auch Staatsanwaltschaft seinem Vorschlag zustimmen (§ 257c Abs. 3 S. 4 StPO). Will man das Schließen einer solchen Übereinkunft mit guten Gründen nicht Vertrag nennen, so hat man allerdings eine begriffliche Lücke zu konstatieren, die zu schließen aber auch der Rezensent keinen überzeugenden Vorschlag zu unterbreiten vermag.
Bei aller gemäß Selbsteinschätzung konsens-freundlichen Grundhaltung, die man während der Lektüre häufig jedoch gar nicht spürt, lassen Sauer/Münkel an keiner Stelle ihres Werks Zweifel an ihrer entschiedenen Ablehnung jegliches Deals, verstanden als schnelle Regelung unter Hintanstellung des materiellen Rechts (zu eng Rn. 415: Umgehung von Schutzmechanismen, denn auch dem Angeklagten lästige Vorschriften sind einzuhalten). Im Gegenteil: sie beklagen, als Verteidiger oftmals vor der Wahl zu stehen, nur entweder ihrer persönlichen Überzeugung oder dem Interesse des Mandanten folgen zu können, wenn diesem seitens der Justiz eine (jedenfalls: scheinbar) entgegenkommende Regelung angeboten werde. Ihre lediglich beratende Funktion verlange zwar, den Bedürfnissen des Beschuldigten den Vorrang einzuräumen – aber eben nicht den unbedingten. Zunächst sei die offene Kommunikation mit dem Mandanten unumgänglich. Erachte es der Verteidiger danach für vertretbar, das Angebot einer Absprache anzunehmen, dürfe er seine eigene Überzeugung zurückstellen – andernfalls müsse er jedoch das Mandat niederlegen. Was beide Autoren als vertretbar ansehen, ist zwar einzelfallabhängig und entzieht sich daher einer generalisierenden Darstellung. Eine Grenze setzen sie jedoch absolut: Der Verteidiger dürfe seine Hand nicht für einen rechtswidrigen Deal reichen. Ohne dass sie dies so aussprächen, beschränken sie jedoch die Absolutheit dieser Grenze auf den materiellrechtlichen Inhalt einer Verständigung. Das zeigt sich daran, dass sie zwar mehrfach deutlich machen, wie sehr der Verteidiger auf die Einhaltung der Vorschriften zur Wahrung der Transparenz und Dokumentation zu dringen habe, aber eben auch völlig zu Recht daran festhalten, dass die originäre Verantwortung dafür bei der Justiz liege. Es darf in der Tat einem Verteidiger nicht verwehrt sein, der Wahrnehmung der Interessen seines Mandanten einen höheren Rang einzuräumen als der Einhaltung der seiner unmittelbaren Einflußsphäre entzogenen Formvorschriften.
Die Verfasser sehen verschiedene Ursachen für die gestiegene Attraktivität von Absprachen. Die meisten dürften zutreffen – und der Rechtstaatlichkeit nicht zur Zierde gereichen. Mit dem Strafzweck der Prävention stehe die Bestrafung in gewisser Weise unter einem Zweckmäßigkeitsvorbehalt. Je stärker die Prävention betont werde, desto mehr begünstige dies das Streben nach Konsens und damit das Opportunitätsprinzip (Rn. 57) – jenseits der Vorschriften der §§ 153 ff. StPO keine rechtliche Analyse, als faktische aber nicht von vorn herein abwegig. Mit Grund verweisen beide Autoren auch auf den sukzessiven Ausbau der prozessualen Rolle des Opfers. Schon längst könne keine Rede mehr davon sein, dass es keinen Anspruch auf Bestrafung gäbe (vom BVerfG jüngst jedoch wiederum so ausgesprochen, BVerfG, Nichtannahmebeschluß vom 6.10.2014 – 2 BvR 1568/12, Rn. 9, allerdings einschränkend auf grundsätzlich mit verschiedenen Ausnahmen, Rn. 10 – 13, gerichtet aber allein auf effektives Tätigwerden der Ermittlungsbehörden, Rn. 14 f.). Auch der Funktion der Befriedigung des Opfers wohne eine Tendenz zum Konsens inne (Rn. 58 – 61). Selbst der Einschätzung beider Verteidiger, die Vielzahl materieller Strafnormen verführe zu Einigungen, mag der Rezensent auch als Staatsanwalt nicht zu widersprechen. Diese Übereinstimmung dürfte allerdings umso mehr schwinden, je konkreter es um den Bedarf für bestimmte Strafnormen geht. Dass eine gewisse Abhilfe gegen den umständebedingten Druck zur Verständigung auf der Basis der aktuellen Rechtslage von einer besseren Ausstattung der Justiz (Rn. 823) unter Zurückdrängung von Ökonomisierungstendenzen (Rn. 71 f.) zu erwarten wäre, lässt sich zwar nicht bestreiten. Abgesehen vom fehlenden Realitätsbezug eines solchen Begehrens stellt sich aber doch auch die tieferreichende Frage, ob eine Intensivierung der Strafjustiz denn wirklich sinnvoll wäre. Strafe als ultima ratio zwingt vorrangig zur Suche nach angemessenen Lösungen im jeweiligen Sachrecht. Je wirksamer sich außerstrafrechtliche Regelungsmechanismen erweisen, desto eher kann eine offene Gesellschaft mit der Konzentration der Strafjustiz auf schweres Unrecht auskommen. An diesem Punkt sollten Verteidiger und Strafjustiz nachdrücklich ansetzen.
II. Das Werk setzt sich aus 6 Teilen zusammen: Teil 1 – Grundlagen: Für den Konsens, gegen den Deal (S. 1 – 41), Teil 2: Verfahrensbeendigende Verständigungen jenseits der Urteilsabsprache (S. 42 – 84), Teil 3: Die Urteilsabsprache nach der Reform der StPO (S. 85 – 195), Teil 4: Die Folgen der Verfahrensbeendigung (S. 196 – 254), Teil 5: Konsensuale Verfahrensweisen bei einzelnen Maßnahmen und Entscheidungen während des laufenden Strafverfahrens (S. 255 – 273) und Teil 6: Was man tun kann (oder lassen sollte): Praxishinweise (S. 274 – 333). Allein dieser Überblick zeigt, daß sich Sauer/Münkel keineswegs mit der Darstellung des geltenden Rechts zufriedengeben. Sie befassen sich vielmehr auch mit dem Phänomen des Konsenses sowie mit den Auswirkungen der Zulässigkeit von Absprachen auf die Statik des Strafprozesses und die dadurch eintretenden Veränderungen der Rolle des Verteidigers, der nicht mehr ausschließlich als Hürdenbauer gegenüber dem staatlichen Begehren auf Bestrafung seines Mandanten auftreten könne, sondern der vielfach die Aufgabe eines Organisators übernehmen müsse, um sämtliche Probleme des Beschuldigten, die sich um den Gegenstand des Strafverfahrens ranken, einer für diesen möglichst erträglichen Lösung zuzuführen, sich also auch um die Auswirkungen jenseits des eigentlichen Strafprozesses kümmern müsse (z.B. Rn. 720 – 731). Ihrer Warnung davor, sich auf Managementfunktionen zu beschränken und die genaue Kenntnis des Sachverhalts und der einschlägigen Rechtsfragen zu vernachlässigen, kann sich der Rezensent nur anschließen: ein Staatsanwalt, der auch Unschuldige bestraft wissen wollte, hätte seinen Beruf verfehlt. In der Tat verhält es sich gerade umgekehrt: Erst auf der Basis verlässlicher Durchdringung der Sach- und Rechtsfragen lässt sich sachgerecht diskutieren. Der Verteidiger im Zeitalter der Verständigung bedarf sogar erweiterter Rechtskenntnisse gegenüber demjenigen, der sich allein auf die Abwehr gegen den staatlichen Strafanspruch beschränkt.
Völlig zu Recht bestehen die Verfasser allerdings auch auf dem Fortbestand der Fähigkeit zur Verteidigung als Abwehrkampf. Sie machen dabei nicht den Eindruck, als propagierten sie diesen Stil, um mit sperrigem Verhalten die Justiz zu einem für den Angeklagten (zu) günstigen Urteil zu drängen. Vielmehr stellen sie bei ihrer Argumentation die Risiken sowohl eines Geständnisses als Vorleistung des Angeklagten (z.B. Rn. 104) als auch einer Verurteilung in den Vordergrund (ausführlich Rn. 676 – 687). Dass niemand ein (rechtlich geschütztes) Interesse an unnötiger Bestrafung hat, leuchtet unmittelbar ein. Besonders verdienstvoll ist es jedoch, dass Sauer/Münkel dabei nicht stehenbleiben, sondern sich zudem ausführlich mit außerstrafrechtlichen Konsequenzen einer Verurteilung befassen, unterteilt in berufsbezogene (Rn. 474 – 542: Gewerbeuntersagung; Auswirkungen auf die Organ- bzw. Beamtenstellung; Unzuverlässigkeit i.S. des Kreditwesen- und des Rechts der freien Berufe, insbesondere des Arztrechts) und sonstige (Rn. 543 – 565: Waffen-, Jagd- und Ausländerrecht) Folgen. Auch die zivilrechtliche Haftung gerät ihnen nicht aus dem Blickfeld.
Allerdings geraten die Autoren bei der Befassung mit den Folgen einer Verurteilung in ein Dilemma: diese Folgen, strafrechtliche wie außerstrafrechtliche, drohen nämlich nicht spezifisch bei einer verständigten Verurteilung, sondern aufgrund einer Bestrafung als solcher, also auch im Falle einer Verurteilung nach konfrontativer Verhandlung. Der Appell, sich nicht vorschnell zu verständigen, ist dennoch richtig, ja geboten: Der Verteidiger muss seinen Mandanten auch im Hinblick auf die außerstrafrechtlichen Folgen umfassend beraten, um gemeinsam mit ihm die Chancen und Risiken der verschiedenen möglichen Verteidigungsstrategien sachgerecht abwägen zu können. Das Ergebnis ist gleichwohl offen. Es kann nämlich aus Sicht des Beschuldigten durchaus sachgerecht sein, ein justizielles Angebot für eine Verständigung trotz der unangenehmen Nebenfolgen (irgendwann) anzunehmen. Das ist etwa dann der Fall, wenn andernfalls keine mildere strafrechtliche Sanktion zu erwarten steht, sich der Eintritt der außerstrafrechtlichen Folgen also aller Voraussicht nach sowieso nicht vermeiden lässt. Es mag an der Profession beider Autoren liegen, dass sie eine solche Situation zwar nicht aus den Augen verlieren, aber doch nur sehr diskret mit ihr umgehen (z.B. Rn. 816).
III. Die Ausführungen sind auf der Höhe der Zeit. An vielen Stellen bedurfte es der Ergänzung von Ausführungen der 1. Auflage (2008) im Hinblick auf die Grundsatzentscheidung des BVerfG vom 19.3.2013 (BVerfGE 133, 168 ff.) und dessen Adaption seitens des BGH (Betrachtung zulässiger Gegenstände einer Verständigung in Rn. 436 – 473). Zudem finden auch bereits die beiden Kammerbeschlüsse des BVerfG vom 26.8.2014 (NJW 2014, 3504 ff. bzw. NStZ 2014, 592 ff.) zum Gebot der Negativmitteilung bei § 243 Abs. 4 S. 1 StPO Erwähnung (Rn. 366), ebenso der Kammerbeschluss vom 25.8.2014, NJW 2014, 3506 f. (Rn. 355) zur Notwendigkeit der Belehrung gemäß § 257c Abs. 5 StPO vor Zustandekommen der Verständigung (danach, aber vor Abgabe des Geständnisses genügt nicht). Besonders hervorzuheben ist das Ringen beider Autoren um sachgerechte Lösungen. Dabei haben sie nicht nur das Interesse ihrer Mandanten im Kopf, sondern sind auch darauf bedacht, der Justiz nicht zu nahe zu treten. Selbst wenn dies nur mit dem Ziel geschehen sein sollte, unangenehmere Folgen für Beschuldigte tunlichst zu vermeiden, ist es des Hervorhebens wert: Nur das Verständnis für das Gegenüber erlaubt ein fruchtbares Gespräch und verstellt nicht von vorn herein die Aussicht auf gemeinsame Einsichten, sei es mit, sei es ohne konsentierte(n) Folgen.
IV. Sauer/Münkel verwenden unter Einschluss von §§ 153 ff. StPO und dem Strafbefehlsverfahren, dem sie sehr kritisch begegnen (Rn. 6 – 21), als Oberbegriff das Wort Absprache. Das ist deshalb angemessen, weil sich die konsensualen Elemente des Ermittlungs- und Strafverfahrens keineswegs auf die Urteilsverständigung beschränken. Teil 5 ist deshalb keineswegs zu Unrecht möglichen Absprachen im Ermittlungs- und Zwischenverfahren gewidmet. Der Verständlichkeit würde es allerdings dienen, für alle Fälle einer Absprache in der Hauptverhandlung, § 257c StPO, den spezielleren Begriff der Verständigung zu gebrauchen. Dies eröffnete zudem den Blick auf zwei stiefmütterlich behandelte Themen:
1. Der Anwendungsbereich der Erörterung (§§ 160b, 202a, 212 und 257b StPO) ist keineswegs gering! Diese ihre eigene Einschätzung (Rn. 92) strafen die Autoren in ihren nachfolgenden Ausführungen selbst Lügen: Zutreffend sind sie nämlich z.B. der Auffassung, dass die Themenbegrenzung für Verständigungen, § 257c StPO, für Erörterungen nicht gelten (Rn. 102), vielmehr jegliches zulässige Prozessverhalten zur Sprache gebracht werden darf (Rn. 106). Bedenkt man zudem, dass dies nicht nur für die Zeit vor der Hauptverhandlung gilt, sondern gemäß § 257b StPO auch während ihres Laufs, die Erörterung also auch dort neben der Verständigung einen eigenen Anwendungsbereich hat, ferner, dass zu den Verfahrensbeteiligten entgegen Sauer/Münkel nicht nur diejenigen gehören, welche über förmliche Rechte das Verfahren beeinflussen können, sondern z.B. auch die Gerichts- und die Bewährungshilfe (a.A. Rn. 97) sowie nicht-nebenklagebefugte Verletzte (zweifelnd Rn. 97 f.), so deutet sich an, was das BVerfG in seinem Grundsatzurteil vom 19.3.2013 meinte, als es die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer kommunikativen Verhandlungsführung als selbstverständlich bezeichnete (BVerfGE 133, 168, Rn. 106).
2. Bedarf es einer Rechtsgrundlage für Absprachen außerhalb der Verständigung gemäß § 257c StPO? Ausdrücklich thematisieren Sauer/Münkel diese Frage nicht, stehen aber fraglos auf dem Standpunkt, dass das Verständigungsgesetz Absprachen vor der Hauptverhandlung nicht entgegensteht. Das aber ist keineswegs selbstverständlich, ließ doch das BVerfG keinen Zweifel daran, dass Verständigungen nur und ausschließlich gemäß § 257c StPO zulässig sind. Im Ergebnis haben Sauer/Münkel jedoch völlig recht, wenngleich nur unter Modifikation ihrer Definition einer Absprache. Ihre Auffassung widerspricht dem BVerfG nicht und weist auch keinen Weg zur Umgehung des Verständigungsgesetzes in dessen Auslegung. Das folgt wiederum aus der Zulässigkeit einer kommunikativen Verhandlungsführung. Das BVerfG zog die Trennlinie bei der Verbindlichkeit: unverbindlichen Erörterungen auch der Sach- und Rechtslage stehe das Grundgesetz nicht entgegen (BVerfGE 133, 168, Rn. 106). Wiederum völlig zu Recht betonen Sauer/Münkel (Rn. 620), dass der Beschuldigte auf staatsanwaltschaftliche Zusagen zwar i.S. von fair trial vertrauen dürfe, dies aber nur im bestehenden Rechtsrahmen und i.S. vorläufiger Einschätzungen gelte. Das aber bedeutet – und davor warnen Sauer/Münkel (Rn. 103 f.) nicht ohne Grund, dass staatsanwaltschaftlichen Zusagen jenseits des selbstverständlichen Verbots der Irreführung (positiv: fair trial) eben gerade keine Verbindlichkeit innewohnt. Das wiederum ist kein Zufall: Verbindlichkeit kommt einer Entscheidung nur zu, wenn es das Gesetz bestimmt. Das gilt im Ermittlungsverfahren nur für Einstellungen nach § 153a Abs. 1 S. 5 StPO im Fall erfüllter Auflage. Im übrigen trägt jede solcher Absprachen und einseitigen staatsanwaltschaftlichen Zusagen den Charakter lediglich der Vorläufigkeit oder einer Ankündigung, kurz: der Unverbindlichkeit. Das steht zwar einer Definition der Absprache entgegen, welche ein Element der Bindung einschließt, nicht aber einer Vereinbarung, solange sie nur unverbindlich ist und bis zu einer mit Verbindlichkeit versehenen gesetzeskonformen Erklärung auch bleibt.
Erörterung und Verständigung sind demnach selbständige Rechtsinstitute: Eine Erörterung kann, muß aber keineswegs auf eine Verständigung i.S. von § 257c StPO abzielen. Diese Differenzierung gilt nicht nur im Ermittlungsverfahren, sondern allgemein. Sie charakterisiert die Erörterung, ganz gleich, in welchem Stadium sie erfolgt, und trägt, wie § 257b StPO zeigt, bis hinein in die Zeit der Hauptverhandlung: Erörtert werden darf alles – die Grenzen des § 257c StPO gelten nicht. Das schließt es allerdings nicht aus, auf Absprachen vor der Hauptverhandlung, die zwar als solche unverbindlich sind, die aber Folgen zeitigen sollen, die denen einer Verständigung gemäß § 257c StPO gleichen, einzelne Rechtsgedanken dieser Vorschrift entsprechend heranzuziehen. Geboten ist dies etwa bei intendierten Vorleistungen des Beschuldigten. So wird man z.B. verlangen müssen, daß ihn der Staatsanwalt umfassend belehrt, bevor er ein absprachebasiertes Geständnis entgegennimmt, ihn also auch darüber in Kenntnis setzt, daß er die Einhaltung von Zusagen nicht erzwingen kann. Sauer/Münkel (Rn. 103) sehen hierin ein der Lösung harrendes Problem und befürworten (de lege lata oder de lege ferenda?) Ausnahmen von der fehlenden Bindung etwa dergestalt, daß zugesagte Prozeßerklärungen als abgegeben gelten oder der staatsanwaltschaftliche Verstoß gegen faires Verhalten einen eigenständigen Einstellungsgrund bilde. Die auf den Strafanspruch als solchen bezogene, auch nur teilweise unmittelbare Rechtsverbindlichkeit staatsanwaltschaftlicher Zusagen kann aber nie über diejenige einer gerichtlichen Verständigung hinausgehen und dürfte, das Verfahren noch zusätzlich deutlich verkomplizierend, ähnlich festgeschriebene Verfahrensregeln wie § 257c StPO verlangen.
Das, was Sauer/Münkel vielfach unspezifisch Absprache nennen, heißt in der Terminologie des Verständnisgesetzes Erörterung. Sie und die Verständigung sind wesensverschieden: Ersterer wohnt eine Verbindlichkeit inne, die letzterer fehlt. Das sehen auch Sauer/Münkel nicht anders (Rn. 102; mißverständlich Rn. 106 a.E.). Deshalb sind sie völlig zu Recht der Ansicht, daß die Bestimmungen über die Erörterung (im wesentlichen) deklaratorischer Natur sind (Rn. 93, auch 652 und 663). Davon kann im Hinblick auf die Regelungen über die Zulässigkeit von Verständigungen in der Hauptverhandlung nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres die Rede sein. Das gilt auch in Ansehung und Anerkennung der Bedenken der Autoren gegen die Annahme einer Bindungswirkung der zustandegekommenen Verständigung (Rn. 244, 351 f. und 374 f.), die schon entfällt, wenn das Gericht bedeutsame Umstände übersehen hat oder sie hinzutreten. Der erzielten Verständigung fehlt jedoch nicht etwa jegliche Rechtswirkung: Sieht das Gericht die Voraussetzungen des § 257c Abs. 4 S. 1 StPO als gegeben an und will sich deshalb von der Verständigung lösen, so muß es dies in öffentlicher Hauptverhandlung bekanntgeben (vgl. BGH, NStZ 2013, 417 ff., Rn. 23). Die Folge davon besteht in der Unverwertbarkeit des verständigungsbasierten Geständnisses, § 257c Abs. 4 S. 3 StPO (Rn. 244). Damit wohnt aber der gemäß § 257c Abs. 3 StPO erreichten Verständigung eine zumindest vorläufige Bindung des Gerichts inne. Diese fehlt im Falle einer bloßen Erörterung, auch wenn das Gericht (ebenso wie die Staatsanwaltschaft) aus Gründen der Fairneß gehalten ist, eine Abweichung von einer bei einer Erörterung (zumindest einer solchen nach § 257b StPO während oder in der Hauptverhandlung) eingenommenen Rechtsauffassung ebenfalls vor dem Ende der Beweisaufnahme offenzulegen (Rn. 102, 176, 187, 261, 620 und 776). Auch Sauer/Münkel erkennen dem Merkmal der (beabsichtigten) Bindung Bedeutung zu, nämlich bei der Antwort auf die Frage, wann eine informelle und damit rechtswidrige Verständigung vorliegt (Rn. 418 und 420 a.E.). Inhaltlich grenzen sie diese damit gegenüber der zulässigen Erörterung ab. Das Kriterium der Bindung knüpft jedoch nicht an die Rechtswidrigkeit, sondern an die Verständigung als solche an.
Der gesetzliche Begriff der Verständigung beschränkt sich entgegen Sauer/Münkel, Rn. 622 (und passim) nicht allein auf do-ut-des-Vereinbarungen. Eine Verständigung wird in aller Regel ein aufeinander Zugehen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten einschließen. Begriffsnotwendig ist das jedoch nicht (a.A. Rn. 257), insbesondere nicht bei einer Verständigung im Hinblick auf das Prozeßverhalten, also ohne Vorschlag einer Strafspanne. Zulässig ist aber zudem, daß sich das Gericht mit den Beteiligten darüber verständigt, schlicht den Rahmen seiner Strafvorstellung zu offenbaren (was ihm auch im Rahmen einer Erörterung erlaubt wäre). Selbst wenn die Beteiligten nicht zustimmen, eine weitergehende Verständigung also nicht zustande kommt, aber keine weiteren Anträge gestellt werden, darf das Gericht (nach Erfüllung seiner Amtsaufklärungspflicht) ohne vorherigen Hinweis keine Strafe verhängen, die außerhalb des von ihm selbst gezogenen Rahmens liegt. Der Gesetzgeber mag sich von Verständigungen nach § 257c StPO die Schonung der knappen Ressource Justiz versprechen, hat aber die tatsächliche Minderung des Aufwands im konkreten Verfahren nicht zur Voraussetzung für eine zulässige Verständigung gemacht.
Sehr anerkennenswert ist das Bemühen um Beschreibung und Eingrenzung verständigungsfähiger Themen (Rn. 321): Zulässig sei eine Verständigung innerhalb des von ausdrücklichen und impliziten Verboten festgelegten Rahmens immer dann, wenn das Prozessverhalten bei Festlegung der Rechtsfolgen Berücksichtigung finden dürfe. Obwohl dies als Ausgangspunkt sachgerecht erscheint und das Erfordernis der Konnexität (dazu unten V 8) wahrt oder herstellt, dürfte es doch zu eng sein, weil das Gericht eine Gesamtbewertung vorzunehmen hat und z.B. die Wiedergutmachung sonstiger Geschädigter, also solcher aus nicht angeklagten Fällen, ebenfalls mildernd berücksichtigen darf und muß.
V. Aus der Fülle der zahlreich behandelten Einzelthemen und der dazu eingenommenen Positionen können hier nur einige aufgegriffen werden, weil sie entweder für die Praxis oder die Interpretation des Verständigungsgesetzes bedeutsam sind.
1. Die Dokumentationspflicht gemäß § 160b StPO erfaßt auch den gescheiterten Abspracheversuch (Rn. 100). Es ist zwar nicht ersichtlich, welche Bedeutung dies für das weitere Verfahren haben soll, entspricht aber der h.M. und wird für die Mitteilung gemäß § 243 Abs. 4 S. 1 StPO (dazu Rn. 278) vom BVerfG (NJW 2014, 3504 ff. bzw. NStZ 2014, 592 ff.) als Verfassungsgebot angesehen (allerdings nicht in dem Sinne, daß die Verfassung eine Negativmitteilung verlange, sondern nur derart, daß eine andere einfach-gesetzliche Auslegung der strafprozessualen Norm willkürlich i.S. von Art. 3 GG wäre).
2. Aus dem Verbot der Heimlichkeit von Absprachen, erst recht, von Verständigungen, folgern Sauer/Münkel (Rn. 102, auch 106) das Gebot der Hinzuziehung aller Beteiligten. Das bedarf der Spezifizierung. Zum einen ist es weder für Erörterungen noch für Verständigungen zwingend, jedes Gespräch in Gegenwart aller zu Beteiligenden zu führen. Einzelgespräche sind durchaus gestattet. Sie müssen nur anschließend offengelegt und in den Akten dokumentiert werden. Zum anderen ist der Kreis der Beteiligten variabel. Folgt man nicht dem sehr engen Verständnis der Beteiligten als allein diejenigen, die das Verfahren förmlich beeinflussen können (dazu bereits oben zu IV <1>), sondern gestattet der Staatsanwaltschaft in den Fällen des § 160b StPO, dem Gericht bei §§ 202a, 212 und 257b StPO die Erörterung mit allen Personen, die auch über bloße Informationsvermittlung für das Verfahren Relevantes beitragen zu können versprechen, so kann keine Rede davon sein, daß sie alle in jedem Fall der Erörterung beigezogen werden müßten. In abgewandelter Form gilt das auch für Verständigungsgespräche. An ihnen darf ein Nebenklägervertreter teilnehmen. Zwingend ist das jedoch nicht. Da das Zustandekommen einer Verständigung lediglich die Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten zu dem Vorschlag des Gerichts voraussetzt, § 257c Abs. 3 S. 4 StPO, ist nur die Mitwirkung dieser drei Beteiligten unbedingt erforderlich. Das bietet nun allerdings nicht etwa eine Rechtsgrundlage dafür, daß sich das Gericht mit der Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten hinter dem Rücken von dessen Verteidiger verständigen dürfte. Wenn der Angeklagte das wollte, wäre die Justiz daran sowieso nicht gehindert. § 257c Abs. 3 S. 4 StPO zielt aber nicht auf die Umgehung des Verteidigers. Ohne Störung des Vertrauensverhältnisses zum Angeklagten ist er selbstverständlich beizuziehen. Die Regelung zeigt jedoch, daß sich (entgegen OLG Naumburg, NStZ 2014, 116 f.) auch ein unverteidigter Angeklagter verständigen darf (Rn. 261).
3. Im Rahmen einer Verständigung darf weiterhin vom Gericht eine Einstellung gemäß § 154 Abs. 2 StPO und von der Staatsanwaltschaft das Stellen des darauf abzielenden Antrags zugesagt werden. Das gilt aber ausschließlich für eine oder mehrere verfahrensgegenständliche Tat(en), mangels Zuständigkeit des Gerichts aber nicht darüber hinaus (so auch Rn. 338). Diese für eine Verständigung gemäß § 257c StPO geltende Beschränkung hindert aber nicht, daß Verteidigung und Staatsanwaltschaft unabhängig von der Verständigung, wenn auch mit Blick auf diese, bipolar übereinkommen, daß die Staatsanwaltschaft ein weiteres Verfahren (oder auch mehrere) gemäß § 154 Abs. 1 StPO einstellt, wenn es tatsächlich zu einer (rechtskräftigen) Verurteilung gemäß der (zunächst:) in Aussicht genommenen Verständigung kommen sollte. Nur unter dieser Modifikation notwendiger verfahrensrechtlicher Trennung trifft die Auffassung der Autoren zu, insoweit habe sich durch das Verständigungsgesetz nichts geändert (Rn. 135).
4. Der Mehrwert der Rede von informellen Absprachen, Zusagen und gescheiterten Verständigungen in einem Atemzug (Rn. 213, s.a. Rn. 405 ff.) erschließt sich dem Rezensenten nicht. Wohl deshalb vermag er nicht einmal zu sagen, ob die Verfasser diese Ankündigung tatsächlich wahrgemacht und zwischen den drei Phänomenen tatsächlich nicht differenziert haben.
5. Sauer/Münkel halten auch den Verfall, ihn sichernde Maßnahmen nach §§ 111b ff. StPO und ein Fahrverbot für zulässige Gegenstände einer Verständigung (Rn. 254, 320 a.E. mit Fn. 114 und 657 a.E.). Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Wie die Rechtsprechung zum Bewährungsbeschluß zeigt, muß der Angeklagte vor seiner Zustimmung zum Verständigungsvorschlag des Gerichts über sämtliche Rechtsfolgen informiert sein, die ihn im Fall einer Verurteilung treffen. Das dürfte z.B. auch für die Entziehung der Fahrerlaubnis gelten.
Verhält es sich dergestalt, so besteht jedoch eine Kluft zwischen dem Verbot, den Angeklagten mit nicht verständigten Rechtsfolgen zu überraschen einerseits und dem Verbot, sich über den Schuldspruch und über Maßregeln zu verständigen andererseits. Sie läßt sich nur dadurch schließen, daß sich der Vorschlag des Gerichts, § 257c Abs. 3 S. 1 StPO, in zwei Teile mit ganz unterschiedlicher Rechtsqualität zu gliedern hat. Sinnvollerweise voranzustellen sein wird der rein informatorische Teil, in welchem das Gericht die Rechtsfolgen zumindest ihrer Art nach zu erwähnen hat, über die es allein, d.h. unabhängig vom Zustandekommen einer Verständigung im übrigen zu entscheiden hat und entscheiden will. Erst in den nachfolgenden zweiten, den konstitutiven Teil des Vorschlags, sind die Aspekte einschließlich der in Aussicht genommenen Spanne der Rechtsfolgen aufzunehmen, über die eine Verständigung zulässig ist und über die sich zu verständigen das Gericht auch bereit ist. Nur der zweite Teil beruht im Fall ihres Zustandekommens auf der Verständigung, während der erste Teil lediglich die Rahmenbedingungen nennt. Diese bleiben unverbindlich, auch wenn die Verständigung zustandekommt. Allerdings dürfen die Themen des ersten Teils, über die keine Verständigung zulässig ist, Gegenstand einer Erörterung, § 257b StPO, sein. Es bietet sich daher an, zunächst diese Rahmenbedingungen zu erörtern. Diese Erörterung ist protokollpflichtig, § 273 Abs. 1 S. 2 StPO. Darauf kann dann im ersten, dem rein informatorischen Teil des gerichtlichen Verständigungsvorschlags, verwiesen werden. Zu beachten ist dabei allerdings, daß das Gericht, falls es sich im Rahmen der Erörterung zu seinen Vorstellungen über die nicht verständigungsfähigen Rechtsfolgen geäußert haben sollte, von diesen nur abweichen darf, wenn es dies in öffentlicher Hauptverhandlung offengelegt hat.
Da der Verfall als solcher ebenso wie als Wertersatzverfall zwingend ist, kann er nicht Gegenstand einer Verständigung sein. Er gehört daher allein in den informatorischen Teil des Verständigungsvorschlags. Da aber Verfall nicht angeordnet werden darf, ohne daß das Gericht über die Voraussetzungen der Härteklauseln des § 73c StGB entschieden hat, wird zumindest die (Un-)Billigkeit verständigungsfähig sein und damit Eingang in den konstitutiven Teil finden dürfen. Letzteres wird man wohl auch für das Fahrverbot als Neben-, de lege ferenda evtl. auch als Hauptstrafe anzunehmen haben, während die Entziehung der Fahrerlaubnis nicht verständigungsfähig ist (und wohl auch nicht die Dauer der Sperrfrist).
6. Nach Sauer/Münkel (Rn. 279) ist in die Urteilsgründe gem. § 267 Abs. 3 StPO auch eine gescheiterte Verständigung aufzunehmen. Was davon abhängen soll, wird jedoch nicht recht deutlich. Allerdings stehen beide Autoren mit dieser Auffassung nicht allein da und liegt es im Zuge der derzeitigen Skepsis gegenüber der Verständigungspraxis, auch Unnötiges dokumentieren zu müssen. Wie ein Urteil oder auch nur der Strafausspruch nun aber auf einem etwaigen Verstoß beruhen können soll, ist dunkel – ohne daß der Rezensent jedoch über damit begründete Aufhebungen überrascht wäre. Auch für den Ausschluß des Rechtsmittelverzichts, § 302 Abs. 1 S. 2 StPO, soll eine gescheiterte Verständigung genügen (Rn. 284). Das mag so sein, ist aber von der Warnfunktion her nicht geboten.
7. Die Eignung gemäß § 257c Abs. 1 S. 1 StPO an die Erwartung zu knüpfen, ein Geständnis ermögliche ein Urteil (Rn. 307), ist zumindest dann kühn, wenn aus der Notwendigkeit einer nachfolgenden umfassenden Beweisaufnahme auf mangelnde Eignung geschlossen wird. Beide Autoren gehen zwar selbst nicht soweit, halten einen solchen Schluß aber immerhin für möglich. Er kollidierte jedoch mit dem Gebot der umfassenden Prüfung eines verständnisbasierten Geständnisses, falls nicht bereits eine für die Überzeugungsbildung des Gerichts ausreichende Beweisaufnahme vorausgegangen ist. Eignung wird man demnach in einem weiteren Sinne interpretieren müssen und sie immer dann zu bejahen haben, wenn sich das Gericht von einer Verständigung eine wie auch immer geartete Förderung des Verfahrens verspricht. Sie kann auch in einer bloßen Vergewisserung liegen.
8. § 257c Abs. 1 S. 1 StPO gestattet eine Verständigung sowohl über den weiteren Fortgang als auch über das Ergebnis des Verfahrens. Nach § 257c Abs. 2 S. 1 StPO dürfen Gegenstand einer Verständigung nur die Rechtsfolgen, sonstige verfahrensbezogene Maßnahmen sowie das Prozeßverhalten sein. Mißverständlich verlangt § 257c Abs. 2 S. 2 StPO allerdings für grundsätzlich jede Verständigung ein Geständnis. Reduziert man dessen Anwendungsbereich sinnvollerweise auf die Urteilsverständigung, so löst man damit auch die Verbindung zu § 257c Abs. 2 S. 1 StPO. Das öffnet den Blick für den Zusammenhang zwischen § 257c Abs. 1 S. 1 StPO und § 257c Abs. 2 S. 1 StPO. Dessen Alternative Prozeßverhalten läßt sich dann, wozu die Autoren schweigen, mit der Variante einer Verständigung über den Fortgang des Verfahrens, § 257c Abs. 1 S. 1 StPO, verknüpfen. Damit entfällt (entgegen Rn. 325) die Verbindung zwischen Prozeßverhalten und Urteilsverständigung. Auf diese Weise ist das Gebot der Konnexität (Rn. 328, auch 336 – 338) gewahrt und quälerische Überlegungen, ob es rechtlich zulässige Verbindungen zwischen Prozeßverhalten und Urteilsverständigung überhaupt geben kann (Rn. 322 – 328), stellen sich nicht mehr.
9. Mit der Auffassung, auf ein dem Verwertungsverbot nach § 257c Abs. 4 S. 4 StPO unterliegendes Geständnis dürfe auch nicht zu Lasten von Mitangeklagten zurückgegriffen werden (Rn. 378), vertreten die Autoren die h.M. Damit werden Dritte begünstigt, die an der Verständigung nicht beteiligt waren. Der Zweck, Schutz dessen, der sich nur der Verständigung wegen geständig eingelassen hat, verlangt dies allerdings nicht. Im Regelfall würde sich aber auch mit einer Verwertung des Geständnisses wenig ändern, denn ein quasi widerrufenes, rein verständnisbasiertes Geständnis birgt wenig bis keinen Erkenntniswert, auf den sich zu Lasten eines Dritten irgendetwas strafprozessual stützen ließe. Ein Unterschied besteht selbst dann nur (oder zumindest im wesentlichen) konstruktiv, wenn das Geständnis zu neuen Tatsachen und/oder Beweismitteln führte: Mangels Fernwirkung des Verwertungsverbots dürfen derartige Erkenntisse trotz Unverwertbarkeit des Geständnisses selbst in den Prozeß eingeführt werden.
10. Sauer/Münkel sehen ein Problem darin, daß die Staatsanwaltschaft entgegen ihrer Zusage im Rahmen einer Verständigung den Antrag auf Teil-Einstellung gemäß § 154 Abs. 2 StPO nicht stellen könnte, obwohl der Angeklagte sein Geständnis bereits abgelegt hat. Realistisch wird eine solche Verhaltensweise nur zu erwarten sein, wenn Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, ob die Äußerungen des Angeklagten als Geständnis angesehen werden können. Als Lösung schlagen beide vor, daß die Staatsanwaltschaft mit ihrem Antrag in Vorleistung trete. Diese Reihenfolge führt aber ebenfalls nicht zu einer größeren Sicherheit des Angeklagten, weil sowohl die Staatsanwaltschaft ihren Antrag wieder zurücknehmen als auch das Gericht sich der Bewertung der Staatsanwaltschaft anschließen kann. Der Beschuldigte muß daher mit diesem (von ihm selbst wesentlich beeinflußbaren) Risiko leben. Die Lösung sieht das Gesetz allein im auf die Lösung von der Verständigung folgenden Verwertungsverbot, § 257c Abs. 4 S. 4 StPO.
11. Die Unzulässigkeit, sich über das Vorliegen eines minderschweren Falles verständigen zu dürfen, führt die Autoren zu dem Vorschlag, sich auf der Basis eines Normalfalls zu verständigen und dem Gericht zu raten, sich von der Verständigung zu Gunsten des Angeklagten zu lösen, wenn das nachfolgende Geständnis Anhaltspunkte für die Annahme eines minder schweren Falles biete (Rn. 393). Damit allein ist es aber nicht getan, weil mit der Abstandnahme das Geständnis unverwertbar wird. Nur wer allein die Verwertung zu Lasten des Angeklagten verneint, sie zu seinen Gunsten aber zuläßt, hat hier kein Problem. Alle anderen müssen sich weitere Schritte überlegen. Sie können in einer neuerlichen Verständigung auf niedriger Basis liegen oder darin bestehen, daß von vorn herein zwei Spannen ins Auge gefaßt werden, die eine bei Bejahung des Normal-, die andere bei Annahme eines minder schweren Falls. Auf der Basis des Vorschlags von Sauer/Münkel hat es aber auch der Angeklagte in der Hand, sich selbst zu helfen: er kann sein Geständnis ganz oder teilweise wiederholen und sich damit völlig unabhängig von einer Verständigung einen Strafmilderungsgrund verschaffen. Hinzu kommt, daß die Frage des Vorliegens eines minderschweren Falls Gegenstand einer Erörterung gemäß § 257b StPO sein darf. Sie führt zwar zu keinen (bindenden) Ergebnissen, erlaubt aber den Verfahrensbeteilgten, ihr Prozeßverhalten auf die darin gewonnenen Erkenntnisse zu stützen.
VI. Der Lesegenuß wäre ungeschmälert, kämen die sorgfältigen, von tiefer Sachkenntnis der klugen, weil eindimensionalem Denken abholden Autoren zeugenden Gedanken auch in einem damit korrespondierenden Gewande daher. Vermutlich ist es eine Art Agio auf den sehr günstigen Preis, daß der Nutzer ein diese Bezeichnung rechtfertigendes Stichwortverzeichnis, der Leser nicht nur manche Korrektur schmerzlich vermißt und sich der Verdacht nicht unterdrücken läßt, bestimmte Worte einer Passage seien, was nie ganz vermeidbar ist, vom Schreibprogramm oder der Schreibkraft nicht genau verstanden worden, ohne daß dies aber kontrolliert, geschweige denn korrigiert worden wäre, sondern sich auch nach den Zeiten zurücksehnt, in denen es noch Lektoren gab, die für die Lesbarkeit Sorge trugen. Stilmängel (Der Revisionsführer tut … schildern, Rn. 391) und Sinnentstellendes (Sodann wird die Entscheidung des BVerfG vom 19.3.2013 verworfen <anstatt: auf sie verwiesen>, Rn. 423) stören nur punktuell, auch wenn sie sich in ähnlicher Weise wiederholen (Beispiele: Rn. 317, 617, 620, 655, 683 und 766). Zu verschmerzen ist auch, daß kurz vor der Schlußbetrachtung (ab Rn. 819) der Hoffnung Ausdruck verliehen wird, die Lektüre der folgenden Hinweise möge dem Leser Gewinn bringen (Rn. 818) – eine Formulierung, die man eher im Vorwort erwarten dürfte.
Weniger leicht nimmt es der Leser hingegen, wenn ihn (insbesondere in den ersten beiden Teilen) nicht nur eine Fülle von Hinweisen auf nachfolgende, vertiefende Ausführungen begleiten, sondern diese sich dort zwar finden, aber inhaltlich manchmal gar nicht wirklich weiterführen, und diese Darstellungstechnik zudem teilweise zu ersichtlich vermeidbaren Wiederholungen führt. Für die gewiß und hoffentlich nicht erst in 6 Jahren zu erwartende Neuauflage ist zu wünschen, daß unter teilweise radikaler Kürzung im Interesse einer verbesserten Konzentration zusammengeführt wird, was zusammengehört, sich bislang aber an unterschiedlichen Stellen findet. Da aufgrund nachlassender Aktualität sicherlich auch die Ausführungen pro & contra Absprache ebenso wie die Darstellung der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Verständigungsgesetzes knapper ausfallen können, sei hier zudem der Wunsch geäußert, daß der gewonnene Platz durch Aufnahme eines neuen Teils gefüllt werde, der sich der Kooperation zwischen Justiz und Verteidigung bei Führen von Internal Investigations widmet.
VII. Als Fazit läßt sich festhalten: Ungeachtet der angeführten, die äußere Darstellung betreffenden Wünsche handelt es sich um ein hochaktuelles Werk, das insbesondere für den als Verteidiger aktiven Nutzer, an den es sich vorrangig wendet, eine Fülle wertvoller Tipps bereithält, sich darauf aber keineswegs beschränkt, sondern jeden Leser, unabhängig von seiner Profession, ebenso zum Nach- wie aufgrund steter Anregungen auch zum Weiterdenken sowohl über Phänomene des Konsenses im Strafverfahren als solche als auch über das Verständnis des geltenden Rechts anregt.