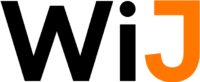Chowdhury, Tobias, Geschäftsleiteruntreue vor dem Hintegrund von subprime-Investments im Vorfeld der Finanzkrise – Zugleich ein Beitrag zur Bedeutung des Aufsichtsrechts für die Konkretisierung gesellschaftsrechtlicher Sorgfaltsmaßstäbe, Berlin 2
(Dissertation Wintersemester 2012/2013), 311 S., 79,90 €
I. Eine Dissertation für die Praxis: schon das ist verdienstvoll. Eine fächerübergreifende Dissertation, geschrieben auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage, aber mit Blick auf die Untreue: Einer der seltenen Ausbrüche aus dem Ghetto des eigenen Fachs! Dank gebührt daher auch den Göttinger Professoren Spindler als Doktorvater und Murmann als nur formaler Zweitgutachter, wie ihn Chowdhury im Vorwort aufgrund seiner inhaltlichen Verdienste als strafrechtlicher quasi-Alleingutachter selbst bezeichnet. Da der Leser schnell erkennt, daß Chowdhurys Heimat das Zivilrecht ist, muß der vom strafrechtlichen Blick geprägte Rezensent allerdings sogleich um Nachsicht bitten, weil dieser unterschiedliche background die Ursache dafür sein könnte, dass ihm sowohl das Verständnis für manche Argumentation Chowdhurys verschlossen blieb, als auch er so etwas wie einen roten Faden erst bei der abschließenden Lektüre des zusammenfassenden 6. Teils (S. 282 – 287) entdeckte. Der unterschiedliche berufliche Hintergrund verlangt vom Rezensenten Zurückhaltung bei der Bewertung und die Konzentration auf die Dokumentation.
Teil 1 befaßt sich mit der Unternehmerischen Entscheidung des Geschäftsleiters (S. 27 – 61). Es folgt Teil 2 mit der Überschrift Geschäftsleiterhandeln im akzessorischen Untreuetatbestand (S. 62 – 103). Der schwerpunktmäßig gesellschaftsrechtliche Teil 3 sucht nach Anknüpfungspunkten pflichtverletzenden Verhaltens beim Investment in subprime-Papiere (S. 104 – 191), während der hauptsächlich strafrechtliche Teil 4 Weiteren Aspekten der Untreuestrafbarkeit aufgrund des Erwerbs von subprime – Wertpapieren gewidmet ist (S. 192 – 256). In Teil 5 versucht sich der Autor in einer Art Außenblick auf Subprime-Investments und Untreuetatbestand vor kriminalpolitischem Hintergrund (S. 257 – 281).
II. Chowdhurys Überlegungen setzen beim unternehmerischen Handeln eines Organs (S. 27 – 57) und damit bei § 76 Abs. 1 AktG bzw. 37 Abs. 1 GmbHG an. Die damit normierte Verantwortlichkeit finde allein im safe harbour des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG, im GmbH-Recht entsprechend anwendbar, eine Ausnahme (S. 29). Das gesetzliche Mittel bestehe darin, dass innerhalb des unternehmerischen Handelns (einschließlich Rechtsunsicherheiten, S. 35 – 45) lediglich bestimmte verfahrensrechtliche Kautelen einzuhalten seien: jede auf solcher Basis getroffene Entscheidung sei, unabhängig von ihrem Inhalt, gesellschaftsrechtlich in Ordnung. Bereits vor dem Inkrafttreten des UMAG und damit der Einfügung des jetzigen § 93 AktG in das geschriebene Recht (S. 28) habe die Diskussion über die strafrechtliche Beurteilung unternehmerischer Entscheidungen unter dem Stichwort des Risikogeschäfts eingesetzt (S. 57 – 61). Nunmehr sei streitig, ob es strafrechtlich ebenso ausschließlich auf die Einhaltung formeller Schritte ankomme, oder ob eine unter Einhaltung aller verfahrensrechtlicher Erfordernisse getroffene Entscheidung auch allein aufgrund ihres unvertretbaren Inhalts als Untreue bestraft werden könne.
1. Für das Unternehmerische als Teilbereich des Geschäftsleiterhandelns bestimmen nach Chowdhury allein und damit abschließend die Sorgfaltsgeneralklauseln des § 93 AktG den rechtlichen Rahmen. Demgemäß bleibe insoweit für § 266 StGB und damit für ein originär strafrechtlich begründetes allgemeines Schädigungsverbot kein Raum (S. 64 – 91, insbes. 74 f., 83, 86 und 88, für § 266 StGB im Verhältnis zu § 25a KWG und den MaRisk S. 205 f.). Der Ausgangspunkt ist fraglos sachgerecht: was zivilrechtlich zulässig ist, kann vom Strafrecht nicht sanktioniert werden. Dementsprechend kommt es tatsächlich darauf an, wieweit das Primärrecht abschließenden Charakter aufweist oder nicht (S. 68).
a) Sehr feinsinnig betrachtet Chowdhury die Vermögensbetreuungspflicht des § 266 StGB als Teil-Schnittmenge der gesellschaftsrechtlichen (ergänzt von den allgemeinen, S. 85 f.) Sorgfaltsanforderungen, ohne dass allerdings Letztere beide geschaffen worden wären, um § 266 StGB zu konkretisieren (S. 74 f.). Handeln, das die formellen Erfordernisse des Zivilrechts wahre, falle damit aus dem Anwendungsbereich der Untreue heraus, ohne daß die bloße Verletzung verfahrensrechtlicher Vorschriften umgekehrt strafbarkeitsausweitend wirke (S. 85 f.). Wolle man dies anders sehen, so führte dies zu unauflösbaren Widersprüchen (S. 213 – 220): Die Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen wäre dann nicht zu verhindern. Ferner müßte notwendigerweise auf Risikoerhöhung abgestellt werden, während § 266 StGB angesichts des Rechtsguts auf Vermeidung einer Verletzung ziele. Damit würde lediglich eine Gefährdung sanktioniert. Zudem fände ein Austausch des Rechtsgutsträgers statt: nicht mehr die Notwendigkeit der Wahrung des Rechtsguts, das betreute Vermögen, stünde inmitten, sondern die Einhaltung staatlich gesetzter formeller Regeln.
So zutreffend es im Ergebnis ist, daß § 266 StGB nicht die Verletzung allein von Formalia pönalisiert, so zweifelhaft fällt Chowdhurys Begründung aus. Seine Befürchtungen sind nämlich strafrechtlich weder durchweg überzeugend noch zwingend. Letzteres träfe nur zu, stellte man fälschlicherweise tatsächlich allein auf den Formalverstoß ab: ein lukratives Geschäft wird aber nicht dadurch ungetreu, dass es unter Verstoß gegen innergesellschaftsrechtliche Zeichnungsbefugnisse verstieß. Ersteres träfe hingegen nur dann zu, hätte ein Risiko keinen Einfluß auf den Wert. Das aber behauptet auch Chowdhury nicht, der für die zulässige Risikobereitschaft zutreffend auf das Innenverhältnis abstellt (S. 178 f.).
b) Daß die alleinige Verletzung verfahrensrechtlicher Erfordernisse des Zivilrechts keine Untreue sein kann, ist daher angesichts des Rechtsguts des § 266 StGB zwingend. Dagegen hindert bei nicht determiniertem Handeln die Einhaltung sämtlicher formeller Gebote des Sachrechts eine Bestrafung nur auf Basis der Prämisse von dessen abschließendem Charakter. Eben diese ist jedoch angesichts des vermögensschützenden Charakters des § 266 StGB sehr fraglich, zumindest begründungsbedürftig – und lässt sich bereits zivilrechtlich nicht durchhalten. Auch Chowdhury benötigt im Fall verletzter Verfahrensvorschriften inhaltliche Beurteilungskriterien. Natürlich übersieht er das nicht, siedelt sie jedoch jenseits des safe harbour unternehmerischer Entscheidungen an (z.B. S. 226 zum existenzvernichtenden Eingriff und S. 214 mit Fn. 115 und S. 231 – 234 zum Fall eines nicht im Interesse des betreuten Vermögens liegenden Handelns). Voneinander abweichende strafrechtliche Ergebnisse wurzeln aber wohl kaum in der Verortung inhaltlicher Kriterien innerhalb oder außerhalb des Bereichs unternehmerischer Entscheidungen i.S.v. § 93 Abs. 1 S. 2 AktG. Bei Übereinstimmung in der Notwendigkeit, Geschäftsleiterverhalten überhaupt (und zunächst unbeschadet des Umfangs) nach inhaltlichen Kriterien rechtlich einordnen zu müssen, wäre es interessant, der Frage nachzugehen, ob Zivil- und Strafrecht auf ihren je eigenen Wegen überhaupt zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Nur dann bestünde nämlich ein lösungsbedürftiger Konflikt. Diesem Thema widmet sich Chowdhury mit seinem wissenschaftlich-systematischen Interesse jedoch leider nur am Rande, so, wenn er völlig zu Recht konstatiert, dass bereits das Zivilrecht der Einhaltung der Form keine Erlaubnis zum Ausplündern zumesse (S. 214 m. Fn. 115 und S. 231 – 234) und (zu Unrecht: ausschließlich) das Gesellschafts- und Aufsichtsrecht strafrechtliche Pflichten zu konkretisieren geeignet sei (S. 225).
Auch beim sicher notwendigen Anerkennen des Prä des Zivilrechts bleibt Raum für spezifisch strafrechtliche Wertungen. Nur dort, wo das Zivilrecht eine verbindliche Entscheidung enthält, ist sie auch strafrechtlich anzuerkennen. Ist das jedoch nicht der Fall, bedeutet das allerdings keineswegs zwingend das Vorhandensein eines rechtsfreien Raums. Vielmehr besteht insoweit die Möglichkeit des Setzens von Maßstäben mit strafrechtlichen Mitteln. Eine generelle Normenhierarchie, die den Strafbestimmungen allein ihres Charakters wegen den bereichsspezifischen Nachrang gegenüber zivilrechtlichen Vorschriften zuweisen würde, existiert nicht. Strafvorschriften können daher dort, wo sie nicht im Widerspruch zu zivilrechtlichen Regeln stehen, neben diesen anwendbar sein – und damit auf diese Weise zugleich auch das zivilrechtliche Pflichtenprogramm ergänzend beeinflussen, d.h. erweitern. Originär strafrechtliche Grenzen werden auf diese Weise in das Zivilrecht inkorporiert, so dass dadurch die Einheit der Rechtsordnung nicht in Frage steht. Mit der Bindung an die Erfordernisse der Wahrung des Rechtsguts entfällt zudem in der Folge die Notwendigkeit, sich interessenwidrig an die Formerfordernisse des Zivilrechts und des Aufsichtsrechts anzulehnen (v.a. S. 104 – 221, dazu insbes. unten III 1).
2. Unter dem rechtlichen Aspekt des Bestimmtheitsgebots, Art. 103 Abs. 2 GG, bemerkenswert ist die Auffassung Chowdhurys, der Strafrichter habe zwar auch außerstrafrechtliche Gesetze auszulegen, wie es § 262 Abs. 1 StPO ausdrücklich bestimmt, sei dabei aber an die h.M. im Sachrecht gebunden. Dagegen habe der 3. Strafsenat in seiner Mannesmann-Entscheidung (BGHSt 50, 331 ff.) verstoßen. Chowdhury nimmt damit einen Gedanken auf, den das Bundesverfassungsgericht in seiner Untreueentscheidung vom 23.6.2010 (BVerfGE 126, 170 ff., Rn. 110) fruchtbar machte: Das strafrechtliche Rückwirkungsverbot gilt grundsätzlich auch für Änderungen der Rechtsprechung. Einzelheiten dazu sind zwar noch weitgehend ungeklärt. Eine Pauschalierung verbietet sich allerdings. Das fängt bereits bei der Frage an, wie sich denn die h.M. feststellen lassen soll. Hat die Literatur darauf Einfluß? Oder ist nur die Rechtsprechung maßgeblich? Kommt es bei ihr nur auf höchstrichterliche Entscheidungen an? Und wie steht es, wenn sich zwar nicht das (Straf-)Gesetz, wohl aber das normative Umfeld gegenüber einer älteren Entscheidung geändert hat? Und wie hat sich ein Strafgericht zu verhalten, das erstmals mit einer bestimmten Rechtsfrage befaßt ist – noch bevor ein für das Sachrecht zuständiges Gericht sich positionieren konnte? Chowdhury ist sicherlich insoweit zuzustimmen, als man ohne gefestigte Rechtsprechung niemandem einen Vorwurf machen kann, stellt er sich auf einen vertretbaren Standpunkt. Eine weiterreichende Zurückhaltung ist jedoch nicht geboten.
3. In strafrechtlicher Hinsicht verneint Chowdhury eine lediglich limitierte Akzessorietät der äußersten zivilrechtlichen Grenzen rechtmäßigen Verhaltens (S. 92 – 97 und 211 – 213). Damit spricht er sich dagegen aus, zwischen zivil- und strafrechtlicher Unzulässigkeit einen Filter einzubauen, demzufolge nur gravierende (zivilistische) Verstöße repressiver Ahndung zugänglich seien. Mit dieser Auffassung geht Chowdhury weit über die Rechtsprechung hinaus. Er dürfte damit deren berechtigtes Interesse verkennen: Nicht etwa sollen die äußersten Grenzen zivilrechtlich zulässigen Ermessens hinausgeschoben werden. Enthält das Sachrecht selbst aber bereits die Höhenmarke der Vertretbarkeit, so bedarf es nicht noch zusätzlich der Überwindung einer vom Strafrecht aufgestellten Hürde. Im Ergebnis nicht anders liegt es bei strikten Verboten. Sind jedoch vor einer Entscheidung verschiedene verfahrensrechtliche Schritte einzuhalten, zum Teil in liebevoller bürokratischer Kleinteiligkeit normiert, so kann und darf nicht bereits jede Missachtung einer solchen (durchaus vermögensbezogenen) Pflicht die Basis für eine Bestrafung bilden. Es wäre allerdings unfair, Chowdhury zu unterstellen, die Strafbarkeit in diesem Sinne ausweiten zu wollen. Die Notwendigkeit eines Rechtswidrigkeitszusammenhangs und des Gebots der Eliminierung der Verletzung solcher Pflichten aus dem Untreuetatbestand, die nicht spezifisch (zumindest auch) auf die Vermögenssicherung ausgelegt sind, machen es jedoch m.E. nicht überflüssig, Lässlichkeiten aus dem Tatbestand fernzuhalten, wenn und soweit nicht bereits das Sachrecht zwischen schwerpunktmäßig formellen und unverzichtbaren Pflichten unterscheidet. Es lässt sich zwar jeder einzelne, auch der bloße Formalverstoß vermeiden. Im Drange der Geschäfte und der damit erforderlichen Bildung von Schwerpunkten ist aber völlige Fehlerfreiheit nicht zu erreichen. Die Missachtung unrealistischer Sollensanforderungen darf jedoch schon diesseits der Unmöglichkeit nicht allein für sich und damit unterschiedslos pönalisiert werden.
III.
1. Im Hinblick auf seine Ansicht von der Einheitlichkeit der Rechtswidrigkeitsschwelle im Zivil- und im Strafrecht konsequent plädiert Chowdhury auch im Hinblick auf den Erwerb von subprime-Papieren für einen gemeinsamen Maßstab (S. 104 – 120). Bis zur Finanzkrise habe die Anlage in solche Titel nicht gegen aufsichtsrechtliche Vorgaben verstoßen (S. 120). Die heutigen §§ 18a und b KWG (dazu S. 187 – 191) gab es seinerzeit noch nicht.
Chowdhury wendet sich anschließend der Frage zu, ob sich aufsichtsrechtliche Maßstäbe überhaupt auf das Zivilrecht und damit in der Folge auch auf das Strafrecht übertragen ließen. Er vertritt dazu die pfiffige Auffassung, dass der regelnde Staat den Handelnden nicht allein lassen dürfe, dieser also auf die Rechtmäßigkeit seines Handelns vertrauen können müsse, wenn er einschlägige Regeln, soweit sie reichen, einhalte. So verständlich diese Position aus der Sicht des Handelnden ist, so einseitig ist sie aber gerade auch deswegen. Was im Verhältnis zur Aufsicht, also zum Staat, genügt, muss allein deshalb aber noch lange nicht zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Gleichgeordneten – und das sind de jure Geldinstitute und Anleger – führen. Es ist sogar noch weiter zu differenzieren: was verwaltungsrechtlich genügt, muss strafrechtlich keineswegs ausreichen, weil hier nicht das Allgemeininteresse, sondern der Rechtsgüterschutz maßgeblich ist. Dieser wird jedoch weitgehend vom Zivil-, und nicht vom Aufsichtsrecht gestaltet und geprägt.
Demgegenüber befürwortet Chowdhury – trotz ausgeführter Zweifel – die direkte Übertragung des § 25a KWG nebst MaRisk in aktueller Fassung auf das Strafrecht (S. 205 f.). Dem stehen die genannten systematischen Bedenken entgegen, nicht aber Chowdhurys Ansatz von der Maßstabsgleichheit: Die Zivilgerichte betrachteten die Einhaltung der Vorschriften der §§ 18 und 25a KWG (anders als im Falle der §§ 10 ff., 11 und 13 ff. KWG) als gesellschaftsrechtlich haftungsbefreiend (S. 153 – 159). Wiewohl ihm dies zu weit geht, will er für den Bereich des Risikomanagements der Einhaltung der öffentlich – rechtlichen Vorgaben starke Bedeutung für den subjektiviert definierten safe harbour, übertragbar auch auf das Strafrecht, beimessen. Ein derart eng verflochtenes Zivil- und Gesellschaftsrecht dürfte dann aber wohl konsequenterweise auch (und damit deutlich über die bisherige Rechtsprechung hinaus) den Anlegern als Haftungstatbestand bei Verletzung originär aufsichtsrechtlicher Pflichten dienen.
2. Als Ersatz für das vor der Finanzkrise unterbestimmte Aufsichtsrecht befürwortet Chowdhury den Maßstab der Üblichkeit (S. 169 und 179). Das führt ihn zu der (m.E. äußerst zweifelhaften) Feststellung, dass man sich seinerzeit habe auf externe Ratings verlassen dürfen (S. 184 – 187 und 191). Klumpenrisiken seien (auch jetzt noch?) nicht generell verboten (S. 165 f., 171 f. und 174 – 176). Und auch im Fall existentieller Risiken sei zu differenzieren (S. 169 – 180) und zwar zwischen Risikoerkenntnis und Risikobereitschaft (z.B. S. 178 f.). Letzteres zumindest ist sicherlich zutreffend, ebenso wie die Einsicht, dass die Grenzen der Zulässigkeit des Eingehens von Risiken vom Binnenverhältnis zum betreuten Vermögen konstituiert werden. Diese dürfen legal nur mit individueller Zustimmung des Vermögensinhabers überschritten werden.
3. Untreue in der Finanzkrise hält Chowdhury nur im Wege des existenzvernichtenden Eingriffs oder der Verletzung proceduraler Vorschriften für möglich (S. 226) – und verneint beides! Dem zu widersprechen ist nur möglich, verwirft man die Lehre sowohl von der reinen Akzessorietät des Strafrechts als auch der Irrelevanz des Inhalts der getroffenen Entscheidung. Darin liegt zwar keine Bestätigung für die Notwendigkeit dieses Verwerfens, belegt aber nicht nur die Bedeutung der dogmatischen Differenzen, sondern immerhin auch die Plausibilität dieser von Chowdhury abgelehnten Ansätze.
4. Im Hinblick auf den subjektiven Tatbestand vertritt Chowdhury die Auffassung, das Eingeständnis, das Konstrukt der subprime-Investments nicht durchschaut zu haben, führe noch nicht einmal zum Vorliegen des kognitiven Vorsatzelements (S. 238). Das erscheint zumindest erklärungsbedürftig: Der procedurale Ansatz führt auch innerhalb des von § 93 Abs. 1 S. 2 AktG beschriebenen Rahmens nur dann wirklich in einen safe harbour, wenn Entscheidungen auf ausreichender Informationsbasis getroffen wurden. Bereits zivilrechtlich ist es sicher nicht rechtmäßig, Investitionsentscheidungen in nennenswertem Umfang trotz verbliebenen Unverständnisses zu treffen, und zwar auch dann, wenn man die existentiellen und/oder Milliardenrisiken nicht einmal erahnte (aktuell: Sal. Oppenheim). Zutreffend ist es hingegen, das voluntative Vorsatzelement nicht allein aufgrund erkannter Notwendigkeit von Absicherungsgeschäften als bewiesen anzusehen (S. 240 f.). Sie sollten ja gerade verhindern, dass sich das den Gewinnerwartungen gegenüberstehende Verlustrisiko realisierte. Sie müssen demgemäß als Einheit mit der Investitionsentscheidung betrachtet werden.
Nachdem Chowdhury es auch noch abgelehnt hat, aus der Anreizfunktion der Boni für kurzfristige Erfolge auf die Inkaufnahme langfristiger Nachteile zu schließen (S. 241 – 248), was zumindest insoweit plausibel ist, dass allein ein solch abstrakter Anreiz nun keineswegs genügen kann, wandte er sich möglichen Irrtumsfragen zu (S. 248 – 256). Im Gegensatz zur Mannesmann-Entscheidung (BGHSt 50, 331 ff.) gelangte er durchweg zur Anwendbarkeit des § 16 StGB, dem Tatbestandsirrtum, der mangels Fahrlässigkeitsstrafbarkeit zur Straflosigkeit führt.
IV. Äußerst sympatisch ist, dass Chowdhury seine moralischen Skrupel über das von ihm gefundene Ergebnis offenlegte. Das ist unter Juristen alles andere als verbreitet. Allerdings verfügt er über ausreichend Argumentationsstärke, um diese Zweifel hinter die Rationalität des von ihm für richtig gefundenen strafrechtlichen Ergebnisses zurücktreten zu lassen (S. 257 – 281). In Abgrenzung zum Strafrecht befürwortet er den Weg verstärkter Aufsicht.
Die Arbeit ist eine beispielhafte Bestätigung, wie berechtigt die Warnung ist, doch bitte vor lauter Bäumen den Wald nicht zu übersehen! Zahlreiche Argumente für ins strafrechtliche Visier geratene Verantwortliche von Geldinstituten, von sehr abstrakt bis in Verästelungen konkret, verfasst von einem systematisch denkenden, hochintelligenten und dazu erfreulicherweise auch noch skrupulösen Autor: Hätte er doch nur auch noch den Mut aufgebracht, eigene Plausibilitätsüberlegungen anzustellen: Papiere, die auf Sand gebaut sind, müssen irgendwann ‚platzen‘. Das zu erkennen, braucht man weder ein Jura- noch ein betriebswirtschaftliches Studium. Sollte beides dazu führen, einfache Weißheiten zu verkennen, so wäre das schlimm, stellte aber keinen Rechtfertigungsgrund dar: weder für die genannten Professionen noch für die (englisch ausgesprochenen) Banker, die sich nicht als (deutsch ausgesprochene) Banker verhielten. Behaupte niemand, er hätte nichts gewusst: Dem Rezensenten wurde seit Aufkommen der verbrieften Subprime – Kredite immer wieder vom Erwerb entsprechender Papiere abgeraten, und zwar unter Hinweis auf die schlichte Wahrheit ihrer realen Wertlosigkeit! Natürlich könnte man das unter Hinweis darauf abtun, man habe den Gewinn selbst machen und nicht mit Kunden teilen wollen: glaubhaft wäre das nicht – nicht bei gegebener völlig richtiger Begründung!
(Dissertation Wintersemester 2012/2013), 311 S., 79,90 €
I. Eine Dissertation für die Praxis: schon das ist verdienstvoll. Eine fächerübergreifende Dissertation, geschrieben auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage, aber mit Blick auf die Untreue: Einer der seltenen Ausbrüche aus dem Ghetto des eigenen Fachs! Dank gebührt daher auch den Göttinger Professoren Spindler als Doktorvater und Murmann als nur formaler Zweitgutachter, wie ihn Chowdhury im Vorwort aufgrund seiner inhaltlichen Verdienste als strafrechtlicher quasi-Alleingutachter selbst bezeichnet. Da der Leser schnell erkennt, daß Chowdhurys Heimat das Zivilrecht ist, muß der vom strafrechtlichen Blick geprägte Rezensent allerdings sogleich um Nachsicht bitten, weil dieser unterschiedliche background die Ursache dafür sein könnte, dass ihm sowohl das Verständnis für manche Argumentation Chowdhurys verschlossen blieb, als auch er so etwas wie einen roten Faden erst bei der abschließenden Lektüre des zusammenfassenden 6. Teils (S. 282 – 287) entdeckte. Der unterschiedliche berufliche Hintergrund verlangt vom Rezensenten Zurückhaltung bei der Bewertung und die Konzentration auf die Dokumentation.
Teil 1 befaßt sich mit der Unternehmerischen Entscheidung des Geschäftsleiters (S. 27 – 61). Es folgt Teil 2 mit der Überschrift Geschäftsleiterhandeln im akzessorischen Untreuetatbestand (S. 62 – 103). Der schwerpunktmäßig gesellschaftsrechtliche Teil 3 sucht nach Anknüpfungspunkten pflichtverletzenden Verhaltens beim Investment in subprime-Papiere (S. 104 – 191), während der hauptsächlich strafrechtliche Teil 4 Weiteren Aspekten der Untreuestrafbarkeit aufgrund des Erwerbs von subprime – Wertpapieren gewidmet ist (S. 192 – 256). In Teil 5 versucht sich der Autor in einer Art Außenblick auf Subprime-Investments und Untreuetatbestand vor kriminalpolitischem Hintergrund (S. 257 – 281).
II. Chowdhurys Überlegungen setzen beim unternehmerischen Handeln eines Organs (S. 27 – 57) und damit bei § 76 Abs. 1 AktG bzw. 37 Abs. 1 GmbHG an. Die damit normierte Verantwortlichkeit finde allein im safe harbour des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG, im GmbH-Recht entsprechend anwendbar, eine Ausnahme (S. 29). Das gesetzliche Mittel bestehe darin, dass innerhalb des unternehmerischen Handelns (einschließlich Rechtsunsicherheiten, S. 35 – 45) lediglich bestimmte verfahrensrechtliche Kautelen einzuhalten seien: jede auf solcher Basis getroffene Entscheidung sei, unabhängig von ihrem Inhalt, gesellschaftsrechtlich in Ordnung. Bereits vor dem Inkrafttreten des UMAG und damit der Einfügung des jetzigen § 93 AktG in das geschriebene Recht (S. 28) habe die Diskussion über die strafrechtliche Beurteilung unternehmerischer Entscheidungen unter dem Stichwort des Risikogeschäfts eingesetzt (S. 57 – 61). Nunmehr sei streitig, ob es strafrechtlich ebenso ausschließlich auf die Einhaltung formeller Schritte ankomme, oder ob eine unter Einhaltung aller verfahrensrechtlicher Erfordernisse getroffene Entscheidung auch allein aufgrund ihres unvertretbaren Inhalts als Untreue bestraft werden könne.
1. Für das Unternehmerische als Teilbereich des Geschäftsleiterhandelns bestimmen nach Chowdhury allein und damit abschließend die Sorgfaltsgeneralklauseln des § 93 AktG den rechtlichen Rahmen. Demgemäß bleibe insoweit für § 266 StGB und damit für ein originär strafrechtlich begründetes allgemeines Schädigungsverbot kein Raum (S. 64 – 91, insbes. 74 f., 83, 86 und 88, für § 266 StGB im Verhältnis zu § 25a KWG und den MaRisk S. 205 f.). Der Ausgangspunkt ist fraglos sachgerecht: was zivilrechtlich zulässig ist, kann vom Strafrecht nicht sanktioniert werden. Dementsprechend kommt es tatsächlich darauf an, wieweit das Primärrecht abschließenden Charakter aufweist oder nicht (S. 68).
a) Sehr feinsinnig betrachtet Chowdhury die Vermögensbetreuungspflicht des § 266 StGB als Teil-Schnittmenge der gesellschaftsrechtlichen (ergänzt von den allgemeinen, S. 85 f.) Sorgfaltsanforderungen, ohne dass allerdings Letztere beide geschaffen worden wären, um § 266 StGB zu konkretisieren (S. 74 f.). Handeln, das die formellen Erfordernisse des Zivilrechts wahre, falle damit aus dem Anwendungsbereich der Untreue heraus, ohne daß die bloße Verletzung verfahrensrechtlicher Vorschriften umgekehrt strafbarkeitsausweitend wirke (S. 85 f.). Wolle man dies anders sehen, so führte dies zu unauflösbaren Widersprüchen (S. 213 – 220): Die Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen wäre dann nicht zu verhindern. Ferner müßte notwendigerweise auf Risikoerhöhung abgestellt werden, während § 266 StGB angesichts des Rechtsguts auf Vermeidung einer Verletzung ziele. Damit würde lediglich eine Gefährdung sanktioniert. Zudem fände ein Austausch des Rechtsgutsträgers statt: nicht mehr die Notwendigkeit der Wahrung des Rechtsguts, das betreute Vermögen, stünde inmitten, sondern die Einhaltung staatlich gesetzter formeller Regeln.
So zutreffend es im Ergebnis ist, daß § 266 StGB nicht die Verletzung allein von Formalia pönalisiert, so zweifelhaft fällt Chowdhurys Begründung aus. Seine Befürchtungen sind nämlich strafrechtlich weder durchweg überzeugend noch zwingend. Letzteres träfe nur zu, stellte man fälschlicherweise tatsächlich allein auf den Formalverstoß ab: ein lukratives Geschäft wird aber nicht dadurch ungetreu, dass es unter Verstoß gegen innergesellschaftsrechtliche Zeichnungsbefugnisse verstieß. Ersteres träfe hingegen nur dann zu, hätte ein Risiko keinen Einfluß auf den Wert. Das aber behauptet auch Chowdhury nicht, der für die zulässige Risikobereitschaft zutreffend auf das Innenverhältnis abstellt (S. 178 f.).
b) Daß die alleinige Verletzung verfahrensrechtlicher Erfordernisse des Zivilrechts keine Untreue sein kann, ist daher angesichts des Rechtsguts des § 266 StGB zwingend. Dagegen hindert bei nicht determiniertem Handeln die Einhaltung sämtlicher formeller Gebote des Sachrechts eine Bestrafung nur auf Basis der Prämisse von dessen abschließendem Charakter. Eben diese ist jedoch angesichts des vermögensschützenden Charakters des § 266 StGB sehr fraglich, zumindest begründungsbedürftig – und lässt sich bereits zivilrechtlich nicht durchhalten. Auch Chowdhury benötigt im Fall verletzter Verfahrensvorschriften inhaltliche Beurteilungskriterien. Natürlich übersieht er das nicht, siedelt sie jedoch jenseits des safe harbour unternehmerischer Entscheidungen an (z.B. S. 226 zum existenzvernichtenden Eingriff und S. 214 mit Fn. 115 und S. 231 – 234 zum Fall eines nicht im Interesse des betreuten Vermögens liegenden Handelns). Voneinander abweichende strafrechtliche Ergebnisse wurzeln aber wohl kaum in der Verortung inhaltlicher Kriterien innerhalb oder außerhalb des Bereichs unternehmerischer Entscheidungen i.S.v. § 93 Abs. 1 S. 2 AktG. Bei Übereinstimmung in der Notwendigkeit, Geschäftsleiterverhalten überhaupt (und zunächst unbeschadet des Umfangs) nach inhaltlichen Kriterien rechtlich einordnen zu müssen, wäre es interessant, der Frage nachzugehen, ob Zivil- und Strafrecht auf ihren je eigenen Wegen überhaupt zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Nur dann bestünde nämlich ein lösungsbedürftiger Konflikt. Diesem Thema widmet sich Chowdhury mit seinem wissenschaftlich-systematischen Interesse jedoch leider nur am Rande, so, wenn er völlig zu Recht konstatiert, dass bereits das Zivilrecht der Einhaltung der Form keine Erlaubnis zum Ausplündern zumesse (S. 214 m. Fn. 115 und S. 231 – 234) und (zu Unrecht: ausschließlich) das Gesellschafts- und Aufsichtsrecht strafrechtliche Pflichten zu konkretisieren geeignet sei (S. 225).
Auch beim sicher notwendigen Anerkennen des Prä des Zivilrechts bleibt Raum für spezifisch strafrechtliche Wertungen. Nur dort, wo das Zivilrecht eine verbindliche Entscheidung enthält, ist sie auch strafrechtlich anzuerkennen. Ist das jedoch nicht der Fall, bedeutet das allerdings keineswegs zwingend das Vorhandensein eines rechtsfreien Raums. Vielmehr besteht insoweit die Möglichkeit des Setzens von Maßstäben mit strafrechtlichen Mitteln. Eine generelle Normenhierarchie, die den Strafbestimmungen allein ihres Charakters wegen den bereichsspezifischen Nachrang gegenüber zivilrechtlichen Vorschriften zuweisen würde, existiert nicht. Strafvorschriften können daher dort, wo sie nicht im Widerspruch zu zivilrechtlichen Regeln stehen, neben diesen anwendbar sein – und damit auf diese Weise zugleich auch das zivilrechtliche Pflichtenprogramm ergänzend beeinflussen, d.h. erweitern. Originär strafrechtliche Grenzen werden auf diese Weise in das Zivilrecht inkorporiert, so dass dadurch die Einheit der Rechtsordnung nicht in Frage steht. Mit der Bindung an die Erfordernisse der Wahrung des Rechtsguts entfällt zudem in der Folge die Notwendigkeit, sich interessenwidrig an die Formerfordernisse des Zivilrechts und des Aufsichtsrechts anzulehnen (v.a. S. 104 – 221, dazu insbes. unten III 1).
2. Unter dem rechtlichen Aspekt des Bestimmtheitsgebots, Art. 103 Abs. 2 GG, bemerkenswert ist die Auffassung Chowdhurys, der Strafrichter habe zwar auch außerstrafrechtliche Gesetze auszulegen, wie es § 262 Abs. 1 StPO ausdrücklich bestimmt, sei dabei aber an die h.M. im Sachrecht gebunden. Dagegen habe der 3. Strafsenat in seiner Mannesmann-Entscheidung (BGHSt 50, 331 ff.) verstoßen. Chowdhury nimmt damit einen Gedanken auf, den das Bundesverfassungsgericht in seiner Untreueentscheidung vom 23.6.2010 (BVerfGE 126, 170 ff., Rn. 110) fruchtbar machte: Das strafrechtliche Rückwirkungsverbot gilt grundsätzlich auch für Änderungen der Rechtsprechung. Einzelheiten dazu sind zwar noch weitgehend ungeklärt. Eine Pauschalierung verbietet sich allerdings. Das fängt bereits bei der Frage an, wie sich denn die h.M. feststellen lassen soll. Hat die Literatur darauf Einfluß? Oder ist nur die Rechtsprechung maßgeblich? Kommt es bei ihr nur auf höchstrichterliche Entscheidungen an? Und wie steht es, wenn sich zwar nicht das (Straf-)Gesetz, wohl aber das normative Umfeld gegenüber einer älteren Entscheidung geändert hat? Und wie hat sich ein Strafgericht zu verhalten, das erstmals mit einer bestimmten Rechtsfrage befaßt ist – noch bevor ein für das Sachrecht zuständiges Gericht sich positionieren konnte? Chowdhury ist sicherlich insoweit zuzustimmen, als man ohne gefestigte Rechtsprechung niemandem einen Vorwurf machen kann, stellt er sich auf einen vertretbaren Standpunkt. Eine weiterreichende Zurückhaltung ist jedoch nicht geboten.
3. In strafrechtlicher Hinsicht verneint Chowdhury eine lediglich limitierte Akzessorietät der äußersten zivilrechtlichen Grenzen rechtmäßigen Verhaltens (S. 92 – 97 und 211 – 213). Damit spricht er sich dagegen aus, zwischen zivil- und strafrechtlicher Unzulässigkeit einen Filter einzubauen, demzufolge nur gravierende (zivilistische) Verstöße repressiver Ahndung zugänglich seien. Mit dieser Auffassung geht Chowdhury weit über die Rechtsprechung hinaus. Er dürfte damit deren berechtigtes Interesse verkennen: Nicht etwa sollen die äußersten Grenzen zivilrechtlich zulässigen Ermessens hinausgeschoben werden. Enthält das Sachrecht selbst aber bereits die Höhenmarke der Vertretbarkeit, so bedarf es nicht noch zusätzlich der Überwindung einer vom Strafrecht aufgestellten Hürde. Im Ergebnis nicht anders liegt es bei strikten Verboten. Sind jedoch vor einer Entscheidung verschiedene verfahrensrechtliche Schritte einzuhalten, zum Teil in liebevoller bürokratischer Kleinteiligkeit normiert, so kann und darf nicht bereits jede Missachtung einer solchen (durchaus vermögensbezogenen) Pflicht die Basis für eine Bestrafung bilden. Es wäre allerdings unfair, Chowdhury zu unterstellen, die Strafbarkeit in diesem Sinne ausweiten zu wollen. Die Notwendigkeit eines Rechtswidrigkeitszusammenhangs und des Gebots der Eliminierung der Verletzung solcher Pflichten aus dem Untreuetatbestand, die nicht spezifisch (zumindest auch) auf die Vermögenssicherung ausgelegt sind, machen es jedoch m.E. nicht überflüssig, Lässlichkeiten aus dem Tatbestand fernzuhalten, wenn und soweit nicht bereits das Sachrecht zwischen schwerpunktmäßig formellen und unverzichtbaren Pflichten unterscheidet. Es lässt sich zwar jeder einzelne, auch der bloße Formalverstoß vermeiden. Im Drange der Geschäfte und der damit erforderlichen Bildung von Schwerpunkten ist aber völlige Fehlerfreiheit nicht zu erreichen. Die Missachtung unrealistischer Sollensanforderungen darf jedoch schon diesseits der Unmöglichkeit nicht allein für sich und damit unterschiedslos pönalisiert werden.
III.
1. Im Hinblick auf seine Ansicht von der Einheitlichkeit der Rechtswidrigkeitsschwelle im Zivil- und im Strafrecht konsequent plädiert Chowdhury auch im Hinblick auf den Erwerb von subprime-Papieren für einen gemeinsamen Maßstab (S. 104 – 120). Bis zur Finanzkrise habe die Anlage in solche Titel nicht gegen aufsichtsrechtliche Vorgaben verstoßen (S. 120). Die heutigen §§ 18a und b KWG (dazu S. 187 – 191) gab es seinerzeit noch nicht.
Chowdhury wendet sich anschließend der Frage zu, ob sich aufsichtsrechtliche Maßstäbe überhaupt auf das Zivilrecht und damit in der Folge auch auf das Strafrecht übertragen ließen. Er vertritt dazu die pfiffige Auffassung, dass der regelnde Staat den Handelnden nicht allein lassen dürfe, dieser also auf die Rechtmäßigkeit seines Handelns vertrauen können müsse, wenn er einschlägige Regeln, soweit sie reichen, einhalte. So verständlich diese Position aus der Sicht des Handelnden ist, so einseitig ist sie aber gerade auch deswegen. Was im Verhältnis zur Aufsicht, also zum Staat, genügt, muss allein deshalb aber noch lange nicht zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Gleichgeordneten – und das sind de jure Geldinstitute und Anleger – führen. Es ist sogar noch weiter zu differenzieren: was verwaltungsrechtlich genügt, muss strafrechtlich keineswegs ausreichen, weil hier nicht das Allgemeininteresse, sondern der Rechtsgüterschutz maßgeblich ist. Dieser wird jedoch weitgehend vom Zivil-, und nicht vom Aufsichtsrecht gestaltet und geprägt.
Demgegenüber befürwortet Chowdhury – trotz ausgeführter Zweifel – die direkte Übertragung des § 25a KWG nebst MaRisk in aktueller Fassung auf das Strafrecht (S. 205 f.). Dem stehen die genannten systematischen Bedenken entgegen, nicht aber Chowdhurys Ansatz von der Maßstabsgleichheit: Die Zivilgerichte betrachteten die Einhaltung der Vorschriften der §§ 18 und 25a KWG (anders als im Falle der §§ 10 ff., 11 und 13 ff. KWG) als gesellschaftsrechtlich haftungsbefreiend (S. 153 – 159). Wiewohl ihm dies zu weit geht, will er für den Bereich des Risikomanagements der Einhaltung der öffentlich – rechtlichen Vorgaben starke Bedeutung für den subjektiviert definierten safe harbour, übertragbar auch auf das Strafrecht, beimessen. Ein derart eng verflochtenes Zivil- und Gesellschaftsrecht dürfte dann aber wohl konsequenterweise auch (und damit deutlich über die bisherige Rechtsprechung hinaus) den Anlegern als Haftungstatbestand bei Verletzung originär aufsichtsrechtlicher Pflichten dienen.
2. Als Ersatz für das vor der Finanzkrise unterbestimmte Aufsichtsrecht befürwortet Chowdhury den Maßstab der Üblichkeit (S. 169 und 179). Das führt ihn zu der (m.E. äußerst zweifelhaften) Feststellung, dass man sich seinerzeit habe auf externe Ratings verlassen dürfen (S. 184 – 187 und 191). Klumpenrisiken seien (auch jetzt noch?) nicht generell verboten (S. 165 f., 171 f. und 174 – 176). Und auch im Fall existentieller Risiken sei zu differenzieren (S. 169 – 180) und zwar zwischen Risikoerkenntnis und Risikobereitschaft (z.B. S. 178 f.). Letzteres zumindest ist sicherlich zutreffend, ebenso wie die Einsicht, dass die Grenzen der Zulässigkeit des Eingehens von Risiken vom Binnenverhältnis zum betreuten Vermögen konstituiert werden. Diese dürfen legal nur mit individueller Zustimmung des Vermögensinhabers überschritten werden.
3. Untreue in der Finanzkrise hält Chowdhury nur im Wege des existenzvernichtenden Eingriffs oder der Verletzung proceduraler Vorschriften für möglich (S. 226) – und verneint beides! Dem zu widersprechen ist nur möglich, verwirft man die Lehre sowohl von der reinen Akzessorietät des Strafrechts als auch der Irrelevanz des Inhalts der getroffenen Entscheidung. Darin liegt zwar keine Bestätigung für die Notwendigkeit dieses Verwerfens, belegt aber nicht nur die Bedeutung der dogmatischen Differenzen, sondern immerhin auch die Plausibilität dieser von Chowdhury abgelehnten Ansätze.
4. Im Hinblick auf den subjektiven Tatbestand vertritt Chowdhury die Auffassung, das Eingeständnis, das Konstrukt der subprime-Investments nicht durchschaut zu haben, führe noch nicht einmal zum Vorliegen des kognitiven Vorsatzelements (S. 238). Das erscheint zumindest erklärungsbedürftig: Der procedurale Ansatz führt auch innerhalb des von § 93 Abs. 1 S. 2 AktG beschriebenen Rahmens nur dann wirklich in einen safe harbour, wenn Entscheidungen auf ausreichender Informationsbasis getroffen wurden. Bereits zivilrechtlich ist es sicher nicht rechtmäßig, Investitionsentscheidungen in nennenswertem Umfang trotz verbliebenen Unverständnisses zu treffen, und zwar auch dann, wenn man die existentiellen und/oder Milliardenrisiken nicht einmal erahnte (aktuell: Sal. Oppenheim). Zutreffend ist es hingegen, das voluntative Vorsatzelement nicht allein aufgrund erkannter Notwendigkeit von Absicherungsgeschäften als bewiesen anzusehen (S. 240 f.). Sie sollten ja gerade verhindern, dass sich das den Gewinnerwartungen gegenüberstehende Verlustrisiko realisierte. Sie müssen demgemäß als Einheit mit der Investitionsentscheidung betrachtet werden.
Nachdem Chowdhury es auch noch abgelehnt hat, aus der Anreizfunktion der Boni für kurzfristige Erfolge auf die Inkaufnahme langfristiger Nachteile zu schließen (S. 241 – 248), was zumindest insoweit plausibel ist, dass allein ein solch abstrakter Anreiz nun keineswegs genügen kann, wandte er sich möglichen Irrtumsfragen zu (S. 248 – 256). Im Gegensatz zur Mannesmann-Entscheidung (BGHSt 50, 331 ff.) gelangte er durchweg zur Anwendbarkeit des § 16 StGB, dem Tatbestandsirrtum, der mangels Fahrlässigkeitsstrafbarkeit zur Straflosigkeit führt.
IV. Äußerst sympatisch ist, dass Chowdhury seine moralischen Skrupel über das von ihm gefundene Ergebnis offenlegte. Das ist unter Juristen alles andere als verbreitet. Allerdings verfügt er über ausreichend Argumentationsstärke, um diese Zweifel hinter die Rationalität des von ihm für richtig gefundenen strafrechtlichen Ergebnisses zurücktreten zu lassen (S. 257 – 281). In Abgrenzung zum Strafrecht befürwortet er den Weg verstärkter Aufsicht.
Die Arbeit ist eine beispielhafte Bestätigung, wie berechtigt die Warnung ist, doch bitte vor lauter Bäumen den Wald nicht zu übersehen! Zahlreiche Argumente für ins strafrechtliche Visier geratene Verantwortliche von Geldinstituten, von sehr abstrakt bis in Verästelungen konkret, verfasst von einem systematisch denkenden, hochintelligenten und dazu erfreulicherweise auch noch skrupulösen Autor: Hätte er doch nur auch noch den Mut aufgebracht, eigene Plausibilitätsüberlegungen anzustellen: Papiere, die auf Sand gebaut sind, müssen irgendwann ‚platzen‘. Das zu erkennen, braucht man weder ein Jura- noch ein betriebswirtschaftliches Studium. Sollte beides dazu führen, einfache Weißheiten zu verkennen, so wäre das schlimm, stellte aber keinen Rechtfertigungsgrund dar: weder für die genannten Professionen noch für die (englisch ausgesprochenen) Banker, die sich nicht als (deutsch ausgesprochene) Banker verhielten. Behaupte niemand, er hätte nichts gewusst: Dem Rezensenten wurde seit Aufkommen der verbrieften Subprime – Kredite immer wieder vom Erwerb entsprechender Papiere abgeraten, und zwar unter Hinweis auf die schlichte Wahrheit ihrer realen Wertlosigkeit! Natürlich könnte man das unter Hinweis darauf abtun, man habe den Gewinn selbst machen und nicht mit Kunden teilen wollen: glaubhaft wäre das nicht – nicht bei gegebener völlig richtiger Begründung!