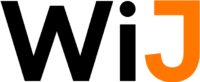Rigopoulou, Maria, Grenzen des Paternalismus im Strafrecht
Duncker & Humblot, Berlin 2013, 364 S., 84,90 €
I. Ob es einem nun aufgrund eigener Dummheit, charakterlicher Schwäche oder sonstiger Exentrizität schlecht geht, soll dem Strafrecht grundsätzlich gleichgültig sein. Es ist nicht Aufgabe eines liberalen Strafrechtssystems, dem Bürger Verhaltensweisen vorzuschreiben, die ihm zu einem „besseren“ Leben verhelfen oder ihn zu einem „guten“ Menschen machen. Der liberale Rechtsstaat darf nicht bestimmte Motive und Inhalte privilegieren und andere als unvernünftig verwerfen, sondern lediglich die autonome Basis der Ausübung von Handlungsfreiheit sichern: dem Einzelnen ist es vorbehalten, seine Vorstellung der Glückseligkeit zu verfolgen (S. 117). Soll Autonomie ein Bollwerk gegen einen eudämonistischen Polizeistaat anbieten, der seine Bürger zu einem glücklichen Leben zwingen will, dann muß die Autonomie auch das Recht umfassen, sich gegen das Vernünftige oder Vorteilhafte zu entscheiden (S. 322).
Mit der Wucht einer Abrissbirne nach dem Lösen der Ketten – doch zugleich in der Präzision des chirurgischen Laserstrahls zerstört Rigopoulous konsequente Logik jedes nicht zu Ende gedachte, schiefe oder Scheinargument. Sie schont nichts und niemanden und scheut auch nicht davor zurück, erforderlichenfalls ihrem Doktorvater zu widersprechen. Mit ihm und ihr haben sich die Richtigen gefunden: der wortgewaltige Prof. Dr. Schünemann und seine ihm selbst als Nicht-Muttersprachlerin in ihrer auf Deutsch verfassten Dissertation kaum nachstehende Schülerin! Ein Lesegenuss, der an den harten, aber strikt sachorientierten Stil so mancher alter Entscheidung des Reichsgerichts erinnert, dem der Leser heutiger Gerichtsentscheidungen wie aktueller literarischer Veröffentlichungen weitgehend entwöhnt ist. Welche Einbuße an Klarheit des Blicks und an Gewinn neuer Erkenntnisse damit verbunden ist, führt einem ein Werk vor Augen, das in bewunderswert knapper Sprache vorführt, wie es eben auch gehen kann! Genauso der Inhalt: der konsequente Gegenpol zum ach so modernen, aber mit Überwachung und „Entmündigung“ erkauften überfürsorglichen Sozialstaat.
Rigopoulou hält sich gar nicht erst mit der Entwicklung ihres Standpunktes auf: Man ist autonom oder nicht (S. 42). Sie ist es. Aber wer sagt denn, dass sie deshalb die Denker, welche die (rechts-)philosophischen Grundlagen ihrer Einstellung entwickelten oder sich damit vor ihr befassten, gering schätzen würde? Sie hat sie verstanden – das genügt (und verstanden zu haben lässt sich nicht von jedem behaupten, der Ideengeschichte repetiert). Ihre Dissertation ist in 6 Teile aufgegliedert. Der Einleitung (S. 19 – 26) folgt der 1. Teil: Rechtsphilosophische Grundlagen (S. 27 – 46), dem sich als Teil 2 die Befassung mit Verfassungsrechtlichen Grundlagen anschließt (S. 47 – 114). In Teil 3 steht Direkter strafrechtlicher Paternalismus im Fokus ihrer Überlegungen (S. 115 – 193), während Teil 4 Typologien des indirekten Paternalismus im Strafrecht gewidmet ist (S. 194 – 315). Der 5. Teil fasst die Ergebnisse in 12 Punkten und einem abschließenden Ausblick zusammen (S. 316 – 323).
II.
1. Bereits in ihrer Einleitung macht Rigopoulou deutlich, wo und wofür sie steht: Paternalismus sei nur als weicher (und damit in Wirklichkeit nur uneigentlicher, S. 32 f. <eigentlich also gar nicht?>) in Ordnung, weil und wenn er die Autonomie des Einzelnen sichert, ihn z.B. als Übereilungsschutz vor defizitären Entscheidungen bewahrt. Aus dieser Perspektive, der Sicherung autonomen Handelns des Individuums, erscheint es unvermeidlich als widersprüchlich und bedarf deshalb einer Legitimierung durch deutlich gewichtigere Gründe, auf eigenverantwortliches Handeln mit Strafrecht zu reagieren. Nicht anzuerkennen seien schon aus diesem Grunde sämtliche Eingriffe in das Präferenzsystem des konkreten Menschen (S. 22 f.). Da die Ahndung eigenschädigenden Verhaltens nur die Vermeidung zukünftiger Wiederholung bezwecken könne (S. 130), sei das als Reaktion auf Vergangenes konzipierte Strafrecht von vorn herein kein dafür geeignetes Mittel. Deshalb dürfe der sich selbst Schädigende allein dafür nie bestraft werden. Das schließe allerdings etwaige gegen Dritte gerichtete strafrechtliche Reaktionen darauf nicht aus (S. 26).
Besonders verdienstvoll ist der kurze Abschnitt über Begriffliche Vorfragen (S. 23 – 26), der wie ein Kompass gerade solchen Lesern dient und ihnen bei der Lektüre hilft, die sich zuvor noch nicht analytisch mit dem Paternalismus und seinen Facetten beschäftigt hatten. Paternalismus wird demnach von zwei Elementen konstituiert (S. 24 f.). Er liegt vor bei Zwangseingriffen gegen den aktuellen Willen des Betroffenen, ist aber ausgerichtet auf dessen langfristiges Wohl, ohne dass es auf das Erreichen dieses Ziels ankäme. Er gliedert sich in eine negative und in eine positive Komponente. Erstere erfasst Handlungsverbote, zweitere auferlegte Handlungspflichten. Indirekter Paternalismus besteht in der Begrenzung unterstützenden Handelns Dritter im Dienste des Betroffenen (z.B. Verbot der Tötung auf Verlangen, § 216 StGB) und ist abzugrenzen gegen unter dem Gesichtspunkt des Paternalismus unproblematische drittschützende Vorschriften (z.B. Werbeverbote für Zigaretten).
2. Angesichts der Überschrift Rechtsphilosophische Grundlagen erwartungswidrig befasst sich Rigopoulou im 1. Teil nicht mit alten Griechen, Kant oder sonstigen anerkannten Geistesgrößen, sondern mit den Autoren, die sich bereits mit dem Thema Paternalismus befasst haben. Schlag auf Schlag entreißt sie allen Vertretern des von ihr sog. konsequentialistischen Ansatzes die Überzeugungskraft der von ihnen angeführten Argumente und ordnet sie letztlich den Befürwortern eines kommunitaristischen Staatsverständnisses zu, das den Einzelnen (in verschiedenen Spielarten und unterschiedlicher Intensität) in den Dienst der Gemeinschaft stellt: wer Paternalismus mit Blick auf die Folgen zu rechtfertigen bereit sei, müsse angeben, nach welchem Maßstab er sie für erträglich oder umgekehrt für inakzeptabel hält. Dieser Maßstab könne nur ein überindividueller sein und verfehle schon damit die jedem Menschen qua Geburt zukommende Autonomie. Er sei zudem zwangsläufig missbrauchsanfällig, weil durch Definition von vorgetäuschten oder Scheinrechtsgütern (wie Volksgesundheit oder Pietät) leicht auszuhebeln (S. 131), so dass die Ergebnisse nur rein zufällig ausfallen könnten (S. 29) – ein Vorwurf, der sich allerdings von jedem als unverrückbar erklärten (nicht nur ideologischen) Standpunkt gegen jede Abwägung erheben lässt. Notwendig sei daher keine utilitaristische Betrachtung (S. 29), sondern eine prinzipielle, eine deontologische (S. 32), die Rigopoulou selbst als absolutierend (S. 42 m. Fn. 79) und apriorisch, also dem staatlichen Recht vorgeben (S. 125), beschreibt.
Die Verfassung anerkenne die Autonomie jedes Individuums (so der Extrakt der S. 47 – 114). Dies stehe irgendeiner Zweckbindung ihres Gebrauchs und der Auferlegung von Pflichten gegen sich selbst entgegen (S. 35 – 37). Der Staat habe daher eigenverantwortlich getroffene Entscheidungen zu respektieren und dürfe sich nicht als Wächter betätigen, den Einzelnen nicht einmal zum Zwecke der Erhaltung der Fähigkeit zukünftiger Entscheidungsfreiheit instrumentalisieren (S. 29 – 32).
3. Das wesentliche praktische Problem, das (ausgesprochen oder konkludent) sämtliche weiteren Überlegungen durchzieht, besteht darin, dass im Grunde nur wirklich autonom getroffene Entscheidungen staatlicherseits hinzunehmen sind, ihnen aber nicht ohne weiteres anzusehen ist, ob sie tatsächlich in freier Verantwortung getroffen wurden. Diese Prüfung sei in nicht paternalistischer Weise vorzunehmen. Die Vernunft scheide daher, weil heteronom, als Maßstab aus. Das stehe zwar nicht der Frage nach der Vernünftigkeit der Entscheidung entgegen. Allerdings biete allein schon dieser Zweifel ein Einfallstor für harten und damit unzulässigen Paternalismus (S. 34). Entscheidungen komme notwendigerweise immer nur eine begrenzte Rationalität zu. Sie fielen in der Realität nie auf der Basis höchstmöglichen prognoserelevanten Wissens, dem Maßstab des Allwissenden (S. 38). Autonomie schließe vielmehr auch die Bereitschaft zu Fehlentscheidungen ein, so dass kein Autonomieperfektionismus verlangt werden könne (S. 39). Eine konsistente Präferenzordnung gäbe es weder allgemein noch für das Individuum (S. 40). Ansatzpunkt sei daher nicht die konkrete Entscheidung. Maßgeblich sei vielmehr allein, ob sie (nach dem Maßstab der Durchschnittlichkeit < S. 42: paternalistische Bewertung?>) von einem zur Autonomie Fähigen stamme (S. 40 und 78). Dem nachzugehen sei legitim, aber nur anhand von Indizien möglich (z.B. betroffenes Rechtsgut, Abweichung von sonstigen eigenen Maßstäben <näher S. 78 – 81>, Mittel ungeeignet oder nicht das mildeste, z.B. Ziehen aller Zähne zur Behebung von Kopfschmerzen, vgl. BGH, NJW 1978, 1206). Die Delegation der Ausführungshandlung an einen Dritten könne auf Unsicherheit des Betroffenen deuten, nicht aber dann, wenn Letzterer zur Vornahme physisch nicht in der Lage sei, z.B. aufgrund von Lähmung (S. 42 – 45).
a) Der Gesetzgeber stehe vor der Schwierigkeit, einen generellen Maßstab anlegen zu müssen. Er könne daher nur auf Risiken abstellen und müsse dabei in Kauf nehmen, dass seine Regelung auch Entscheidungen erfasse und damit verbiete, die nicht autonomie-defizitär getroffen wurden (S. 45 f.). Das ist allerdings nicht die ganze Wahrheit, schließlich ist eine Gesetzestechnik möglich, die den konkreten Entscheider auf eine individuelle Prüfung festlegt. Rigopoulou wendet sich anschließend den verfassungsrechtlichen Befugnissen zu, die es der Legislative erlauben, die Anerkennung autonomen Verhaltens einzuschränken. Das Sozialstaatsprinzip stelle eine Gefahr für die von der Menschenwürde, Art. 1 GG (S. 54), und dem allgemeinen Freiheitsgrundrecht, Art. 2 Abs. 1 GG (S. 53, nicht jedoch in dessen Ausprägung als allgemeines Persönlichkeitsrecht, S. 56 f.), geschützte Autonomie dar. Mit ihr verträglich sei Hilfe durchaus, nicht jedoch aufgedrängte (S. 66 f.). In Betracht komme z.B. Schutz gegen zu große Komplexität der Entscheidungsparameter (S. 49). Alle Eingriffe müssten nicht nur dem Übermaßverbot genügen. Vielmehr stelle sich vorgelagert die Frage nach der generellen Erlaubnis des Gesetzgebers (S. 57 f.). Sie liege weder im objektiven Gehalt (S. 60 f.) noch in der Schutzfunktion der Grundrechte, die zugunsten desselben Trägers zur Abwehrfunktion hinzuträten, sie aber nicht einschränkten, sich deshalb nur gegen Dritte wenden ließen (S. 59 f.). Demnach enthalte das GG keine ausdrückliche Norm, die dem Gesetzgeber als Grundlage dienen könnte, autonome Entscheidungen nur eingeschränkt zu respektieren. Er sei aber in der Wahl seiner Ziele frei, solange er damit kein im GG enthaltenes Verbot verletze. Weil Rigopoulou es (ohne nähere Begründung) ablehnt, mit der Verfassungsgarantie der Autonomie eine Grenze zu ziehen, die nur überschritten werden dürfte, wenn sich dafür eine verfassungsunmittelbare Grundlage feststellen ließe, begnügt sie sich mit der Forderung staatlicher Neutralität in dem Sinne, daß die Obrigkeit keine Bewertung eigenverantwortlich verfolgter Motive vornehmen dürfe. Erlaubt sei daher ein Tätigwerden nur zum Schutze Dritter oder der Allgemeinheit (S. 67 – 73). Das Sittengesetz (Art. 2 Abs. 1 GG) hingegen rechtfertige keine paternalistischen Regelungen, stelle es doch bereits keine Eigenschranke für das Handeln des Grundrechtsträgers dar, soweit ihn die Auswirkungen seines Handelns selbst träfen (S. 98 – 100). Es könne auch von niemandem verlangt werden, Mitglied der Gesellschaft zu bleiben (S. 89 – 93). Demgegenüber stelle zwar die Vermeidung sozialer Folgekosten ein legitimes Ziel dar, rechtfertige aber keine Verbote, sondern nur die Verweigerung von Sozialleistungen oder die präventive Besteuerung eigengefährdenden Verhaltens (S. 93 – 98). Ähnlich verhalte es sich mit dem Schutz Dritter vor für sie unangenehmen Erlebnissen und damit verbundener Unlustgefühle. Sie rechtfertigten allerdings örtliche Beschränkungen (S. 85 – 89). Bei Aufstellung verfahrensrechtlicher Hürden müsse zudem immer die Einbuße an Autonomie berücksichtigt werden, sowohl aufgrund der monetären Kosten als auch des Zeitaufwands sowie der psychische Belastung mit der aufgezwungenen Befassung (S. 83). Wer, liebe Leserin und lieber Leser, muß dabei nicht unwillkürlich an seine Steuererklärung denken?
b) Weil Autonomiedefizitäre (Minderjährige, Minderbemittelte) nicht ihre Personalität verlören, stünden sie nicht außerhalb des Anwendungsbereichs der Art. 1 und 2 Abs. 1 GG. Soweit sie trotz Einschränkungen zur Selbstbestimmung in der Lage seien, habe daher der Staat auf solcher Grundlage getroffene Entscheidungen anzuerkennen. Unterstützung im Bereich der Defizite müsse hingegen das Ziel verfolgen, diese auszugleichen, also die Voraussetzungen selbstverantwortlichen Handelns soweit wie möglich zu schaffen (S. 73).
c) Die Analyse der Rechtsprechung des BVerfG ergab kein die Verfasserin befriedigendes Bild, weil das Gericht nicht direkt zur Zulässigkeit paternalistischer Maßnahmen und deren Grenzen Stellung nahm, sondern sich auf andere Begründungselemente kaprizierte (S. 100 – 114). Strafrechtsdogmatische Gründe sprächen eher deutlich gegen als für paternalistische Strafnormen (S. 117 – 130). Die den Konsum unter Strafe stellenden Vorschriften des BtMG (S. 132 – 157) – ein Highlight, unabhängig von Beifall für oder Widerspruch gegen ein bestimmtes Ergebnis – finden ebensowenig Gnade unter Rigopoulous scharfem Blick wie das Verbot des Organhandels nach § 18 Abs. 1 TPG (S. 157 – 188). Legitimierbar sei nur wucherischer Vertrieb bei Straffreiheit für Spender und Empfänger (S. 187 f.). Trotz aller Sympathie für Meinungsstärke und klartextlichen Ausdruck stören hier allerdings emotionale Bewertungen (Beruhigung schlechten Gewissens, S. 183; Scheinheiligkeit, S. 184). Es hätte der Autorin besser gestanden und zudem vollauf genügt, auch hier auf die Überzeugungskraft ihrer Sachargumente zu vertrauen. Erfreulich ist hingegen wiederum, dass Rigopoulou auch einen Blick auf die Hypertrophie der Ordnungswidrigkeiten (so Seebode bereits im Jahre 1986!) warf (S. 188). So hält sie z.B. die Bußgeldbewehrung der Gurtpflicht für unverhältnismäßig (S. 188 – 192).
4. Im 4. Teil befaßt sich Rigopoulou schwerpunktmäßig mit dem indirekten Paternalismus und gelangt – dogmatisch bewundernswert rigoros – zu dem Ergebnis, dass es keiner Unterscheidung gemäß der h.M. zwischen einvernehmlicher Fremdschädigung und unterstützter (= interaktiver, S. 194) Selbstschädigung bedürfe. Strafbares und erlaubtes Handeln scheide sich allein nach dem Prinzip der Selbstverantwortung (S. 195 – 198 und 259). Einvernehmlich-fremdschädigendes Verhalten sei solange nicht strafwürdig, wie dem Betroffenen auch noch nach dem Handeln des Dritten die Möglichkeit zu freier Entscheidung und wirksamer Einwirkung zur Vermeidung des Eintritts der Folgen verbleibe (S. 227 f.) und der Dritte keinen übergewichtigen Einfluss ausübe (S. 229). Die Ergebnisse decken sich allerdings – was Rigopoulou ebenso unumwunden wie souverän selbst einräumt und die Überzeugungskraft ihrer Systematik keineswegs schmälert – weitgehend mit denen der Rechtsprechung, die darauf abstellt, wer im entscheidenden Moment, dem letzten, zu dem eine Umkehr möglich ist, die Tatherrschaft innehat. Dabei komme es, Murmann folgend, nicht darauf an, ob der Dritte mehr wisse als der Betroffene, sondern allein maßgebend sei, ob Letzterer genügend wisse, um das Risiko zu kennen und seine Entscheidung wie sein Verhalten darauf eigenverantwortlich zu stützen (S. 290).
5. Abschließend wendet sich Rigopoulou den §§ 216 und 228 StGB zu (S. 294 – 315). Sie fasst beide Bestimmungen als (enge) Ausnahmen vom Prinzip der Straffreiheit der Verfügung über eigene Rechtsgüter auf, die sich jedoch weich paternalistisch rechtfertigen ließen. Die Folgen etwaiger Tathandlungen (Körperverletzung, erst recht der Tod) seien so gravierend, dass ein Dritter nie sicher wissen könne, ob der Betroffene tatsächlich über seine Einwilligung autonom entschieden habe. Daher sei es angemessen, von Gesetzes wegen klarzustellen, dass kein Außenstehender dem Betroffenen die Letztentscheidung abnehmen dürfe, widrigenfalls er seine Bestrafung riskiere. Das gelte auch in Ansehung des Paradoxons, dass dem Dritten die Privilegierung gegenüber §§ 212 oder gar 211 StGB bei in Wahrheit gar nicht ernstlichem Tötungsverlangen zu Unrecht zu Gute komme und er umgekehrt bei tatsächlich ernsthaftem Tötungsverlangen materiell zu Unrecht bestraft werde, § 216 StGB also nie den angemessenen Strafrahmen zur Verfügung stelle (S. 308 unter Berufung auf Frank Müller). Es beschleichen einen allerdings leise Zweifel, ob diese Begründung wirklich der inneren Logik der Argumentationskette Rigopoulous gemäß ist und nach diesen Maßstäben die Ausnahmslosigkeit der Strafdrohung in allen von §§ 216 und 228 StGB erfaßten Fällen tatsächlich rechtfertigen kann, also auch dann, wenn es an der Eigenverantwortlichkeit der Entscheidung nach menschlichem Ermessen keinen Zweifel gibt. Sollten diese leisen Zweifel gerechtfertigt sein, so würden sie immerhin belegen, dass die Klarheit der Gedanken sich durchaus mit pragmatischem Handeln verträgt, ja einen sachlichen Kompromiss vielleicht sogar erst möglich macht. Zweifelsfrei ist Rigopoulou in der Feststellung zuzustimmen, dass niemand Drittes hundertprozentig wissen kann, wie es im Innern eines anderen wirklich aussieht. Anerkennung verdient ihr Maßstab aber zumindest deshalb, weil er mit dem Abstellen auf die Freiheit der Selbstbestimmung Pflöcke gegen paternalistische Ausweitungstendenzen (z.B. durch Übertragung des Rechtsgedankens auf andere Situationen in der Wirksamkeit bezweifelter Einwilligungsfähigkeit) einschlägt.
III. Schade, dass es zu Ende, das Buch ausgelesen ist. Es ist zu hoffen, daß Rigopoulou sowohl ihren Stil beibehält als auch in Deutschland noch Vieles publiziert. Der Extrakt für die Wirtschaftskriminalität?
1. Dem Strafrecht vorgelagert ist das jeweilige Sachrecht. Es wäre wünschenswert, nähme sich der Gesetzgeber schon insoweit ihre Warnung vor paternalistischem Gehabe zu Herzen. Die Belehrungspflichten der Banken gegenüber Anlagewilligen, die zum Versand üppiger Formulare führten, die kein Verbraucher in ihrer ganzen Tragweite wirklich verstehen kann, wenn er sich die Lektüre denn wirklich antut, die ihm aber seine Chancen nehmen, die Anlagegesellschaft oder die vermittelnden Geldinstitute für erlittene Verluste haftbar zu machen (cross-border-Verträge mit US-Unternehmen füllten Papiere mit vierstelligen Seitenzahlen und bewahrten die verkaufenden Kommunen trotzdem nicht vor Verlusten in Millionenhöhe – Beleg für Rigopoulous Warnung vor Autonomieperfektionismus nach dem Maßstab des Allwissenden, S. 38 f.), das faktische Arbeitsverbot für Leistungsgeminderte, vulgo: Mindestlohn, und die ausnahmslose Verpflichtung Selbständiger, sich trotz nicht vorhandener Mittel gegen z.B. Krankheit zu versichern, die zum nachträglichen (teilweisen) Erlass der horrend angewachsenen Beitragsschulden führten, beleuchten schlaglichtartig, wie die Grundeinstellung Rigopoulous dem aktuellen Mainstream entgegensteht. Bedenkt man, dass in den Verträgen ausgeführte Risiken das strafrechtliche Risiko für die Verantwortlichen der Kommunen nur erhöhen und finanzschwache Arbeitgeber aufgeben müssen, wollen sie weder Buße für die ressourcenbedingte Unterschreitung des Mindestlohns als solchen noch für die unterlassenen Abgaben auf die Phantomlöhne riskieren – ja, beides ist juristisch vermeidbar, aber welcher ums wirtschaftliche Überleben bemühte Arbeitgeber kann sich den dafür erforderlichen qualifizierten Rechtsrat schon leisten? – so klingelt einem Rigopoulous Warnung vor selbst weich paternalistischen strafrechtlichen Mitteln in den Ohren.
So fraglos Solidarität mit Bedürftigen geboten ist: Besteht sie nicht, soweit möglich, in Hilfe zur Selbsthilfe, sondern in (durchaus vorrangig: außerstrafrechtlichem) Paternalismus, so ist sie ein zweischneidiges Schwert. Nicht nur, dass diesem die Tendenz zu Überforderung des Paters innewohnt – um wieviel Alltägliches, das ihn originär gar nichts angeht, soll sich der Staat denn noch kümmern? – er zwingt ihn geradezu zur Kontrolle von allem und jedem und verlangt dafür eine Bürokratie, wie sie nicht nur die Staaten des früheren Warschauer Pakts lähmten. Auf der Seite der Umsorgten nimmt zwangsläufig nicht nur mit zunehmender Gewöhnung die Freude an der gewährten Hilfe ab, weicht steigender Unzufriedenheit und zunehmendem Anspruchsdenken, sondern läßt auch die bei jedem vorhandenen Talente verkümmern. Kurz: Paternalismus schwächt, was es zu stärken gilt! Schon dies sollte ausreichen, vor einschlägigen Regelungen wenn nicht zurückzuschrecken, so doch jedenfalls nur zurückhaltend, ausnahmsweise und nur bei Vorhandensein sehr guter Gründe Gebrauch zu machen. Schaut man sich die Ergebnisse an, so drängt sich allerdings noch eine ganz andere Frage auf: Woher haben denn die Paternalisten eigentlich ihre Weisheit? Können sie überhaupt wissen, was für andere richtig ist? Können sie das besser wissen als die Umhegten? Oder legen sie vielleicht nur ihre eigenen Maßstäbe an und Interessen zugrunde? Scheinbar Gutes für andere zu tun, fördert zumindest das eigene Ansehen.
2. Die exakten Analysen der Autorin stehen aber auch vorschnell gezogenen Parallelen entgegen. Führt sie aus, dass die Kehrseite des Prinzips der Selbstverantwortung darin bestehe, nicht für frei verantwortete Entscheidungen Dritter eintreten zu müssen (S. 199), so assoziiert derjenige, der schon einmal mit der Verantwortlichkeit in hierarchisch gegliederten Einheiten zu tun hatte, unvermeidlich das Stichwort Geschäftsherrenhaftung. Danach steht das verschuldete Handeln des unmittelbaren Täters der täterschaftlichen Haftung des Hintermannes nicht entgegen. Der zweite Blick zeigt jedoch, dass dies kein Problem des Paternalismus darstellt, denn der Hintermann soll dem unmittelbaren Täter weder dessen Verantwortung ab-, noch sie übernehmen, sondern nur sein eigenes Verhalten verantworten. Das aber ist ein völlig legitimes Anliegen der Rechtsgemeinschaft. Wie ihm rechtstechnisch Rechnung getragen werden soll, steht sicherlich der Diskussion offen. Kritikern der aktuellen Ausgestaltung liefert Rigopoulou jedoch keine Argumente.
3. Demnach ist gerade auch für mit dem Wirtschaftsstrafrecht Befasste die Lektüre des Werks von Rigopoulou nichts als gewinnbringend!
Duncker & Humblot, Berlin 2013, 364 S., 84,90 €
I. Ob es einem nun aufgrund eigener Dummheit, charakterlicher Schwäche oder sonstiger Exentrizität schlecht geht, soll dem Strafrecht grundsätzlich gleichgültig sein. Es ist nicht Aufgabe eines liberalen Strafrechtssystems, dem Bürger Verhaltensweisen vorzuschreiben, die ihm zu einem „besseren“ Leben verhelfen oder ihn zu einem „guten“ Menschen machen. Der liberale Rechtsstaat darf nicht bestimmte Motive und Inhalte privilegieren und andere als unvernünftig verwerfen, sondern lediglich die autonome Basis der Ausübung von Handlungsfreiheit sichern: dem Einzelnen ist es vorbehalten, seine Vorstellung der Glückseligkeit zu verfolgen (S. 117). Soll Autonomie ein Bollwerk gegen einen eudämonistischen Polizeistaat anbieten, der seine Bürger zu einem glücklichen Leben zwingen will, dann muß die Autonomie auch das Recht umfassen, sich gegen das Vernünftige oder Vorteilhafte zu entscheiden (S. 322).
Mit der Wucht einer Abrissbirne nach dem Lösen der Ketten – doch zugleich in der Präzision des chirurgischen Laserstrahls zerstört Rigopoulous konsequente Logik jedes nicht zu Ende gedachte, schiefe oder Scheinargument. Sie schont nichts und niemanden und scheut auch nicht davor zurück, erforderlichenfalls ihrem Doktorvater zu widersprechen. Mit ihm und ihr haben sich die Richtigen gefunden: der wortgewaltige Prof. Dr. Schünemann und seine ihm selbst als Nicht-Muttersprachlerin in ihrer auf Deutsch verfassten Dissertation kaum nachstehende Schülerin! Ein Lesegenuss, der an den harten, aber strikt sachorientierten Stil so mancher alter Entscheidung des Reichsgerichts erinnert, dem der Leser heutiger Gerichtsentscheidungen wie aktueller literarischer Veröffentlichungen weitgehend entwöhnt ist. Welche Einbuße an Klarheit des Blicks und an Gewinn neuer Erkenntnisse damit verbunden ist, führt einem ein Werk vor Augen, das in bewunderswert knapper Sprache vorführt, wie es eben auch gehen kann! Genauso der Inhalt: der konsequente Gegenpol zum ach so modernen, aber mit Überwachung und „Entmündigung“ erkauften überfürsorglichen Sozialstaat.
Rigopoulou hält sich gar nicht erst mit der Entwicklung ihres Standpunktes auf: Man ist autonom oder nicht (S. 42). Sie ist es. Aber wer sagt denn, dass sie deshalb die Denker, welche die (rechts-)philosophischen Grundlagen ihrer Einstellung entwickelten oder sich damit vor ihr befassten, gering schätzen würde? Sie hat sie verstanden – das genügt (und verstanden zu haben lässt sich nicht von jedem behaupten, der Ideengeschichte repetiert). Ihre Dissertation ist in 6 Teile aufgegliedert. Der Einleitung (S. 19 – 26) folgt der 1. Teil: Rechtsphilosophische Grundlagen (S. 27 – 46), dem sich als Teil 2 die Befassung mit Verfassungsrechtlichen Grundlagen anschließt (S. 47 – 114). In Teil 3 steht Direkter strafrechtlicher Paternalismus im Fokus ihrer Überlegungen (S. 115 – 193), während Teil 4 Typologien des indirekten Paternalismus im Strafrecht gewidmet ist (S. 194 – 315). Der 5. Teil fasst die Ergebnisse in 12 Punkten und einem abschließenden Ausblick zusammen (S. 316 – 323).
II.
1. Bereits in ihrer Einleitung macht Rigopoulou deutlich, wo und wofür sie steht: Paternalismus sei nur als weicher (und damit in Wirklichkeit nur uneigentlicher, S. 32 f. <eigentlich also gar nicht?>) in Ordnung, weil und wenn er die Autonomie des Einzelnen sichert, ihn z.B. als Übereilungsschutz vor defizitären Entscheidungen bewahrt. Aus dieser Perspektive, der Sicherung autonomen Handelns des Individuums, erscheint es unvermeidlich als widersprüchlich und bedarf deshalb einer Legitimierung durch deutlich gewichtigere Gründe, auf eigenverantwortliches Handeln mit Strafrecht zu reagieren. Nicht anzuerkennen seien schon aus diesem Grunde sämtliche Eingriffe in das Präferenzsystem des konkreten Menschen (S. 22 f.). Da die Ahndung eigenschädigenden Verhaltens nur die Vermeidung zukünftiger Wiederholung bezwecken könne (S. 130), sei das als Reaktion auf Vergangenes konzipierte Strafrecht von vorn herein kein dafür geeignetes Mittel. Deshalb dürfe der sich selbst Schädigende allein dafür nie bestraft werden. Das schließe allerdings etwaige gegen Dritte gerichtete strafrechtliche Reaktionen darauf nicht aus (S. 26).
Besonders verdienstvoll ist der kurze Abschnitt über Begriffliche Vorfragen (S. 23 – 26), der wie ein Kompass gerade solchen Lesern dient und ihnen bei der Lektüre hilft, die sich zuvor noch nicht analytisch mit dem Paternalismus und seinen Facetten beschäftigt hatten. Paternalismus wird demnach von zwei Elementen konstituiert (S. 24 f.). Er liegt vor bei Zwangseingriffen gegen den aktuellen Willen des Betroffenen, ist aber ausgerichtet auf dessen langfristiges Wohl, ohne dass es auf das Erreichen dieses Ziels ankäme. Er gliedert sich in eine negative und in eine positive Komponente. Erstere erfasst Handlungsverbote, zweitere auferlegte Handlungspflichten. Indirekter Paternalismus besteht in der Begrenzung unterstützenden Handelns Dritter im Dienste des Betroffenen (z.B. Verbot der Tötung auf Verlangen, § 216 StGB) und ist abzugrenzen gegen unter dem Gesichtspunkt des Paternalismus unproblematische drittschützende Vorschriften (z.B. Werbeverbote für Zigaretten).
2. Angesichts der Überschrift Rechtsphilosophische Grundlagen erwartungswidrig befasst sich Rigopoulou im 1. Teil nicht mit alten Griechen, Kant oder sonstigen anerkannten Geistesgrößen, sondern mit den Autoren, die sich bereits mit dem Thema Paternalismus befasst haben. Schlag auf Schlag entreißt sie allen Vertretern des von ihr sog. konsequentialistischen Ansatzes die Überzeugungskraft der von ihnen angeführten Argumente und ordnet sie letztlich den Befürwortern eines kommunitaristischen Staatsverständnisses zu, das den Einzelnen (in verschiedenen Spielarten und unterschiedlicher Intensität) in den Dienst der Gemeinschaft stellt: wer Paternalismus mit Blick auf die Folgen zu rechtfertigen bereit sei, müsse angeben, nach welchem Maßstab er sie für erträglich oder umgekehrt für inakzeptabel hält. Dieser Maßstab könne nur ein überindividueller sein und verfehle schon damit die jedem Menschen qua Geburt zukommende Autonomie. Er sei zudem zwangsläufig missbrauchsanfällig, weil durch Definition von vorgetäuschten oder Scheinrechtsgütern (wie Volksgesundheit oder Pietät) leicht auszuhebeln (S. 131), so dass die Ergebnisse nur rein zufällig ausfallen könnten (S. 29) – ein Vorwurf, der sich allerdings von jedem als unverrückbar erklärten (nicht nur ideologischen) Standpunkt gegen jede Abwägung erheben lässt. Notwendig sei daher keine utilitaristische Betrachtung (S. 29), sondern eine prinzipielle, eine deontologische (S. 32), die Rigopoulou selbst als absolutierend (S. 42 m. Fn. 79) und apriorisch, also dem staatlichen Recht vorgeben (S. 125), beschreibt.
Die Verfassung anerkenne die Autonomie jedes Individuums (so der Extrakt der S. 47 – 114). Dies stehe irgendeiner Zweckbindung ihres Gebrauchs und der Auferlegung von Pflichten gegen sich selbst entgegen (S. 35 – 37). Der Staat habe daher eigenverantwortlich getroffene Entscheidungen zu respektieren und dürfe sich nicht als Wächter betätigen, den Einzelnen nicht einmal zum Zwecke der Erhaltung der Fähigkeit zukünftiger Entscheidungsfreiheit instrumentalisieren (S. 29 – 32).
3. Das wesentliche praktische Problem, das (ausgesprochen oder konkludent) sämtliche weiteren Überlegungen durchzieht, besteht darin, dass im Grunde nur wirklich autonom getroffene Entscheidungen staatlicherseits hinzunehmen sind, ihnen aber nicht ohne weiteres anzusehen ist, ob sie tatsächlich in freier Verantwortung getroffen wurden. Diese Prüfung sei in nicht paternalistischer Weise vorzunehmen. Die Vernunft scheide daher, weil heteronom, als Maßstab aus. Das stehe zwar nicht der Frage nach der Vernünftigkeit der Entscheidung entgegen. Allerdings biete allein schon dieser Zweifel ein Einfallstor für harten und damit unzulässigen Paternalismus (S. 34). Entscheidungen komme notwendigerweise immer nur eine begrenzte Rationalität zu. Sie fielen in der Realität nie auf der Basis höchstmöglichen prognoserelevanten Wissens, dem Maßstab des Allwissenden (S. 38). Autonomie schließe vielmehr auch die Bereitschaft zu Fehlentscheidungen ein, so dass kein Autonomieperfektionismus verlangt werden könne (S. 39). Eine konsistente Präferenzordnung gäbe es weder allgemein noch für das Individuum (S. 40). Ansatzpunkt sei daher nicht die konkrete Entscheidung. Maßgeblich sei vielmehr allein, ob sie (nach dem Maßstab der Durchschnittlichkeit < S. 42: paternalistische Bewertung?>) von einem zur Autonomie Fähigen stamme (S. 40 und 78). Dem nachzugehen sei legitim, aber nur anhand von Indizien möglich (z.B. betroffenes Rechtsgut, Abweichung von sonstigen eigenen Maßstäben <näher S. 78 – 81>, Mittel ungeeignet oder nicht das mildeste, z.B. Ziehen aller Zähne zur Behebung von Kopfschmerzen, vgl. BGH, NJW 1978, 1206). Die Delegation der Ausführungshandlung an einen Dritten könne auf Unsicherheit des Betroffenen deuten, nicht aber dann, wenn Letzterer zur Vornahme physisch nicht in der Lage sei, z.B. aufgrund von Lähmung (S. 42 – 45).
a) Der Gesetzgeber stehe vor der Schwierigkeit, einen generellen Maßstab anlegen zu müssen. Er könne daher nur auf Risiken abstellen und müsse dabei in Kauf nehmen, dass seine Regelung auch Entscheidungen erfasse und damit verbiete, die nicht autonomie-defizitär getroffen wurden (S. 45 f.). Das ist allerdings nicht die ganze Wahrheit, schließlich ist eine Gesetzestechnik möglich, die den konkreten Entscheider auf eine individuelle Prüfung festlegt. Rigopoulou wendet sich anschließend den verfassungsrechtlichen Befugnissen zu, die es der Legislative erlauben, die Anerkennung autonomen Verhaltens einzuschränken. Das Sozialstaatsprinzip stelle eine Gefahr für die von der Menschenwürde, Art. 1 GG (S. 54), und dem allgemeinen Freiheitsgrundrecht, Art. 2 Abs. 1 GG (S. 53, nicht jedoch in dessen Ausprägung als allgemeines Persönlichkeitsrecht, S. 56 f.), geschützte Autonomie dar. Mit ihr verträglich sei Hilfe durchaus, nicht jedoch aufgedrängte (S. 66 f.). In Betracht komme z.B. Schutz gegen zu große Komplexität der Entscheidungsparameter (S. 49). Alle Eingriffe müssten nicht nur dem Übermaßverbot genügen. Vielmehr stelle sich vorgelagert die Frage nach der generellen Erlaubnis des Gesetzgebers (S. 57 f.). Sie liege weder im objektiven Gehalt (S. 60 f.) noch in der Schutzfunktion der Grundrechte, die zugunsten desselben Trägers zur Abwehrfunktion hinzuträten, sie aber nicht einschränkten, sich deshalb nur gegen Dritte wenden ließen (S. 59 f.). Demnach enthalte das GG keine ausdrückliche Norm, die dem Gesetzgeber als Grundlage dienen könnte, autonome Entscheidungen nur eingeschränkt zu respektieren. Er sei aber in der Wahl seiner Ziele frei, solange er damit kein im GG enthaltenes Verbot verletze. Weil Rigopoulou es (ohne nähere Begründung) ablehnt, mit der Verfassungsgarantie der Autonomie eine Grenze zu ziehen, die nur überschritten werden dürfte, wenn sich dafür eine verfassungsunmittelbare Grundlage feststellen ließe, begnügt sie sich mit der Forderung staatlicher Neutralität in dem Sinne, daß die Obrigkeit keine Bewertung eigenverantwortlich verfolgter Motive vornehmen dürfe. Erlaubt sei daher ein Tätigwerden nur zum Schutze Dritter oder der Allgemeinheit (S. 67 – 73). Das Sittengesetz (Art. 2 Abs. 1 GG) hingegen rechtfertige keine paternalistischen Regelungen, stelle es doch bereits keine Eigenschranke für das Handeln des Grundrechtsträgers dar, soweit ihn die Auswirkungen seines Handelns selbst träfen (S. 98 – 100). Es könne auch von niemandem verlangt werden, Mitglied der Gesellschaft zu bleiben (S. 89 – 93). Demgegenüber stelle zwar die Vermeidung sozialer Folgekosten ein legitimes Ziel dar, rechtfertige aber keine Verbote, sondern nur die Verweigerung von Sozialleistungen oder die präventive Besteuerung eigengefährdenden Verhaltens (S. 93 – 98). Ähnlich verhalte es sich mit dem Schutz Dritter vor für sie unangenehmen Erlebnissen und damit verbundener Unlustgefühle. Sie rechtfertigten allerdings örtliche Beschränkungen (S. 85 – 89). Bei Aufstellung verfahrensrechtlicher Hürden müsse zudem immer die Einbuße an Autonomie berücksichtigt werden, sowohl aufgrund der monetären Kosten als auch des Zeitaufwands sowie der psychische Belastung mit der aufgezwungenen Befassung (S. 83). Wer, liebe Leserin und lieber Leser, muß dabei nicht unwillkürlich an seine Steuererklärung denken?
b) Weil Autonomiedefizitäre (Minderjährige, Minderbemittelte) nicht ihre Personalität verlören, stünden sie nicht außerhalb des Anwendungsbereichs der Art. 1 und 2 Abs. 1 GG. Soweit sie trotz Einschränkungen zur Selbstbestimmung in der Lage seien, habe daher der Staat auf solcher Grundlage getroffene Entscheidungen anzuerkennen. Unterstützung im Bereich der Defizite müsse hingegen das Ziel verfolgen, diese auszugleichen, also die Voraussetzungen selbstverantwortlichen Handelns soweit wie möglich zu schaffen (S. 73).
c) Die Analyse der Rechtsprechung des BVerfG ergab kein die Verfasserin befriedigendes Bild, weil das Gericht nicht direkt zur Zulässigkeit paternalistischer Maßnahmen und deren Grenzen Stellung nahm, sondern sich auf andere Begründungselemente kaprizierte (S. 100 – 114). Strafrechtsdogmatische Gründe sprächen eher deutlich gegen als für paternalistische Strafnormen (S. 117 – 130). Die den Konsum unter Strafe stellenden Vorschriften des BtMG (S. 132 – 157) – ein Highlight, unabhängig von Beifall für oder Widerspruch gegen ein bestimmtes Ergebnis – finden ebensowenig Gnade unter Rigopoulous scharfem Blick wie das Verbot des Organhandels nach § 18 Abs. 1 TPG (S. 157 – 188). Legitimierbar sei nur wucherischer Vertrieb bei Straffreiheit für Spender und Empfänger (S. 187 f.). Trotz aller Sympathie für Meinungsstärke und klartextlichen Ausdruck stören hier allerdings emotionale Bewertungen (Beruhigung schlechten Gewissens, S. 183; Scheinheiligkeit, S. 184). Es hätte der Autorin besser gestanden und zudem vollauf genügt, auch hier auf die Überzeugungskraft ihrer Sachargumente zu vertrauen. Erfreulich ist hingegen wiederum, dass Rigopoulou auch einen Blick auf die Hypertrophie der Ordnungswidrigkeiten (so Seebode bereits im Jahre 1986!) warf (S. 188). So hält sie z.B. die Bußgeldbewehrung der Gurtpflicht für unverhältnismäßig (S. 188 – 192).
4. Im 4. Teil befaßt sich Rigopoulou schwerpunktmäßig mit dem indirekten Paternalismus und gelangt – dogmatisch bewundernswert rigoros – zu dem Ergebnis, dass es keiner Unterscheidung gemäß der h.M. zwischen einvernehmlicher Fremdschädigung und unterstützter (= interaktiver, S. 194) Selbstschädigung bedürfe. Strafbares und erlaubtes Handeln scheide sich allein nach dem Prinzip der Selbstverantwortung (S. 195 – 198 und 259). Einvernehmlich-fremdschädigendes Verhalten sei solange nicht strafwürdig, wie dem Betroffenen auch noch nach dem Handeln des Dritten die Möglichkeit zu freier Entscheidung und wirksamer Einwirkung zur Vermeidung des Eintritts der Folgen verbleibe (S. 227 f.) und der Dritte keinen übergewichtigen Einfluss ausübe (S. 229). Die Ergebnisse decken sich allerdings – was Rigopoulou ebenso unumwunden wie souverän selbst einräumt und die Überzeugungskraft ihrer Systematik keineswegs schmälert – weitgehend mit denen der Rechtsprechung, die darauf abstellt, wer im entscheidenden Moment, dem letzten, zu dem eine Umkehr möglich ist, die Tatherrschaft innehat. Dabei komme es, Murmann folgend, nicht darauf an, ob der Dritte mehr wisse als der Betroffene, sondern allein maßgebend sei, ob Letzterer genügend wisse, um das Risiko zu kennen und seine Entscheidung wie sein Verhalten darauf eigenverantwortlich zu stützen (S. 290).
5. Abschließend wendet sich Rigopoulou den §§ 216 und 228 StGB zu (S. 294 – 315). Sie fasst beide Bestimmungen als (enge) Ausnahmen vom Prinzip der Straffreiheit der Verfügung über eigene Rechtsgüter auf, die sich jedoch weich paternalistisch rechtfertigen ließen. Die Folgen etwaiger Tathandlungen (Körperverletzung, erst recht der Tod) seien so gravierend, dass ein Dritter nie sicher wissen könne, ob der Betroffene tatsächlich über seine Einwilligung autonom entschieden habe. Daher sei es angemessen, von Gesetzes wegen klarzustellen, dass kein Außenstehender dem Betroffenen die Letztentscheidung abnehmen dürfe, widrigenfalls er seine Bestrafung riskiere. Das gelte auch in Ansehung des Paradoxons, dass dem Dritten die Privilegierung gegenüber §§ 212 oder gar 211 StGB bei in Wahrheit gar nicht ernstlichem Tötungsverlangen zu Unrecht zu Gute komme und er umgekehrt bei tatsächlich ernsthaftem Tötungsverlangen materiell zu Unrecht bestraft werde, § 216 StGB also nie den angemessenen Strafrahmen zur Verfügung stelle (S. 308 unter Berufung auf Frank Müller). Es beschleichen einen allerdings leise Zweifel, ob diese Begründung wirklich der inneren Logik der Argumentationskette Rigopoulous gemäß ist und nach diesen Maßstäben die Ausnahmslosigkeit der Strafdrohung in allen von §§ 216 und 228 StGB erfaßten Fällen tatsächlich rechtfertigen kann, also auch dann, wenn es an der Eigenverantwortlichkeit der Entscheidung nach menschlichem Ermessen keinen Zweifel gibt. Sollten diese leisen Zweifel gerechtfertigt sein, so würden sie immerhin belegen, dass die Klarheit der Gedanken sich durchaus mit pragmatischem Handeln verträgt, ja einen sachlichen Kompromiss vielleicht sogar erst möglich macht. Zweifelsfrei ist Rigopoulou in der Feststellung zuzustimmen, dass niemand Drittes hundertprozentig wissen kann, wie es im Innern eines anderen wirklich aussieht. Anerkennung verdient ihr Maßstab aber zumindest deshalb, weil er mit dem Abstellen auf die Freiheit der Selbstbestimmung Pflöcke gegen paternalistische Ausweitungstendenzen (z.B. durch Übertragung des Rechtsgedankens auf andere Situationen in der Wirksamkeit bezweifelter Einwilligungsfähigkeit) einschlägt.
III. Schade, dass es zu Ende, das Buch ausgelesen ist. Es ist zu hoffen, daß Rigopoulou sowohl ihren Stil beibehält als auch in Deutschland noch Vieles publiziert. Der Extrakt für die Wirtschaftskriminalität?
1. Dem Strafrecht vorgelagert ist das jeweilige Sachrecht. Es wäre wünschenswert, nähme sich der Gesetzgeber schon insoweit ihre Warnung vor paternalistischem Gehabe zu Herzen. Die Belehrungspflichten der Banken gegenüber Anlagewilligen, die zum Versand üppiger Formulare führten, die kein Verbraucher in ihrer ganzen Tragweite wirklich verstehen kann, wenn er sich die Lektüre denn wirklich antut, die ihm aber seine Chancen nehmen, die Anlagegesellschaft oder die vermittelnden Geldinstitute für erlittene Verluste haftbar zu machen (cross-border-Verträge mit US-Unternehmen füllten Papiere mit vierstelligen Seitenzahlen und bewahrten die verkaufenden Kommunen trotzdem nicht vor Verlusten in Millionenhöhe – Beleg für Rigopoulous Warnung vor Autonomieperfektionismus nach dem Maßstab des Allwissenden, S. 38 f.), das faktische Arbeitsverbot für Leistungsgeminderte, vulgo: Mindestlohn, und die ausnahmslose Verpflichtung Selbständiger, sich trotz nicht vorhandener Mittel gegen z.B. Krankheit zu versichern, die zum nachträglichen (teilweisen) Erlass der horrend angewachsenen Beitragsschulden führten, beleuchten schlaglichtartig, wie die Grundeinstellung Rigopoulous dem aktuellen Mainstream entgegensteht. Bedenkt man, dass in den Verträgen ausgeführte Risiken das strafrechtliche Risiko für die Verantwortlichen der Kommunen nur erhöhen und finanzschwache Arbeitgeber aufgeben müssen, wollen sie weder Buße für die ressourcenbedingte Unterschreitung des Mindestlohns als solchen noch für die unterlassenen Abgaben auf die Phantomlöhne riskieren – ja, beides ist juristisch vermeidbar, aber welcher ums wirtschaftliche Überleben bemühte Arbeitgeber kann sich den dafür erforderlichen qualifizierten Rechtsrat schon leisten? – so klingelt einem Rigopoulous Warnung vor selbst weich paternalistischen strafrechtlichen Mitteln in den Ohren.
So fraglos Solidarität mit Bedürftigen geboten ist: Besteht sie nicht, soweit möglich, in Hilfe zur Selbsthilfe, sondern in (durchaus vorrangig: außerstrafrechtlichem) Paternalismus, so ist sie ein zweischneidiges Schwert. Nicht nur, dass diesem die Tendenz zu Überforderung des Paters innewohnt – um wieviel Alltägliches, das ihn originär gar nichts angeht, soll sich der Staat denn noch kümmern? – er zwingt ihn geradezu zur Kontrolle von allem und jedem und verlangt dafür eine Bürokratie, wie sie nicht nur die Staaten des früheren Warschauer Pakts lähmten. Auf der Seite der Umsorgten nimmt zwangsläufig nicht nur mit zunehmender Gewöhnung die Freude an der gewährten Hilfe ab, weicht steigender Unzufriedenheit und zunehmendem Anspruchsdenken, sondern läßt auch die bei jedem vorhandenen Talente verkümmern. Kurz: Paternalismus schwächt, was es zu stärken gilt! Schon dies sollte ausreichen, vor einschlägigen Regelungen wenn nicht zurückzuschrecken, so doch jedenfalls nur zurückhaltend, ausnahmsweise und nur bei Vorhandensein sehr guter Gründe Gebrauch zu machen. Schaut man sich die Ergebnisse an, so drängt sich allerdings noch eine ganz andere Frage auf: Woher haben denn die Paternalisten eigentlich ihre Weisheit? Können sie überhaupt wissen, was für andere richtig ist? Können sie das besser wissen als die Umhegten? Oder legen sie vielleicht nur ihre eigenen Maßstäbe an und Interessen zugrunde? Scheinbar Gutes für andere zu tun, fördert zumindest das eigene Ansehen.
2. Die exakten Analysen der Autorin stehen aber auch vorschnell gezogenen Parallelen entgegen. Führt sie aus, dass die Kehrseite des Prinzips der Selbstverantwortung darin bestehe, nicht für frei verantwortete Entscheidungen Dritter eintreten zu müssen (S. 199), so assoziiert derjenige, der schon einmal mit der Verantwortlichkeit in hierarchisch gegliederten Einheiten zu tun hatte, unvermeidlich das Stichwort Geschäftsherrenhaftung. Danach steht das verschuldete Handeln des unmittelbaren Täters der täterschaftlichen Haftung des Hintermannes nicht entgegen. Der zweite Blick zeigt jedoch, dass dies kein Problem des Paternalismus darstellt, denn der Hintermann soll dem unmittelbaren Täter weder dessen Verantwortung ab-, noch sie übernehmen, sondern nur sein eigenes Verhalten verantworten. Das aber ist ein völlig legitimes Anliegen der Rechtsgemeinschaft. Wie ihm rechtstechnisch Rechnung getragen werden soll, steht sicherlich der Diskussion offen. Kritikern der aktuellen Ausgestaltung liefert Rigopoulou jedoch keine Argumente.
3. Demnach ist gerade auch für mit dem Wirtschaftsstrafrecht Befasste die Lektüre des Werks von Rigopoulou nichts als gewinnbringend!