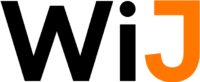Dennis Philipp Reschke, Untreue, Bankrott und Insolvenzverschleppung im eingetragenen Verein
Duncker & Humblot, Strafrechtliche Abhandlungen, Neue Folge Band 256, Berlin 2015, 99,90 €, zugleich Dissertation WS 2013/2014, Universität Konstanz
I.
1. Der eingetragene Verein, „Mutter“ aller juristischen Personen – das unbekannte Wesen! Dieser Diagnose will Reschke den Boden entziehen und untersucht zu diesem Zweck Probleme, die sich bei der GmbH und der AG stellen und dort rege diskutiert werden. Die Fülle des verarbeiteten Materials ist beeindruckend – ebenso die Kombination aus Denkvermögen und Phantasiebegabung. Alles, was dennoch nicht begeistert, ist demgemäß auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt und erlaubt die Kritik vielfach gerade erst deswegen, weil Reschkes Darstellung nicht nur auf der Höhe der Zeit ist, sondern auch tief in noch nicht erschlossene Lücken leuchtet. Wer will es ihm verübeln, wenn er dabei nicht jede abgestellte Kiste angehoben, sämtliche Einzelteile betrachtet und für alles eine nach allen Seiten hin abgeklopfte Lösung präsentiert?
2. Reschke wählte eine Darstellungsform, die zumindest für Dissertationen ungewöhnlich ist. Er sah nämlich von isolierten Darstellungen sowohl des Rechts des eingetragenen Vereins als auch der untersuchten Tatbestände ab. Vielmehr skizzierte er die Vereinsstrukturen (noch dazu im Vergleich zwischen den §§ 21 ff. BGB und dem öffentlich-rechtlichen VereinsG) nur äußerst knapp (S. 33 – 39), Organe sind Mitgliederversammlung und Vorstand, wobei die Geschäftsführungsbefugnis delegationsfähig ist (S. 37 – 39), und widmete sich den tatbestandlichen Themen in Bezug auf ihre Relevanz für das Recht des eingetragenen Vereins. Diesen verlor er nie aus dem Blick, ohne jedoch seine Vorliebe für die spezifisch tatbestandlichen und über die Bedeutung für den Verein hinausragenden Fragen (v.a. bei der Untreue) zu verheimlichen. Die 240 Seiten des 2. Kapitels zu diesem Tatbestand gerieten ihm so zu einer monographischen Darstellung auch nahezu aller aktueller Fragen des § 266 StGB.
3. Der eingetragene Verein als Prototyp gemeinschaftlichen bürgerschaftlichen Engagements steht für Reschke als Synonym für das aus der Mode geratene Ehrenamt (S. 21). Interessant sind seine statistischen Angaben: Während sich die Insolvenzquote bei der GmbH auf 39,5 % belaufe, betrage sie beim Verein nur 0,8 % (S. 25), obwohl entfallende öffentliche Zuschüsse häufig das wirtschaftliche Ende des Vereins bedeuteten (S. 26). Eindrucksvoll fällt auch die Übersicht über das reale Handeln in Vereinsform aus: Den ADAC und Vereine der Fußballbundesliga mag noch jeder Leser kennen. Es erstaunt jedoch, dass zudem auch die Max-Planck-Gesellschaft ebenso wie die Bundespressekonferenz und die CSU als e.V. organisiert sind (S. 26 f.). In der Rechtsprechung entschiedene Fälle führen Reschke zu der Frage, ob nicht gerade die mangelnde Bezahlung der Funktionäre kleiner Vereine deren Selbstbedienungsmentalität fördere (S. 28 f.). Es wäre einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung wert, diesen Informationen und ihren Ursachen einmal näher nachzugehen. Jedenfalls leitet die Frage nach der (Un-)Moral mancher Vereinsfunktionäre zwanglos auf die Darstellung der Untreue über.
II.
1. Vorangestellt ist quasi programmatisch für die nachfolgende Untersuchung die Beschreibung der näher zu betrachtenden Themen: Anwendbarkeit der business judgment rule, Einwilligungsfähigkeit und Entziehung der Gemeinnützigkeit als Nachteil (S. 32). Die Fragen nach der Verbraucherqualität des Idealvereins und dem Maßstab für ordnungsgemäßes Wirtschaften (S. 32, S. 143 und passim) weisen auf ihre Relevanz auch für den Bankrott (S. 317, aber auch 318 f.) hin. Die Befassung mit dem nicht eingetragenen Verein führt bereits zu einem Kernproblem der Untreue: Wiewohl zivilrechtlich trotz § 54 BGB eingetragener und nicht eingetragener Verein nahezu gleich behandelt würden, scheide dies sub specie § 266 StGB deshalb aus, weil mit der h.M. anzunehmen sei, dass Rechtsträger des Vereinsvermögens beim nicht rechtsfähigen Verein nur die Mitglieder als natürliche Personen sein könnten, während ebenfalls mit der h.M. anzunehmen sei, dass die juristische Person e.V. selbst Rechtsträger sei (S. 33 – 37, 67 – 80). Nach einem Blick auf die mit dem BVerfG bejahte Verfassungsmäßigkeit des § 266 StGB (S. 40 – 56) und der Bejahung der Anwendbarkeit der Vorschrift auch im non-profit-Bereich (S. 56 – 67) wendet sich Reschke Vereinsspezifika wie der Vermögensbetreuungspflicht (S. 81 – 86) des Vorstands (S. 87 f.) und des Notvorstands, § 29 BGB (maßgeblich: Bestellungsakt, S. 88 – 95), besonderer Vertreter, § 30 BGB (S. 95 – 97), des Liquidators (S. 97 – 100), der einfachen Vereinsmitglieder (nur bei Übernahme von Aufgaben über die eigentliche Mitgliedschaft hinaus, S. 100 – 115), Mitarbeiter (S. 115) und faktischer Organe (differenzierend, S. 115 – 123) zu.
§ 4 des 2. Kapitels bildet unter Befassung mit dem Thema „Pflichtwidrigkeit“ einen Schwerpunkt der Arbeit. Reschke betrachtet aufgrund des Rechtsguts konsequenterweise nur die Verletzung vermögensbezogener Pflichten als relevant (S. 126 f. m. Fn. 482, 136 – 140). Als Quellen kämen Satzung, Mitgliederversammlung, Vertrag und die allgemeine Stellung in Betracht (S. 128 – 133). Vorteilsgewährung, § 333 StGB (S. 141), und Verstöße gegen die Gemeinnützigkeit (S. 142) verletzten nicht per se die Vermögensbetreuungspflicht gem. § 266 StGB, es sei denn, damit würden zugleich vereinsinterne Vermögensbetreuungspflichten verletzt (Ansatz entsprechend BGH, NJW 2012, 3797 f. – Kölner Parteispenden). Fragen des Risikogeschäfts stellten sich nicht nur bei Spielertransfers, sondern auch beim Betreiben von open-air-Imbissen im Hinblick auf Wetterunbilden (S. 143).
2. Die Anwendung der business judgment rule (S. 144 – 164) beschränkt Reschke zutreffend auf Entscheidungen mit Ermessenspielräumen (S. 147), während Verstöße gegen zwingende (vermögensbezogene) Regeln per se pflichtwidrig seien. Hinzuzufügen wäre noch, dass hierin kein Widerspruch dazu besteht, dass eine Vermögensbetreuungspflicht regelmäßig nur im Fall vorhandener Entscheidungsfreiheiten anzunehmen ist, weil sich die Bezugstatsachen unterscheiden (Faustregel: „ob“ = frei; „wie“ kann auch gebunden sein). Die Domäne der business judgment rule stellten daher zukunftsbezogene Prognosen dar. So richtig wie dies ist, so wenig lässt sich daraus entgegen Reschke allerdings schließen, sie seien nicht justitiabel. Das gilt nämlich nur für sorgfaltsgemäß erstellte Prognosen, nicht hingegen für aus der Luft gegriffene oder lediglich wohlklingend bezeichnete persönliche Wünsche.
Die Befassung mit den Tatbestandsvoraussetzungen des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG ist informativ. Für den Gedankengang und das Ergebnis ausschlaggebend ist sie hingegen nicht, denn auch jenseits der Tatbestandsvoraussetzungen der business judgment rule ist die Pflichtwidrigkeit (ungebundener) Entscheidungen nicht präjudiziert (S. 146 mit Fn. 573). Jenseits der business judgment rule übernimmt nämlich das Ermessen die Funktion, die Straffreiheit jeder innerhalb des Spielraums liegender (sachgerecht getroffener) Entscheidung zu sichern. Der Zusammenhang zwischen den Grenzen rechtmäßiger Ausübung von Ermessen und der Frage nach der Notwendigkeit der Beschränkung der tatbestandsmäßigen Pflichtwidrigkeit auf gravierende Verstöße beschäftigt Reschke im nachfolgenden Teil (S. 164 – 185). Hier verrennt er sich jedoch: Das BVerfG hat das Restriktionspotential dieses Kriteriums bestätigt (BVerfGE 126, 170 ff., Rn. 111). Obwohl Reschke diese Ausführungen dahingehend überinterpretiert, der Senat habe es zu einem Verfassungsgebot erhoben (S. 165), sieht er sich nicht an seinem Fazit gehindert, die bisherigen Versuche seiner Interpretation und Anwendung seien mit verfassungsrechtlichen Anforderungen unvereinbar (S. 183). Den Grund dafür sieht er darin, dass das Zivilrecht selbst die nötige Höhenmarke normiere und es bislang nicht gelungen sei, eine rechtssichere zusätzliche Linie der strafrechtlichen Relevanz zu definieren.
Diese Analyse trifft zu. Richtig ist zudem, dass es keiner eigenständigen strafrechtlichen Höhenmarke bedarf, wo bereits das Sachrecht große Spielräume enthält. Ist bereits deren Überschreitung nur im Fall der Evidenz rechtswidrig, so ist nichts dagegen einzuwenden, denselben Maßstab auf das Strafrecht zu übertragen: Unvertretbares Handeln darf bestraft werden. Hier erfüllt bereits das Sachrecht das Anliegen, nicht gleich jeden kleinen Fehler mit Strafe zu bedrohen. Zivil- und Verwaltungs-, insbesondere jedoch das Finanz- und Sozialrecht begnügen sich allerdings nicht mit ausfüllungsfähigen Regelungen. Im Gegenteil, sie legen teilweise liebevoll ausdifferenziert in hoher Normendichte und von der Rechtsprechung noch zusätzlich ausgebaut durchaus vermögensbezogene Pflichten zwingend fest. Die undifferenzierte Pönalisierung der bloßen Verletzung irgendeiner derartigen Bestimmung würde tendentiell zu einem Volk von Vorbestraften führen! Hier ist es daher unbedingt erforderlich, zwischen Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit eine zusätzliche Hürde aufzubauen. Angesichts der Vielzahl heutiger Detailpflichten kann und darf es nicht sein, jeden zivil- oder verwaltungsrechtlich relevanten Verstoß zur strafbaren Handlung hochzujazzen. Das sieht Reschke nicht anders. Jedoch beugt die angesichts ihres zwingenden Charakters von ihm (S. 180) befürwortete restriktivere Auslegung des Sachrechts seitens der Strafjustiz nicht ausreichend vor: Auch eine bei aller Zurückhaltung bejahte Verletzung des Sachrechts bleibt eine solche und begründet das Verdikt der Rechtswidrigkeit. Nicht jede Missachtung einer dieser zwingenden Normen ist sub specie § 266 StGB aber für sich ausreichend gewichtig, um als strafbare Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht angesehen werden zu können. Nur Pflichtverletzungen in einem erheblichen Ausmaß sind strafwürdig. Das bedeutet, dass es – nur, aber gerade – jenseits von Entscheidungsspielräumen eines Schwerekriteriums bedarf, welches neben das Erfordernis des Vermögensbezugs tritt und nicht wie bei Reschke in ihm aufgehen kann.
Obwohl Reschke in seinem Befund insoweit uneingeschränkt zuzustimmen ist, dass es bislang nicht gelungen ist, eine rechtssichere Handhabung für ein Instrument zu entwickeln, welches die Relevanz sachrechtlich zwingend anzunehmender Pflichtverletzungen auf ihren strafwürdigen Kern reduziert, gilt es jedoch, sich dieser Aufgabe weiterhin zu stellen. Gelingen kann das vermutlich nur fallbezogen. Ob sich Generalisierungen definieren lassen, bleibt abzuwarten. Evidenz ist demnach zwar kein hartes Entscheidungskriterium, wohl aber ein Aspekt, der die Richtung weist, die die gewünschte Lösung dereinst verheißt.
3. Auf sehr hohes Niveau führt Reschkes Diskussion der Frage der Einwilligungsfähigkeit der juristischen Person in vermögensschädigende Handlungen z.B. seiner Repräsentanten (S. 185 – 228), innerhalb derer er zutreffend das Institut der Existenzvernichtungshaftung auch im Rahmen des eingetragenen Vereins für anwendbar hält (S. 204 – 227). Keine Probleme bereiteten im Hinblick auf die Einwilligung rechtmäßige Beschlüsse der Mitgliederversammlung: Da es keine „Mehrheitsgesellschafter“ gäbe, sondern jedes Vereinsmitglied nur über eine Stimme verfüge, reiche das Mehrheitsprinzip aus, selbst wenn man es für die AG nicht ohne Grund in Zweifel ziehe (S. 196 f.). Heikel wird es jedoch bei der Frage, ob auch rechtswidrige Beschlüsse einwilligenden und damit zur Straflosigkeit führenden Charakter haben können. Der Lösung nähert Reschke sich in Anlehnung an die im Rahmen des § 283 StGB geführte (und von ihm später dort auch aufgenommene, S. 287 – 302) Diskussion über die an die Stelle der aufgegebenen Interessentheorie getretenen Kriterien zum Handeln „als“ Organ i.S. von insbesondere § 14 Abs. 1 S. 1 StGB. Das ist verdienstvoll, obwohl es Reschke nicht durchweg gelingt, die ineinander verwobenen Argumentationsstränge zu entheddern.
a) Für §§ 283, 14 StGB entwickelte im wesentlichen Radtke das sog. Zurechnungsmodell als Alternative zur Interessentheorie: Immer wenn der Repräsentant, Prototyp: der GmbH-Geschäftsführer, in dieser Funktion tätig wurde, handelte er „als“ Organ. Damit gelangt man im rechtsgeschäftlichen Bereich zu sachgerechter Abgrenzung, während es bei tatsächlichem Handeln nicht immer eindeutig ist, ob der Repräsentant als solcher oder wie ein beliebiger Dritter tätig wurde. Diese Schwierigkeiten versucht der das Zurechnungsmodell weiterentwickelnde organisationsbezogene Ansatz von Christian Brand zu verringern. Es ist auf § 283 StGB als Selbstschädigungsdelikt zugeschnitten und fragt zunächst danach, wann das Handeln eines Repräsentanten als solches der juristische Person zu gelten habe. Die Antwort entwickelte Brand für das Gebiet des tatsächlichen Handelns unter strikter Aktivierung der Lehre von der Zurechnung und gelangte zu dem Ergebnis, nur das Handeln des (z.B.) Organs, welches in den vom Gesetz vorgesehenen Formen und unter Einhaltung seiner Vorschriften geschehe, müsse sich die juristische Person zurechnen lassen.
b) Dieser organisationsbezogene Ansatz litt von Anfang an daran, dass er nicht nur, zumindest für den Bereich tatsächlichen Handelns, nahezu deckungsgleiche Ergebnisse wie die überwundene Interessentheorie zeitigt, sondern in letzter Konsequenz dazu führt, der juristischen Person die Fähigkeit zu rechtswidrigem Handeln, vielleicht sogar, aber dies bedürfte näherer Prüfung, auch auf rechtsgeschäftlichem Sektor, abzusprechen. Das jedoch ist weder einzusehen, noch lässt es sich mit z.B. § 30 OWiG vereinbaren: die Bestimmung sanktioniert die juristische Person selbst (obwohl auch in diesem Rahmen die Frage nach dem Grund heftig diskutiert und z.T. mit Zurechnungserwägungen bejaht wird, die hier geführte Diskussion dort also partiell wiederkehrt).
Während es bei § 30 OWiG um die Beantwortung der direkten Frage geht, wann ein Verhalten einer natürlichen Person die (ordnungswidrigkeitenrechtliche) Verantwortung des Verbands auslöst, ist der strafrechtliche organisationsbezogene Ansatz komplexer, geht es doch dabei nicht um die repressive Haftung der juristischen Person, sondern um diejenige ihres Organs. Die Frage, unter welchen Umständen das Handeln eines Repräsentanten der juristischen Person zugerechnet werden kann, ist daher nur eine Vorfrage für die Ahndung der natürlichen Person. Brand hält sie wegen des Charakters des Bankrotts als Selbstschädigungsdelikt für zwingend beantwortungsbedürftig. Dem kann man nicht allein mit einer Kritik am Begriff widersprechen: bei Insolvenz einer natürlichen Person geschehen Verheimlichen und Beiseiteschaffen in aller Regel eigennützig, also gerade nicht schädigend. Maßgeblich ist für den organisationsbezogenen Ansatz aber nicht eine etwaige Schädigung, sondern dass der Schuldner selbst es ist, der handelt und die Tat begeht. Mit der schlichten Modifikation zum „Selbsthandlungsdelikt“ lässt sich die begriffliche Hürde also leicht überwinden.
c) Damit ist jedoch das inhaltliche Problem noch nicht gelöst. Ob und wie das geschehen kann, mag hier dahinstehen. Dass die juristische Person für inhaltlich rechtswidrige Beschlüsse ihrer Gremien einstehen muss, erscheint jedoch prima facie als nötig. Warum es bei tatsächlichem Handeln anders sein soll, ist demnach zumindest begründungsbedürftig. Jenseits des Bankrotts ist z.B. die Zurechnung von Produktschäden zum Unternehmen selbst auch nicht fraglich. Es ist demnach keineswegs zwingend, für den Bankrott auf eine naturalistische Parallele zum Handeln eines Menschen abzustellen. Auch das Versagen ihrer Organe und sonstigen Repräsentanten ist oder gilt als Versagen der juristischen Person. Allein damit erweist sich für den Bankrott als Selbsthandlungsdelikt die zweigliedrige Zurechnung i.S. des organisationsbezogenen Ansatzes noch nicht als unnötig – eine Prüfung der Erforderlichkeit dessen bedürfte vertiefter Untersuchung. Es zeigt sich jedoch, dass die Beschränkung der Zurechnung auf in jeglicher Hinsicht rechtmäßiges Handeln kein notwendiger Bestandteil des organisationsbezogenen Ansatzes ist. Sollte das zutreffen, so liegt die Erledigung der wesentlichen Aufgabe noch in der Zukunft: Kann der juristischen Person überhaupt rechtswidriges Handeln eines Repräsentanten zugerechnet werden – Bejahung des „ob“ – so bedarf es der Prüfung, unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist – Klärung des „wie“. Vielleicht können Überlegungen aus den Rechtsinstituten der Anscheins- und Duldungsvollmacht, der Fahrlässigkeit, der Gefährdungs- und der Geschäftsherrenhaftung dazu fruchtbar gemacht werden, ggf. auch die Unterscheidung Wirksamkeit/Unwirksamkeit. Obwohl es gerade um die Frage der Zurechnung zum Verband geht, mag auch der Grundsatz in die Prüfung einfließen, dass Handeln des Organs Handeln der juristischen Person ist. Darin könnte eine Tür liegen, welche dem Repräsentanten eine gewisse Definitionsmacht eröffnet. Mag sein, dass sogar die Dogmatik der Schuldfähigkeit einschlägige Aspekte enthält, stellt doch das Strafrecht verschiedentlich trotz fehlender Schuldfähigkeit auf den natürlichen Willen ab.
d) Reschke schließt sich nicht nur für den Bankrott den Erkenntnissen Brands an (S. 287 – 302), sondern sie dienen ihm zudem als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Einwilligungsmodells in Schädigungen des eingetragenen Vereins. Strukturell kehrt auch hier die Zweigliedrigkeit wieder: Die Konsentierung seitens der juristischen Person, diesmal: Verein, ist bedeutsam für die Frage der Strafbarkeit des Repräsentanten. Während beim Bankrott allerdings die Zurechnung tatbestandsbegründend ist, führt sie sub specie § 266 StGB im Fall wirksamer Einwilligung zum Entfallen des Tatbestandsmerkmals der Pflichtwidrigkeit. Das betrifft jedoch lediglich die jeweiligen Folgen und stellt die strukturelle Vergleichbarkeit nicht in Frage. Reschke geht insoweit über Brand hinaus, als er Grenzen der Einwilligungsfähigkeit (Satzungs- oder sonstige Rechtsverstöße) bereits für rechtsgeschäftliches Handeln und Gremienbeschlüsse für relevant erachtet (z.B. S. 198). Er durchbricht den organisationsbezogenen Ansatz dann jedoch in pfiffiger Rechtsgutsbetrachtung: Nur die Verletzung vermögensschützender Bestimmungen hindere die Wirksamkeit der Einwilligung (S. 219 – 225).
e) Mit der Gleichsetzung von (hier auf Verstöße gegen vermögensschützende Vorschriften begrenzter) Rechtswidrigkeit und Unwirksamkeit bewegt sich Reschke innerhalb der strafrechtlich h.M. Im Zivil-, Verwaltungs- und Prozessrecht wird jedoch unterschieden zwischen Anfechtbarkeit und Nichtigkeit. Regelmäßig geht es, zumindest in den von Reschke angeführten Beispielsfällen, nicht um Nichtigkeit, sondern um Anfechtbarkeit. Rechtswidrige Beschlüsse sind demnach zunächst wirksam und folglich kein juristisches Nullum. Demnach ist die strafrechtliche Gleichsetzung jedenfalls nicht selbstverständlich. Sie gilt auch repressionsrechtlich nicht durchgängig: Straßenschilder müssen selbst dann beachtet werden, wenn sie rechtswidrig aufgestellt sind. Im Umweltrecht führt eine rechtswidrige Genehmigung zumindest nicht durchweg zur Bestrafung des von ihr Gebrauch machenden Bürgers. Verstöße gegen das Ausländerrecht sind zum Teil sogar bei korruptiv erwirkten Visa verneint worden. Eine (vermögens-)rechtswidrige Einwilligung in einem Beschluss der Mitgliederversammlung dürfte deshalb jedenfalls nicht in allen Fällen als strafrechtlich unwirksam behandelt werden. Ob sich das Organ hingegen auf die Wirksamkeit berufen kann, wenn es die (Vermögens-)Rechtswidrigkeit des Beschlusses kannte, ist eine ganz andere und i.E. zu verneinende Frage. Aber auch bei Gleichsetzung von Rechtswidrigkeit und Unwirksamkeit muss ein gutgläubiges Organ seine Bestrafung nicht fürchten, handelte es doch in einem Erlaubnistatbestandsirrtum, der bei der Untreue nicht erst zum Entfallen der Rechtswidrigkeit, sondern bereits zum Verneinen des Tatbestands führt .
f) Reschkes Mut, inakzeptable Ergebnisse des auf die Untreue übertragenen Organisationsmodells, nicht einfach zu akzeptieren, die er aber im Rahmen des Bankrotts dann jedoch trotzdem hinnimmt (S. 299 – 302), verdient jede Anerkennung. Dass er allerdings überhaupt zu seinen intelligenten, nichtdestotrotz jedoch umständlichen Erwägungen veranlasst wurde, weist darauf hin, dass das Organisationsmodell selbst noch nicht das Ende der Überlegungen markiert.
4. Obwohl Reschke sich im Zuge seiner Befassung mit dem Nachteil auf die Frage konzentriert, ob der Entzug der Gemeinnützigkeit untreuerechtlich relevant ist, diskutiert er (wohl) sämtliche Themen, die nach der Grundsatzentscheidung des BVerfG vom 23.6.2010 (wieder) aktuell sind – erneut auf hohem Niveau. Reschke stellt im Block (in Abweichung seiner Handhabung für Verein und Straftatbestand, aber sehr hilfreich) die Regelung der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit und ihre Vorteilhaftigkeit für den Verein dar (S. 233 – 240) und propagiert die Einheitlichkeit des Schadensbegriffs für alle Vermögensdelikte (S. 230 f.). Ausführlich prüft er, ob bereits die drohende Entziehung der Gemeinnützigkeit einen Schaden darstellt. Zu diesem Zwecke befasst er sich ausführlich mit der Gefährdung als Schaden und hält sie auch im Rahmen der Untreue für relevant. Den Einwänden dagegen tritt er souverän entgegen. Zwar normiere § 266 StGB im Gegensatz zum Betrug keine Versuchsstrafbarkeit, doch entfalte dies keinen Einfluss auf das Verständnis des Merkmals „Nachteil“ (S. 243, inkonsequent allerdings S. 266). Dass die Anerkennung eines Gefährdungsschadens nicht im Widerspruch zur fehlenden Strafbarkeit des Untreueversuchs steht, untermauert er mit dem Hinweis, der (tatsächlich denkbare) Versuch eines Gefährdungsbetrugs sei strafbar (S. 243 f.). Zudem sei es methodisch inkorrekt, die Weite der Tathandlung „Pflichtwidrigkeit“ mit einem zu engen Verständnis des Schadensbegriffs kompensieren zu wollen (S. 244). Das verstoße gegen das Verschleifungsverbot (ein kluger und im Ergebnis zutreffender Gedanke, wenngleich in Bezug auf das Verschleifungsverbot hier nicht wie sonst mit strafbarkeitsbeschränkender Wirkung).
Die Notwendigkeit der Anerkennung bereits der Gefährdung als Schaden folgert Reschke aus der Besonderheit des Rechtsguts Vermögen: Während andere Rechtsgüter (Leben, Gesundheit – von ihm statisch genannt, was sie im wahren Leben ja nun leider nicht sind, wenn auch aus anderen als Rechtsgründen) an Integrität erst aufgrund des Verletzungserfolgs einbüßten, vermindere rein tatsächlich bereits die Gefährdung den Wert des Vermögens (S. 245 f.) – eine gewiss zutreffende Analyse. Damit stellte sich nun aber die Aufgabe herauszufinden, unter welchen Umständen eine Gefährdung das Vermögen mindere (S. 250). Reschke sucht die Lösung zu Recht im objektiven Tatbestand, verwirft die bisherigen Ansätze mit Ausnahme desjenigen des Bundesverfassungsgerichts und gelangt auf diese Weise zum Quantifizierungsgebot (S. 254 – 256).
a) aa) Damit steht er nun vor der selbstgestellten Frage, wie hoch denn der Nachteil des Risikos der Entziehung der Gemeinnützigkeit für den Verein sei. Seine Antwort lautet, eine Quantifizierung sei unmöglich (S. 256 – 261). Damit hätte er diesen Teil der Überlegungen enden lassen können. Statt dessen wendet er sich der Reichweite des Quantifizierungsgebots zu und interpretiert das BVerfG innovativ dahingehend, dass die Notwendigkeit, den Nachteil zu beziffern, entgegen einigen (aller bisherigen?) Stimmen im Schrifttum nicht als allgemeingültig zu verstehen sei mit der Folge, dass ohne Quantifizierung notwendigerweise freizusprechen sei (S, 262), sondern dass jenseits der Erfüllbarkeit des Quantifizierungsgebots der Platz für normative Überlegungen angesiedelt sei (S. 263 f.).
Der Ansatz, jenseits des Quantifizierungsgebots sub specie § 266 StGB nicht nur Straffreiheit zu propagieren, ist zutreffend. Diesen Befund jedoch der Rechtsprechung des BVerfG zu entnehmen, ist kühn. Gleichwohl bleibt der Gedanke richtig, dass überall dort, wo es keinen Marktpreis gibt, der Nachteil auf andere Weise bestimmt werden können muss. Oldtimer kosten heute so viel und morgen das Doppelte oder die Hälfte. Warum soll es zur Verurteilung nicht genügen, den Wagen zu beschreiben, wenn er pflichtwidrig verscherbelt wurde? Warum diese Art der Bestimmung des Nachteils allerdings eine normative sein soll, erklärt Reschke nicht und erschließt sich dem Rezensenten auch nicht. Das ändert allerdings nichts an dem Befund, dass die verbale Beschreibung des Nachteils eine ausreichend bestimmte und damit taugliche Alternative zur Quantifizierung in Geld darstellt. Der h.M. entspricht dies jedoch (noch) nicht.
bb) Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, was denn alles als Nachteil beschrieben werden könne und müsse, wird Reschke zum Befürworter des Unmittelbarkeitskriteriums in Form der Lehre Saligers (S. 267 – 276). Unmittelbar und damit tatbestandsrelevant ist danach nur eine automatisch oder aufgrund auf Null reduzierten Ermessens eintretende Folge (S. 273). Demgemäß verwundert weder das Lob für den 5. Strafsenat des BGH (BGHSt 54, 44 ff.), der in der Entscheidung zur Berliner Straßenreinigung erstmals auf die Unmittelbarkeit abstellte, noch die Schelte für den 1. Strafsenat, der es in der Entscheidung zur Kölner Parteispendenaffäre (BGHSt 56, 203 ff.) verwarf. Die Lösung sucht Reschke auch hier (und in Übereinstimmung mit Brand) in der objektiven Zuordnung (S. 270 f.).
(1) Im Ergebnis erweisen sich die Überlegungen Reschkes allerdings als auf Sand gebaut. Die Frage nach dem Unmittelbarkeitsgebot ist schon keine, die sich allein im Fall der beschreibenden Bestimmung des Nachteils stellt, sondern die beim Umfang der in die Quantifizierung einzubeziehenden Umstände genauso virulent ist. Schlicht falsch ist die Behauptung, es seien nur einige Autoren, die für die Nachteilsbestimmung auf den Zeitpunkt der Pflichtwidrigkeit abstellten (S. 277 m. Fn. 1302). Das ist vielmehr herrschende Meinung und einer der Eckpfeiler der Untreuedogmatik! Daran ändert es nichts, dass die Rechtsprechung sich der Konsequenzen nur teilweise bewusst ist und als Nachteil immer mal wieder auch das dem maßgeblichen Zeitpunkt nachfolgende Geschehen ansieht. Darüber mag man diskutieren – aber nur dann, wenn man bereit ist, das Abstellen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Pflichtwidrigkeit in Frage zu stellen. Das zeigen Reschkes Ausführungen sehr deutlich – wenngleich quasi auf den Kopf gestellt: sie beruhen auf der Maßgeblichkeit eines anderen (nicht näher ausgeführten) Zeitpunkts oder Zeitraums und behandeln die als solches nicht erkannte h.M. als quasi exotische Stimme.
(2) Mit dem Abstellen auf den Zeitpunkt des letzten Teils des pflichtwidrigen Geschehens akzeptiert man jedoch unausweichlich, dass es auf alle nachfolgenden Entwicklungen nicht mehr ankommen kann! Sie sind gleichwohl juristisch nicht etwa irrelevant. Maßgeblich ist vielmehr, was zu erwarten steht. Dies kann nur im Wege einer Prognose festgestellt werden – muss es jedoch auch, denn alle spätere Entwicklung konnte der Täter nicht kennen, sondern nur erwarten oder anstreben. Wissen und Erwartung gilt es in tatsächlicher Hinsicht zu ermitteln und in ihren (potentiellen) Auswirkungen auf das betroffene Vermögen zu beschreiben. Ist es bereits aufgrund des vom Täter pflichtwidrig in Gang gesetzten Geschehens aktuell gemindert, so liegt darin der untreuerelevante Nachteil. Damit hat sich die Frage nach der Notwendigkeit des Unmittelbarkeitskriteriums als Scheinproblem herausgestellt: Es kommt nur auf die Verhältnisse zu einem einzigen Zeitpunkt an – dem letzten der Pflichtwidrigkeit. Noch ein „Problem“ hat sich damit zugleich in Luft aufgelöst: die Suche nach einem Restriktionskriterium beim Nachteil. Es handelt sich bei diesem Tatbestandsmerkmal um eine reine Rechengröße, welche irgendwelcher qualitativer Einschränkungen von vorn herein nicht zugänglich ist. Diese haben ihren Anwendungsbereich allein bei der Pflichtwidrigkeit. Deren Rahmen ist mit dem Abstellen auf Vermögensbezug und Schwerekriterium zutreffend beschrieben. Anschließend müssen die absehbaren Folgen für das Vermögen zur Feststellung des Merkmals Nachteil nur noch deskriptiv festgestellt und soweit möglich quantifiziert werden. Damit ist zugleich aber auch das Kriterium bezeichnet, welche Folgen überhaupt berücksichtigungsfähig sein können: nur die objektiv vorhersehbaren. Alles Zufällige, mit dem niemand rechnen konnte oder musste, ist daher bereits für den objektiven Untreuetatbestand irrelevant. Ob der Täter die absehbaren Folgen auch tatsächlich erkannt hat, ist demgegenüber eine Frage des Vorsatzes. Wiewohl sich damit etliche der aktuellen Diskussionsfelder als überflüssig erweisen, kann es mit Gewissheit nicht Reschke zur Last gelegt werden, dass er sich ihnen gestellt und nach immanent erträglichen Lösungen gesucht hat. Dass sie bestenfalls mit „Klimmzügen“ erreichbar sind, liegt nicht an Reschke, sondern an den verqueren Diskussionslinien.
b) Weil der Entzug der Gemeinnützigkeit nicht unumgänglich ist, lasse sich sein Drohen nicht nur nicht quantifizieren, sondern laut Reschke auch nicht bereits selbst als Nachteil beschreiben (S. 274 f.). Ob dies auf der Basis der von ihm geteilten Auffassung zutrifft, erscheint schon deshalb als zweifelhaft, weil sich der Verein darauf einstellen muss, also schon vor Rechtskraft des Entzugs Vermögensvorkehrungen für seinen Fortbestand treffen muss. Die Existenzvernichtungshaftung gilt – auch nach Reschke – im Rahmen des Vereins (S. 204 – 227, dazu oben II 3). Auch soweit er nicht buchführungspflichtig ist, bedarf es dafür einer Vorsorge wie im Fall der Bildung von Rückstellungen.
c) Reschkes Ergebnis – Straffreiheit – ändert sich spätestens in dem Moment, in dem der Entzug der Gemeinnützigkeit bestands- oder rechtskräftig wird. Damit sei der Nachteil eingetreten und der Tatbestand erfüllt (S. 277 f.). Mangels näherer Befassung mit der Quantifizierung ist anzunehmen, dass Reschke die Beschreibung dieses Nachteils für ausreichend erachtet. Das sei nicht kritisiert.
Hinzuweisen ist aber auf Umstände, die beide Ergebnisse, Straffreiheit des bloß drohenden bei Strafbarkeit des tatsächlichen Entzugs der Gemeinnützigkeit, als unstimmig erscheinen lassen: Die Ungewissheit der tatsächlich eintretenden Rechtsfolgen ist es, die Reschke als Begründung dafür dient, dem erst drohenden Entzug die Untreuerelevanz abzusprechen. Der auf dem Ausnutzen vorhandener Spielräume beruhende Entzug soll demgegenüber nachteilsbegründend wirken. Die Strafbarkeit lässt er demgemäß davon abhängen, wie großzügig der Steuerbeamte ist. Das aber kann der Täter überhaupt nicht beeinflussen. Die tatbestandliche Zurechnung einer Entscheidung eines Dritten, die so oder auch gegenteilig ausfallen kann, ist ersichtlich erklärungsbedürftig im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem Schuldprinzip. Sie geht zwar auf die Pflichtwidrigkeit des Täters zurück. Damit ist jedoch nur die schlichte Kausalkette i.S. der Äquivalenztheorie beschrieben. Die Berücksichtigung rein tatsächlich eingetretener Folgen ist zwar im Rahmen der Strafzumessung, § 46 StGB, zulässig. Das gilt aber nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres auch auf Tatbestandsebene.
Soll nicht gerade das von Reschke (eben für die beschreibende Feststellung des Nachteils, S. 267 – 276, dazu oben II 4 a bb) befürwortete Unmittelbarkeitserfordernis (u.a.) vor der strafrechtlichen Haftung für Entscheidungen Dritter bewahren? Reschke vermeidet einen Widerspruch, indem er diesem Erfordernis nur im Rahmen der Feststellung von Gefährdungschäden Bedeutung zumisst. Liegt es aber denn nicht in der Konsequenz des Anliegens der Befürworter dieses Restriktionskriteriums, dessen Anwendung auch auf Untreuefälle mit abgeschlossenem Sachverhalt (wie bei erfolgtem Entzug der Gemeinnützigkeit) zu bejahen? Hier zeigt sich die Unbrauchbarkeit sämtlicher Versuche qualitativer Einschränkung des Nachteilsbegriffs. Diese sich nicht ohne Grund in immer kleineren Verästelungen auswirkende und unnötig Verwirrung stiftende Dogmatik führte Reschke in eine Lage, in der er völlig zu Recht nach sinnvollen Auswegen suchte, die aber immanent gar nicht zu finden sind.
III.
Neben der bereits erwähnten Befassung mit dem organisationsbezogenen Ansatz prüft Reschke unter dem Gesichtspunkt des Bankrotts ausführlich dessen Übertragbarkeit auf den e.V. Dies bejaht er nach ausführlicher Prüfung (S. 311 – 320), obwohl „ein Gedankengang dahingehend, einen e.V. als Verbraucher i.S. der §§ 304 ff. InsO einzuordnen und ihn deswegen dem Anwendungsbereich des § 283 StGB zu entziehen, ohnehin keinen Sinn ergibt“ (S. 314, Radtke zitierend). Die Anwendbarkeit des § 283 StGB sei auch für die Alternative des Handelns bei Überschuldung nicht eingeschränkt, obwohl § 19 Abs. 2 InsO den Begriff des Unternehmens verwende – allerdings nicht im technischen Sinne und nur den Nachlass und die fortgesetzte Gütergemeinschaft aus seinem Anwendungsbereich ausklammerd (S. 304 f.). Der aktuelle, zum Dauerrecht erhobene Überschuldungsbegriff komme den Vereinen sehr entgegen (S. 306). § 283 Abs. 1 Nrn. 5 und 7 StGB sei allerdings nur auf Groß- und sonstige Vereine mit einem Wirtschaftsbetrieb gem. dem steuerrechtlichen Nebenzweckprivileg anwendbar (S. 310 f.).
IV.
Im Hinblick auf die Insolvenzverschleppung, § 15a Abs. 4 InsO ist der Befund seit dem 1.7.2014 eindeutig: Die Strafvorschrift gilt nicht für Vereine. Für Reschke ist das aber nach wie vor nur für Idealvereine ohne Wirtschaftsbetrieb zweifelsfrei (S. 322 – 341). Bei kaufmännisch organisierten Großvereinen (S. 358 – 362) erkennt er eine Rechtsformverfehlung (S. 356), welche es an sich erlaube, sie als Kaufleute anzusehen, die im Hinblick auf die Maßgeblichkeit der insolvenzrechtlichen Vorschriften nicht der privilegierenden Norm des § 42 Abs. 2 BGB, sondern dem § 15a InsO unterfielen (S. 349 f., 354 und 356 f.). Nur der bei Schaffung des neuen § 15a Abs. 6 InsO zum Ausdruck gebrachte gesetzgeberische Wille, Vereine insgesamt weiterhin allein dem § 42 Abs. 2 BGB zuzuordnen, lässt Reschke von seiner Befürwortung auch strafrechtlicher Einordnung von kaufmännisch organisierten Großvereinen als dem § 15a InsO unterfallend de lege lata Abstand nehmen und dies lediglich noch de lege ferenda befürworten. Seinen überzeugenden Argumenten kann man nur zustimmen.
V.
Das Fazit fällt nicht einheitlich aus: Auf der Basis der h.M. ist die Arbeit nicht nur äußerst material- und kenntnisreich, sondern zudem außerordentlich anregend, weil Reschke völlig zu Recht darauf besteht, sich mit unstimmigen Ergebnissen nur dort zufrieden zu geben, wo er bei aller ihm erfreulicherweise eigenen Phantasie keine andere Alternative sieht. Seine überzeugende, an den Missbrauch der Rechtsform anknüpfende Differenzierung zwischen Ideal- und kaufmännisch organisiertem Großverein für geltendes Recht zu erklären, hat allein der Gesetzgeber mit seiner dem Vereinsprivileg verhafteten Einführung des § 15a Abs. 6 InsO verhindert. Sein Potential zu transzendentem juristischen Denken setzte Reschke auch im dogmatischen Dschungel des § 266 StGB ein – nicht ohne, aber auch nicht mit überall durchschlagendem Erfolg. Dass er sich damit in einer Reihe vieler anderer namhafter Autoren wiederfindet, ist zwar schade, zeigt aber, dass ihm aus diesem Bedauern kein Vorwurf erwachsen darf. Für das Recht des eingetragenen Vereins entwickelte Reschke auf der Basis der immerhin partiell in Frage gestellten üblichen Untreuedogmatik für § 266 StGB, nachfolgend in aus Gründen geringeren Umstrittensseins weniger problematisierender Weise auch für § 283 StGB und für § 15a InsO, Lösungen, die dem Stand der aktuellen rechtswissenschaftlichen Diskussion ebenso wie praktischen Notwendigkeiten jedenfalls weitgehend Rechnung tragen. Das ist trotz des Infragestellens mancher gleichwohl auf hohem Niveau angesiedelter Passagen weit mehr als sich von vielen anderen Dissertationen guten Gewissens sagen lässt!
[:en]
Duncker & Humblot, Strafrechtliche Abhandlungen, Neue Folge Band 256, Berlin 2015, 99,90 €, zugleich Dissertation WS 2013/2014, Universität Konstanz
I.
1. Der eingetragene Verein, „Mutter“ aller juristischen Personen – das unbekannte Wesen! Dieser Diagnose will Reschke den Boden entziehen und untersucht zu diesem Zweck Probleme, die sich bei der GmbH und der AG stellen und dort rege diskutiert werden. Die Fülle des verarbeiteten Materials ist beeindruckend – ebenso die Kombination aus Denkvermögen und Phantasiebegabung. Alles, was dennoch nicht begeistert, ist demgemäß auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt und erlaubt die Kritik vielfach gerade erst deswegen, weil Reschkes Darstellung nicht nur auf der Höhe der Zeit ist, sondern auch tief in noch nicht erschlossene Lücken leuchtet. Wer will es ihm verübeln, wenn er dabei nicht jede abgestellte Kiste angehoben, sämtliche Einzelteile betrachtet und für alles eine nach allen Seiten hin abgeklopfte Lösung präsentiert?
2. Reschke wählte eine Darstellungsform, die zumindest für Dissertationen ungewöhnlich ist. Er sah nämlich von isolierten Darstellungen sowohl des Rechts des eingetragenen Vereins als auch der untersuchten Tatbestände ab. Vielmehr skizzierte er die Vereinsstrukturen (noch dazu im Vergleich zwischen den §§ 21 ff. BGB und dem öffentlich-rechtlichen VereinsG) nur äußerst knapp (S. 33 – 39), Organe sind Mitgliederversammlung und Vorstand, wobei die Geschäftsführungsbefugnis delegationsfähig ist (S. 37 – 39), und widmete sich den tatbestandlichen Themen in Bezug auf ihre Relevanz für das Recht des eingetragenen Vereins. Diesen verlor er nie aus dem Blick, ohne jedoch seine Vorliebe für die spezifisch tatbestandlichen und über die Bedeutung für den Verein hinausragenden Fragen (v.a. bei der Untreue) zu verheimlichen. Die 240 Seiten des 2. Kapitels zu diesem Tatbestand gerieten ihm so zu einer monographischen Darstellung auch nahezu aller aktueller Fragen des § 266 StGB.
3. Der eingetragene Verein als Prototyp gemeinschaftlichen bürgerschaftlichen Engagements steht für Reschke als Synonym für das aus der Mode geratene Ehrenamt (S. 21). Interessant sind seine statistischen Angaben: Während sich die Insolvenzquote bei der GmbH auf 39,5 % belaufe, betrage sie beim Verein nur 0,8 % (S. 25), obwohl entfallende öffentliche Zuschüsse häufig das wirtschaftliche Ende des Vereins bedeuteten (S. 26). Eindrucksvoll fällt auch die Übersicht über das reale Handeln in Vereinsform aus: Den ADAC und Vereine der Fußballbundesliga mag noch jeder Leser kennen. Es erstaunt jedoch, dass zudem auch die Max-Planck-Gesellschaft ebenso wie die Bundespressekonferenz und die CSU als e.V. organisiert sind (S. 26 f.). In der Rechtsprechung entschiedene Fälle führen Reschke zu der Frage, ob nicht gerade die mangelnde Bezahlung der Funktionäre kleiner Vereine deren Selbstbedienungsmentalität fördere (S. 28 f.). Es wäre einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung wert, diesen Informationen und ihren Ursachen einmal näher nachzugehen. Jedenfalls leitet die Frage nach der (Un-)Moral mancher Vereinsfunktionäre zwanglos auf die Darstellung der Untreue über.
II.
1. Vorangestellt ist quasi programmatisch für die nachfolgende Untersuchung die Beschreibung der näher zu betrachtenden Themen: Anwendbarkeit der business judgment rule, Einwilligungsfähigkeit und Entziehung der Gemeinnützigkeit als Nachteil (S. 32). Die Fragen nach der Verbraucherqualität des Idealvereins und dem Maßstab für ordnungsgemäßes Wirtschaften (S. 32, S. 143 und passim) weisen auf ihre Relevanz auch für den Bankrott (S. 317, aber auch 318 f.) hin. Die Befassung mit dem nicht eingetragenen Verein führt bereits zu einem Kernproblem der Untreue: Wiewohl zivilrechtlich trotz § 54 BGB eingetragener und nicht eingetragener Verein nahezu gleich behandelt würden, scheide dies sub specie § 266 StGB deshalb aus, weil mit der h.M. anzunehmen sei, dass Rechtsträger des Vereinsvermögens beim nicht rechtsfähigen Verein nur die Mitglieder als natürliche Personen sein könnten, während ebenfalls mit der h.M. anzunehmen sei, dass die juristische Person e.V. selbst Rechtsträger sei (S. 33 – 37, 67 – 80). Nach einem Blick auf die mit dem BVerfG bejahte Verfassungsmäßigkeit des § 266 StGB (S. 40 – 56) und der Bejahung der Anwendbarkeit der Vorschrift auch im non-profit-Bereich (S. 56 – 67) wendet sich Reschke Vereinsspezifika wie der Vermögensbetreuungspflicht (S. 81 – 86) des Vorstands (S. 87 f.) und des Notvorstands, § 29 BGB (maßgeblich: Bestellungsakt, S. 88 – 95), besonderer Vertreter, § 30 BGB (S. 95 – 97), des Liquidators (S. 97 – 100), der einfachen Vereinsmitglieder (nur bei Übernahme von Aufgaben über die eigentliche Mitgliedschaft hinaus, S. 100 – 115), Mitarbeiter (S. 115) und faktischer Organe (differenzierend, S. 115 – 123) zu.
§ 4 des 2. Kapitels bildet unter Befassung mit dem Thema „Pflichtwidrigkeit“ einen Schwerpunkt der Arbeit. Reschke betrachtet aufgrund des Rechtsguts konsequenterweise nur die Verletzung vermögensbezogener Pflichten als relevant (S. 126 f. m. Fn. 482, 136 – 140). Als Quellen kämen Satzung, Mitgliederversammlung, Vertrag und die allgemeine Stellung in Betracht (S. 128 – 133). Vorteilsgewährung, § 333 StGB (S. 141), und Verstöße gegen die Gemeinnützigkeit (S. 142) verletzten nicht per se die Vermögensbetreuungspflicht gem. § 266 StGB, es sei denn, damit würden zugleich vereinsinterne Vermögensbetreuungspflichten verletzt (Ansatz entsprechend BGH, NJW 2012, 3797 f. – Kölner Parteispenden). Fragen des Risikogeschäfts stellten sich nicht nur bei Spielertransfers, sondern auch beim Betreiben von open-air-Imbissen im Hinblick auf Wetterunbilden (S. 143).
2. Die Anwendung der business judgment rule (S. 144 – 164) beschränkt Reschke zutreffend auf Entscheidungen mit Ermessenspielräumen (S. 147), während Verstöße gegen zwingende (vermögensbezogene) Regeln per se pflichtwidrig seien. Hinzuzufügen wäre noch, dass hierin kein Widerspruch dazu besteht, dass eine Vermögensbetreuungspflicht regelmäßig nur im Fall vorhandener Entscheidungsfreiheiten anzunehmen ist, weil sich die Bezugstatsachen unterscheiden (Faustregel: „ob“ = frei; „wie“ kann auch gebunden sein). Die Domäne der business judgment rule stellten daher zukunftsbezogene Prognosen dar. So richtig wie dies ist, so wenig lässt sich daraus entgegen Reschke allerdings schließen, sie seien nicht justitiabel. Das gilt nämlich nur für sorgfaltsgemäß erstellte Prognosen, nicht hingegen für aus der Luft gegriffene oder lediglich wohlklingend bezeichnete persönliche Wünsche.
Die Befassung mit den Tatbestandsvoraussetzungen des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG ist informativ. Für den Gedankengang und das Ergebnis ausschlaggebend ist sie hingegen nicht, denn auch jenseits der Tatbestandsvoraussetzungen der business judgment rule ist die Pflichtwidrigkeit (ungebundener) Entscheidungen nicht präjudiziert (S. 146 mit Fn. 573). Jenseits der business judgment rule übernimmt nämlich das Ermessen die Funktion, die Straffreiheit jeder innerhalb des Spielraums liegender (sachgerecht getroffener) Entscheidung zu sichern. Der Zusammenhang zwischen den Grenzen rechtmäßiger Ausübung von Ermessen und der Frage nach der Notwendigkeit der Beschränkung der tatbestandsmäßigen Pflichtwidrigkeit auf gravierende Verstöße beschäftigt Reschke im nachfolgenden Teil (S. 164 – 185). Hier verrennt er sich jedoch: Das BVerfG hat das Restriktionspotential dieses Kriteriums bestätigt (BVerfGE 126, 170 ff., Rn. 111). Obwohl Reschke diese Ausführungen dahingehend überinterpretiert, der Senat habe es zu einem Verfassungsgebot erhoben (S. 165), sieht er sich nicht an seinem Fazit gehindert, die bisherigen Versuche seiner Interpretation und Anwendung seien mit verfassungsrechtlichen Anforderungen unvereinbar (S. 183). Den Grund dafür sieht er darin, dass das Zivilrecht selbst die nötige Höhenmarke normiere und es bislang nicht gelungen sei, eine rechtssichere zusätzliche Linie der strafrechtlichen Relevanz zu definieren.
Diese Analyse trifft zu. Richtig ist zudem, dass es keiner eigenständigen strafrechtlichen Höhenmarke bedarf, wo bereits das Sachrecht große Spielräume enthält. Ist bereits deren Überschreitung nur im Fall der Evidenz rechtswidrig, so ist nichts dagegen einzuwenden, denselben Maßstab auf das Strafrecht zu übertragen: Unvertretbares Handeln darf bestraft werden. Hier erfüllt bereits das Sachrecht das Anliegen, nicht gleich jeden kleinen Fehler mit Strafe zu bedrohen. Zivil- und Verwaltungs-, insbesondere jedoch das Finanz- und Sozialrecht begnügen sich allerdings nicht mit ausfüllungsfähigen Regelungen. Im Gegenteil, sie legen teilweise liebevoll ausdifferenziert in hoher Normendichte und von der Rechtsprechung noch zusätzlich ausgebaut durchaus vermögensbezogene Pflichten zwingend fest. Die undifferenzierte Pönalisierung der bloßen Verletzung irgendeiner derartigen Bestimmung würde tendentiell zu einem Volk von Vorbestraften führen! Hier ist es daher unbedingt erforderlich, zwischen Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit eine zusätzliche Hürde aufzubauen. Angesichts der Vielzahl heutiger Detailpflichten kann und darf es nicht sein, jeden zivil- oder verwaltungsrechtlich relevanten Verstoß zur strafbaren Handlung hochzujazzen. Das sieht Reschke nicht anders. Jedoch beugt die angesichts ihres zwingenden Charakters von ihm (S. 180) befürwortete restriktivere Auslegung des Sachrechts seitens der Strafjustiz nicht ausreichend vor: Auch eine bei aller Zurückhaltung bejahte Verletzung des Sachrechts bleibt eine solche und begründet das Verdikt der Rechtswidrigkeit. Nicht jede Missachtung einer dieser zwingenden Normen ist sub specie § 266 StGB aber für sich ausreichend gewichtig, um als strafbare Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht angesehen werden zu können. Nur Pflichtverletzungen in einem erheblichen Ausmaß sind strafwürdig. Das bedeutet, dass es – nur, aber gerade – jenseits von Entscheidungsspielräumen eines Schwerekriteriums bedarf, welches neben das Erfordernis des Vermögensbezugs tritt und nicht wie bei Reschke in ihm aufgehen kann.
Obwohl Reschke in seinem Befund insoweit uneingeschränkt zuzustimmen ist, dass es bislang nicht gelungen ist, eine rechtssichere Handhabung für ein Instrument zu entwickeln, welches die Relevanz sachrechtlich zwingend anzunehmender Pflichtverletzungen auf ihren strafwürdigen Kern reduziert, gilt es jedoch, sich dieser Aufgabe weiterhin zu stellen. Gelingen kann das vermutlich nur fallbezogen. Ob sich Generalisierungen definieren lassen, bleibt abzuwarten. Evidenz ist demnach zwar kein hartes Entscheidungskriterium, wohl aber ein Aspekt, der die Richtung weist, die die gewünschte Lösung dereinst verheißt.
3. Auf sehr hohes Niveau führt Reschkes Diskussion der Frage der Einwilligungsfähigkeit der juristischen Person in vermögensschädigende Handlungen z.B. seiner Repräsentanten (S. 185 – 228), innerhalb derer er zutreffend das Institut der Existenzvernichtungshaftung auch im Rahmen des eingetragenen Vereins für anwendbar hält (S. 204 – 227). Keine Probleme bereiteten im Hinblick auf die Einwilligung rechtmäßige Beschlüsse der Mitgliederversammlung: Da es keine „Mehrheitsgesellschafter“ gäbe, sondern jedes Vereinsmitglied nur über eine Stimme verfüge, reiche das Mehrheitsprinzip aus, selbst wenn man es für die AG nicht ohne Grund in Zweifel ziehe (S. 196 f.). Heikel wird es jedoch bei der Frage, ob auch rechtswidrige Beschlüsse einwilligenden und damit zur Straflosigkeit führenden Charakter haben können. Der Lösung nähert Reschke sich in Anlehnung an die im Rahmen des § 283 StGB geführte (und von ihm später dort auch aufgenommene, S. 287 – 302) Diskussion über die an die Stelle der aufgegebenen Interessentheorie getretenen Kriterien zum Handeln „als“ Organ i.S. von insbesondere § 14 Abs. 1 S. 1 StGB. Das ist verdienstvoll, obwohl es Reschke nicht durchweg gelingt, die ineinander verwobenen Argumentationsstränge zu entheddern.
a) Für §§ 283, 14 StGB entwickelte im wesentlichen Radtke das sog. Zurechnungsmodell als Alternative zur Interessentheorie: Immer wenn der Repräsentant, Prototyp: der GmbH-Geschäftsführer, in dieser Funktion tätig wurde, handelte er „als“ Organ. Damit gelangt man im rechtsgeschäftlichen Bereich zu sachgerechter Abgrenzung, während es bei tatsächlichem Handeln nicht immer eindeutig ist, ob der Repräsentant als solcher oder wie ein beliebiger Dritter tätig wurde. Diese Schwierigkeiten versucht der das Zurechnungsmodell weiterentwickelnde organisationsbezogene Ansatz von Christian Brand zu verringern. Es ist auf § 283 StGB als Selbstschädigungsdelikt zugeschnitten und fragt zunächst danach, wann das Handeln eines Repräsentanten als solches der juristische Person zu gelten habe. Die Antwort entwickelte Brand für das Gebiet des tatsächlichen Handelns unter strikter Aktivierung der Lehre von der Zurechnung und gelangte zu dem Ergebnis, nur das Handeln des (z.B.) Organs, welches in den vom Gesetz vorgesehenen Formen und unter Einhaltung seiner Vorschriften geschehe, müsse sich die juristische Person zurechnen lassen.
b) Dieser organisationsbezogene Ansatz litt von Anfang an daran, dass er nicht nur, zumindest für den Bereich tatsächlichen Handelns, nahezu deckungsgleiche Ergebnisse wie die überwundene Interessentheorie zeitigt, sondern in letzter Konsequenz dazu führt, der juristischen Person die Fähigkeit zu rechtswidrigem Handeln, vielleicht sogar, aber dies bedürfte näherer Prüfung, auch auf rechtsgeschäftlichem Sektor, abzusprechen. Das jedoch ist weder einzusehen, noch lässt es sich mit z.B. § 30 OWiG vereinbaren: die Bestimmung sanktioniert die juristische Person selbst (obwohl auch in diesem Rahmen die Frage nach dem Grund heftig diskutiert und z.T. mit Zurechnungserwägungen bejaht wird, die hier geführte Diskussion dort also partiell wiederkehrt).
Während es bei § 30 OWiG um die Beantwortung der direkten Frage geht, wann ein Verhalten einer natürlichen Person die (ordnungswidrigkeitenrechtliche) Verantwortung des Verbands auslöst, ist der strafrechtliche organisationsbezogene Ansatz komplexer, geht es doch dabei nicht um die repressive Haftung der juristischen Person, sondern um diejenige ihres Organs. Die Frage, unter welchen Umständen das Handeln eines Repräsentanten der juristischen Person zugerechnet werden kann, ist daher nur eine Vorfrage für die Ahndung der natürlichen Person. Brand hält sie wegen des Charakters des Bankrotts als Selbstschädigungsdelikt für zwingend beantwortungsbedürftig. Dem kann man nicht allein mit einer Kritik am Begriff widersprechen: bei Insolvenz einer natürlichen Person geschehen Verheimlichen und Beiseiteschaffen in aller Regel eigennützig, also gerade nicht schädigend. Maßgeblich ist für den organisationsbezogenen Ansatz aber nicht eine etwaige Schädigung, sondern dass der Schuldner selbst es ist, der handelt und die Tat begeht. Mit der schlichten Modifikation zum „Selbsthandlungsdelikt“ lässt sich die begriffliche Hürde also leicht überwinden.
c) Damit ist jedoch das inhaltliche Problem noch nicht gelöst. Ob und wie das geschehen kann, mag hier dahinstehen. Dass die juristische Person für inhaltlich rechtswidrige Beschlüsse ihrer Gremien einstehen muss, erscheint jedoch prima facie als nötig. Warum es bei tatsächlichem Handeln anders sein soll, ist demnach zumindest begründungsbedürftig. Jenseits des Bankrotts ist z.B. die Zurechnung von Produktschäden zum Unternehmen selbst auch nicht fraglich. Es ist demnach keineswegs zwingend, für den Bankrott auf eine naturalistische Parallele zum Handeln eines Menschen abzustellen. Auch das Versagen ihrer Organe und sonstigen Repräsentanten ist oder gilt als Versagen der juristischen Person. Allein damit erweist sich für den Bankrott als Selbsthandlungsdelikt die zweigliedrige Zurechnung i.S. des organisationsbezogenen Ansatzes noch nicht als unnötig – eine Prüfung der Erforderlichkeit dessen bedürfte vertiefter Untersuchung. Es zeigt sich jedoch, dass die Beschränkung der Zurechnung auf in jeglicher Hinsicht rechtmäßiges Handeln kein notwendiger Bestandteil des organisationsbezogenen Ansatzes ist. Sollte das zutreffen, so liegt die Erledigung der wesentlichen Aufgabe noch in der Zukunft: Kann der juristischen Person überhaupt rechtswidriges Handeln eines Repräsentanten zugerechnet werden – Bejahung des „ob“ – so bedarf es der Prüfung, unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist – Klärung des „wie“. Vielleicht können Überlegungen aus den Rechtsinstituten der Anscheins- und Duldungsvollmacht, der Fahrlässigkeit, der Gefährdungs- und der Geschäftsherrenhaftung dazu fruchtbar gemacht werden, ggf. auch die Unterscheidung Wirksamkeit/Unwirksamkeit. Obwohl es gerade um die Frage der Zurechnung zum Verband geht, mag auch der Grundsatz in die Prüfung einfließen, dass Handeln des Organs Handeln der juristischen Person ist. Darin könnte eine Tür liegen, welche dem Repräsentanten eine gewisse Definitionsmacht eröffnet. Mag sein, dass sogar die Dogmatik der Schuldfähigkeit einschlägige Aspekte enthält, stellt doch das Strafrecht verschiedentlich trotz fehlender Schuldfähigkeit auf den natürlichen Willen ab.
d) Reschke schließt sich nicht nur für den Bankrott den Erkenntnissen Brands an (S. 287 – 302), sondern sie dienen ihm zudem als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Einwilligungsmodells in Schädigungen des eingetragenen Vereins. Strukturell kehrt auch hier die Zweigliedrigkeit wieder: Die Konsentierung seitens der juristischen Person, diesmal: Verein, ist bedeutsam für die Frage der Strafbarkeit des Repräsentanten. Während beim Bankrott allerdings die Zurechnung tatbestandsbegründend ist, führt sie sub specie § 266 StGB im Fall wirksamer Einwilligung zum Entfallen des Tatbestandsmerkmals der Pflichtwidrigkeit. Das betrifft jedoch lediglich die jeweiligen Folgen und stellt die strukturelle Vergleichbarkeit nicht in Frage. Reschke geht insoweit über Brand hinaus, als er Grenzen der Einwilligungsfähigkeit (Satzungs- oder sonstige Rechtsverstöße) bereits für rechtsgeschäftliches Handeln und Gremienbeschlüsse für relevant erachtet (z.B. S. 198). Er durchbricht den organisationsbezogenen Ansatz dann jedoch in pfiffiger Rechtsgutsbetrachtung: Nur die Verletzung vermögensschützender Bestimmungen hindere die Wirksamkeit der Einwilligung (S. 219 – 225).
e) Mit der Gleichsetzung von (hier auf Verstöße gegen vermögensschützende Vorschriften begrenzter) Rechtswidrigkeit und Unwirksamkeit bewegt sich Reschke innerhalb der strafrechtlich h.M. Im Zivil-, Verwaltungs- und Prozessrecht wird jedoch unterschieden zwischen Anfechtbarkeit und Nichtigkeit. Regelmäßig geht es, zumindest in den von Reschke angeführten Beispielsfällen, nicht um Nichtigkeit, sondern um Anfechtbarkeit. Rechtswidrige Beschlüsse sind demnach zunächst wirksam und folglich kein juristisches Nullum. Demnach ist die strafrechtliche Gleichsetzung jedenfalls nicht selbstverständlich. Sie gilt auch repressionsrechtlich nicht durchgängig: Straßenschilder müssen selbst dann beachtet werden, wenn sie rechtswidrig aufgestellt sind. Im Umweltrecht führt eine rechtswidrige Genehmigung zumindest nicht durchweg zur Bestrafung des von ihr Gebrauch machenden Bürgers. Verstöße gegen das Ausländerrecht sind zum Teil sogar bei korruptiv erwirkten Visa verneint worden. Eine (vermögens-)rechtswidrige Einwilligung in einem Beschluss der Mitgliederversammlung dürfte deshalb jedenfalls nicht in allen Fällen als strafrechtlich unwirksam behandelt werden. Ob sich das Organ hingegen auf die Wirksamkeit berufen kann, wenn es die (Vermögens-)Rechtswidrigkeit des Beschlusses kannte, ist eine ganz andere und i.E. zu verneinende Frage. Aber auch bei Gleichsetzung von Rechtswidrigkeit und Unwirksamkeit muss ein gutgläubiges Organ seine Bestrafung nicht fürchten, handelte es doch in einem Erlaubnistatbestandsirrtum, der bei der Untreue nicht erst zum Entfallen der Rechtswidrigkeit, sondern bereits zum Verneinen des Tatbestands führt .
f) Reschkes Mut, inakzeptable Ergebnisse des auf die Untreue übertragenen Organisationsmodells, nicht einfach zu akzeptieren, die er aber im Rahmen des Bankrotts dann jedoch trotzdem hinnimmt (S. 299 – 302), verdient jede Anerkennung. Dass er allerdings überhaupt zu seinen intelligenten, nichtdestotrotz jedoch umständlichen Erwägungen veranlasst wurde, weist darauf hin, dass das Organisationsmodell selbst noch nicht das Ende der Überlegungen markiert.
4. Obwohl Reschke sich im Zuge seiner Befassung mit dem Nachteil auf die Frage konzentriert, ob der Entzug der Gemeinnützigkeit untreuerechtlich relevant ist, diskutiert er (wohl) sämtliche Themen, die nach der Grundsatzentscheidung des BVerfG vom 23.6.2010 (wieder) aktuell sind – erneut auf hohem Niveau. Reschke stellt im Block (in Abweichung seiner Handhabung für Verein und Straftatbestand, aber sehr hilfreich) die Regelung der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit und ihre Vorteilhaftigkeit für den Verein dar (S. 233 – 240) und propagiert die Einheitlichkeit des Schadensbegriffs für alle Vermögensdelikte (S. 230 f.). Ausführlich prüft er, ob bereits die drohende Entziehung der Gemeinnützigkeit einen Schaden darstellt. Zu diesem Zwecke befasst er sich ausführlich mit der Gefährdung als Schaden und hält sie auch im Rahmen der Untreue für relevant. Den Einwänden dagegen tritt er souverän entgegen. Zwar normiere § 266 StGB im Gegensatz zum Betrug keine Versuchsstrafbarkeit, doch entfalte dies keinen Einfluss auf das Verständnis des Merkmals „Nachteil“ (S. 243, inkonsequent allerdings S. 266). Dass die Anerkennung eines Gefährdungsschadens nicht im Widerspruch zur fehlenden Strafbarkeit des Untreueversuchs steht, untermauert er mit dem Hinweis, der (tatsächlich denkbare) Versuch eines Gefährdungsbetrugs sei strafbar (S. 243 f.). Zudem sei es methodisch inkorrekt, die Weite der Tathandlung „Pflichtwidrigkeit“ mit einem zu engen Verständnis des Schadensbegriffs kompensieren zu wollen (S. 244). Das verstoße gegen das Verschleifungsverbot (ein kluger und im Ergebnis zutreffender Gedanke, wenngleich in Bezug auf das Verschleifungsverbot hier nicht wie sonst mit strafbarkeitsbeschränkender Wirkung).
Die Notwendigkeit der Anerkennung bereits der Gefährdung als Schaden folgert Reschke aus der Besonderheit des Rechtsguts Vermögen: Während andere Rechtsgüter (Leben, Gesundheit – von ihm statisch genannt, was sie im wahren Leben ja nun leider nicht sind, wenn auch aus anderen als Rechtsgründen) an Integrität erst aufgrund des Verletzungserfolgs einbüßten, vermindere rein tatsächlich bereits die Gefährdung den Wert des Vermögens (S. 245 f.) – eine gewiss zutreffende Analyse. Damit stellte sich nun aber die Aufgabe herauszufinden, unter welchen Umständen eine Gefährdung das Vermögen mindere (S. 250). Reschke sucht die Lösung zu Recht im objektiven Tatbestand, verwirft die bisherigen Ansätze mit Ausnahme desjenigen des Bundesverfassungsgerichts und gelangt auf diese Weise zum Quantifizierungsgebot (S. 254 – 256).
a) aa) Damit steht er nun vor der selbstgestellten Frage, wie hoch denn der Nachteil des Risikos der Entziehung der Gemeinnützigkeit für den Verein sei. Seine Antwort lautet, eine Quantifizierung sei unmöglich (S. 256 – 261). Damit hätte er diesen Teil der Überlegungen enden lassen können. Statt dessen wendet er sich der Reichweite des Quantifizierungsgebots zu und interpretiert das BVerfG innovativ dahingehend, dass die Notwendigkeit, den Nachteil zu beziffern, entgegen einigen (aller bisherigen?) Stimmen im Schrifttum nicht als allgemeingültig zu verstehen sei mit der Folge, dass ohne Quantifizierung notwendigerweise freizusprechen sei (S, 262), sondern dass jenseits der Erfüllbarkeit des Quantifizierungsgebots der Platz für normative Überlegungen angesiedelt sei (S. 263 f.).
Der Ansatz, jenseits des Quantifizierungsgebots sub specie § 266 StGB nicht nur Straffreiheit zu propagieren, ist zutreffend. Diesen Befund jedoch der Rechtsprechung des BVerfG zu entnehmen, ist kühn. Gleichwohl bleibt der Gedanke richtig, dass überall dort, wo es keinen Marktpreis gibt, der Nachteil auf andere Weise bestimmt werden können muss. Oldtimer kosten heute so viel und morgen das Doppelte oder die Hälfte. Warum soll es zur Verurteilung nicht genügen, den Wagen zu beschreiben, wenn er pflichtwidrig verscherbelt wurde? Warum diese Art der Bestimmung des Nachteils allerdings eine normative sein soll, erklärt Reschke nicht und erschließt sich dem Rezensenten auch nicht. Das ändert allerdings nichts an dem Befund, dass die verbale Beschreibung des Nachteils eine ausreichend bestimmte und damit taugliche Alternative zur Quantifizierung in Geld darstellt. Der h.M. entspricht dies jedoch (noch) nicht.
bb) Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, was denn alles als Nachteil beschrieben werden könne und müsse, wird Reschke zum Befürworter des Unmittelbarkeitskriteriums in Form der Lehre Saligers (S. 267 – 276). Unmittelbar und damit tatbestandsrelevant ist danach nur eine automatisch oder aufgrund auf Null reduzierten Ermessens eintretende Folge (S. 273). Demgemäß verwundert weder das Lob für den 5. Strafsenat des BGH (BGHSt 54, 44 ff.), der in der Entscheidung zur Berliner Straßenreinigung erstmals auf die Unmittelbarkeit abstellte, noch die Schelte für den 1. Strafsenat, der es in der Entscheidung zur Kölner Parteispendenaffäre (BGHSt 56, 203 ff.) verwarf. Die Lösung sucht Reschke auch hier (und in Übereinstimmung mit Brand) in der objektiven Zuordnung (S. 270 f.).
(1) Im Ergebnis erweisen sich die Überlegungen Reschkes allerdings als auf Sand gebaut. Die Frage nach dem Unmittelbarkeitsgebot ist schon keine, die sich allein im Fall der beschreibenden Bestimmung des Nachteils stellt, sondern die beim Umfang der in die Quantifizierung einzubeziehenden Umstände genauso virulent ist. Schlicht falsch ist die Behauptung, es seien nur einige Autoren, die für die Nachteilsbestimmung auf den Zeitpunkt der Pflichtwidrigkeit abstellten (S. 277 m. Fn. 1302). Das ist vielmehr herrschende Meinung und einer der Eckpfeiler der Untreuedogmatik! Daran ändert es nichts, dass die Rechtsprechung sich der Konsequenzen nur teilweise bewusst ist und als Nachteil immer mal wieder auch das dem maßgeblichen Zeitpunkt nachfolgende Geschehen ansieht. Darüber mag man diskutieren – aber nur dann, wenn man bereit ist, das Abstellen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Pflichtwidrigkeit in Frage zu stellen. Das zeigen Reschkes Ausführungen sehr deutlich – wenngleich quasi auf den Kopf gestellt: sie beruhen auf der Maßgeblichkeit eines anderen (nicht näher ausgeführten) Zeitpunkts oder Zeitraums und behandeln die als solches nicht erkannte h.M. als quasi exotische Stimme.
(2) Mit dem Abstellen auf den Zeitpunkt des letzten Teils des pflichtwidrigen Geschehens akzeptiert man jedoch unausweichlich, dass es auf alle nachfolgenden Entwicklungen nicht mehr ankommen kann! Sie sind gleichwohl juristisch nicht etwa irrelevant. Maßgeblich ist vielmehr, was zu erwarten steht. Dies kann nur im Wege einer Prognose festgestellt werden – muss es jedoch auch, denn alle spätere Entwicklung konnte der Täter nicht kennen, sondern nur erwarten oder anstreben. Wissen und Erwartung gilt es in tatsächlicher Hinsicht zu ermitteln und in ihren (potentiellen) Auswirkungen auf das betroffene Vermögen zu beschreiben. Ist es bereits aufgrund des vom Täter pflichtwidrig in Gang gesetzten Geschehens aktuell gemindert, so liegt darin der untreuerelevante Nachteil. Damit hat sich die Frage nach der Notwendigkeit des Unmittelbarkeitskriteriums als Scheinproblem herausgestellt: Es kommt nur auf die Verhältnisse zu einem einzigen Zeitpunkt an – dem letzten der Pflichtwidrigkeit. Noch ein „Problem“ hat sich damit zugleich in Luft aufgelöst: die Suche nach einem Restriktionskriterium beim Nachteil. Es handelt sich bei diesem Tatbestandsmerkmal um eine reine Rechengröße, welche irgendwelcher qualitativer Einschränkungen von vorn herein nicht zugänglich ist. Diese haben ihren Anwendungsbereich allein bei der Pflichtwidrigkeit. Deren Rahmen ist mit dem Abstellen auf Vermögensbezug und Schwerekriterium zutreffend beschrieben. Anschließend müssen die absehbaren Folgen für das Vermögen zur Feststellung des Merkmals Nachteil nur noch deskriptiv festgestellt und soweit möglich quantifiziert werden. Damit ist zugleich aber auch das Kriterium bezeichnet, welche Folgen überhaupt berücksichtigungsfähig sein können: nur die objektiv vorhersehbaren. Alles Zufällige, mit dem niemand rechnen konnte oder musste, ist daher bereits für den objektiven Untreuetatbestand irrelevant. Ob der Täter die absehbaren Folgen auch tatsächlich erkannt hat, ist demgegenüber eine Frage des Vorsatzes. Wiewohl sich damit etliche der aktuellen Diskussionsfelder als überflüssig erweisen, kann es mit Gewissheit nicht Reschke zur Last gelegt werden, dass er sich ihnen gestellt und nach immanent erträglichen Lösungen gesucht hat. Dass sie bestenfalls mit „Klimmzügen“ erreichbar sind, liegt nicht an Reschke, sondern an den verqueren Diskussionslinien.
b) Weil der Entzug der Gemeinnützigkeit nicht unumgänglich ist, lasse sich sein Drohen nicht nur nicht quantifizieren, sondern laut Reschke auch nicht bereits selbst als Nachteil beschreiben (S. 274 f.). Ob dies auf der Basis der von ihm geteilten Auffassung zutrifft, erscheint schon deshalb als zweifelhaft, weil sich der Verein darauf einstellen muss, also schon vor Rechtskraft des Entzugs Vermögensvorkehrungen für seinen Fortbestand treffen muss. Die Existenzvernichtungshaftung gilt – auch nach Reschke – im Rahmen des Vereins (S. 204 – 227, dazu oben II 3). Auch soweit er nicht buchführungspflichtig ist, bedarf es dafür einer Vorsorge wie im Fall der Bildung von Rückstellungen.
c) Reschkes Ergebnis – Straffreiheit – ändert sich spätestens in dem Moment, in dem der Entzug der Gemeinnützigkeit bestands- oder rechtskräftig wird. Damit sei der Nachteil eingetreten und der Tatbestand erfüllt (S. 277 f.). Mangels näherer Befassung mit der Quantifizierung ist anzunehmen, dass Reschke die Beschreibung dieses Nachteils für ausreichend erachtet. Das sei nicht kritisiert.
Hinzuweisen ist aber auf Umstände, die beide Ergebnisse, Straffreiheit des bloß drohenden bei Strafbarkeit des tatsächlichen Entzugs der Gemeinnützigkeit, als unstimmig erscheinen lassen: Die Ungewissheit der tatsächlich eintretenden Rechtsfolgen ist es, die Reschke als Begründung dafür dient, dem erst drohenden Entzug die Untreuerelevanz abzusprechen. Der auf dem Ausnutzen vorhandener Spielräume beruhende Entzug soll demgegenüber nachteilsbegründend wirken. Die Strafbarkeit lässt er demgemäß davon abhängen, wie großzügig der Steuerbeamte ist. Das aber kann der Täter überhaupt nicht beeinflussen. Die tatbestandliche Zurechnung einer Entscheidung eines Dritten, die so oder auch gegenteilig ausfallen kann, ist ersichtlich erklärungsbedürftig im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem Schuldprinzip. Sie geht zwar auf die Pflichtwidrigkeit des Täters zurück. Damit ist jedoch nur die schlichte Kausalkette i.S. der Äquivalenztheorie beschrieben. Die Berücksichtigung rein tatsächlich eingetretener Folgen ist zwar im Rahmen der Strafzumessung, § 46 StGB, zulässig. Das gilt aber nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres auch auf Tatbestandsebene.
Soll nicht gerade das von Reschke (eben für die beschreibende Feststellung des Nachteils, S. 267 – 276, dazu oben II 4 a bb) befürwortete Unmittelbarkeitserfordernis (u.a.) vor der strafrechtlichen Haftung für Entscheidungen Dritter bewahren? Reschke vermeidet einen Widerspruch, indem er diesem Erfordernis nur im Rahmen der Feststellung von Gefährdungschäden Bedeutung zumisst. Liegt es aber denn nicht in der Konsequenz des Anliegens der Befürworter dieses Restriktionskriteriums, dessen Anwendung auch auf Untreuefälle mit abgeschlossenem Sachverhalt (wie bei erfolgtem Entzug der Gemeinnützigkeit) zu bejahen? Hier zeigt sich die Unbrauchbarkeit sämtlicher Versuche qualitativer Einschränkung des Nachteilsbegriffs. Diese sich nicht ohne Grund in immer kleineren Verästelungen auswirkende und unnötig Verwirrung stiftende Dogmatik führte Reschke in eine Lage, in der er völlig zu Recht nach sinnvollen Auswegen suchte, die aber immanent gar nicht zu finden sind.
III.
Neben der bereits erwähnten Befassung mit dem organisationsbezogenen Ansatz prüft Reschke unter dem Gesichtspunkt des Bankrotts ausführlich dessen Übertragbarkeit auf den e.V. Dies bejaht er nach ausführlicher Prüfung (S. 311 – 320), obwohl „ein Gedankengang dahingehend, einen e.V. als Verbraucher i.S. der §§ 304 ff. InsO einzuordnen und ihn deswegen dem Anwendungsbereich des § 283 StGB zu entziehen, ohnehin keinen Sinn ergibt“ (S. 314, Radtke zitierend). Die Anwendbarkeit des § 283 StGB sei auch für die Alternative des Handelns bei Überschuldung nicht eingeschränkt, obwohl § 19 Abs. 2 InsO den Begriff des Unternehmens verwende – allerdings nicht im technischen Sinne und nur den Nachlass und die fortgesetzte Gütergemeinschaft aus seinem Anwendungsbereich ausklammerd (S. 304 f.). Der aktuelle, zum Dauerrecht erhobene Überschuldungsbegriff komme den Vereinen sehr entgegen (S. 306). § 283 Abs. 1 Nrn. 5 und 7 StGB sei allerdings nur auf Groß- und sonstige Vereine mit einem Wirtschaftsbetrieb gem. dem steuerrechtlichen Nebenzweckprivileg anwendbar (S. 310 f.).
IV.
Im Hinblick auf die Insolvenzverschleppung, § 15a Abs. 4 InsO ist der Befund seit dem 1.7.2014 eindeutig: Die Strafvorschrift gilt nicht für Vereine. Für Reschke ist das aber nach wie vor nur für Idealvereine ohne Wirtschaftsbetrieb zweifelsfrei (S. 322 – 341). Bei kaufmännisch organisierten Großvereinen (S. 358 – 362) erkennt er eine Rechtsformverfehlung (S. 356), welche es an sich erlaube, sie als Kaufleute anzusehen, die im Hinblick auf die Maßgeblichkeit der insolvenzrechtlichen Vorschriften nicht der privilegierenden Norm des § 42 Abs. 2 BGB, sondern dem § 15a InsO unterfielen (S. 349 f., 354 und 356 f.). Nur der bei Schaffung des neuen § 15a Abs. 6 InsO zum Ausdruck gebrachte gesetzgeberische Wille, Vereine insgesamt weiterhin allein dem § 42 Abs. 2 BGB zuzuordnen, lässt Reschke von seiner Befürwortung auch strafrechtlicher Einordnung von kaufmännisch organisierten Großvereinen als dem § 15a InsO unterfallend de lege lata Abstand nehmen und dies lediglich noch de lege ferenda befürworten. Seinen überzeugenden Argumenten kann man nur zustimmen.
V.
Das Fazit fällt nicht einheitlich aus: Auf der Basis der h.M. ist die Arbeit nicht nur äußerst material- und kenntnisreich, sondern zudem außerordentlich anregend, weil Reschke völlig zu Recht darauf besteht, sich mit unstimmigen Ergebnissen nur dort zufrieden zu geben, wo er bei aller ihm erfreulicherweise eigenen Phantasie keine andere Alternative sieht. Seine überzeugende, an den Missbrauch der Rechtsform anknüpfende Differenzierung zwischen Ideal- und kaufmännisch organisiertem Großverein für geltendes Recht zu erklären, hat allein der Gesetzgeber mit seiner dem Vereinsprivileg verhafteten Einführung des § 15a Abs. 6 InsO verhindert. Sein Potential zu transzendentem juristischen Denken setzte Reschke auch im dogmatischen Dschungel des § 266 StGB ein – nicht ohne, aber auch nicht mit überall durchschlagendem Erfolg. Dass er sich damit in einer Reihe vieler anderer namhafter Autoren wiederfindet, ist zwar schade, zeigt aber, dass ihm aus diesem Bedauern kein Vorwurf erwachsen darf. Für das Recht des eingetragenen Vereins entwickelte Reschke auf der Basis der immerhin partiell in Frage gestellten üblichen Untreuedogmatik für § 266 StGB, nachfolgend in aus Gründen geringeren Umstrittensseins weniger problematisierender Weise auch für § 283 StGB und für § 15a InsO, Lösungen, die dem Stand der aktuellen rechtswissenschaftlichen Diskussion ebenso wie praktischen Notwendigkeiten jedenfalls weitgehend Rechnung tragen. Das ist trotz des Infragestellens mancher gleichwohl auf hohem Niveau angesiedelter Passagen weit mehr als sich von vielen anderen Dissertationen guten Gewissens sagen lässt!