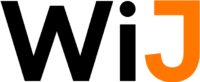„Die neue StPO“ – Kommissionsbericht und (nicht nur) Wirtschaftsstrafsachen Leipzig, 3.12.2015
I. Einstimmung
3 Juristen – 4 Meinungen. Eine Professorin, ein Ministerialdirigent, ein Richter, ein Staatsanwalt, ein Verteidiger: Was soll das schon „bringen“, wenn diese Fünf miteinander, selbst unter der besonnenen Regie des Berliner Rechtsanwalts Alexander Sättele, über den am 13.10.2015 veröffentlichten Bericht der vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz eingesetzten Experten-Kommission diskutieren? Eine ganze Menge – jedenfalls sehr „WisteV-like“, zumindest im Sächsischen Advent an der Leipziger Universität! Waren die in Verbindung mit der Dependance von BGH und GBA stehenden Leipziger Veranstaltungen, diesmal gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Wirtschaftsstrafrecht (DZWiSt) durchgeführt, in den letzten Jahren meist sogar überbucht, so zogen ihr in diesem Jahr eine bemerkenswerte Anzahl von Berufsjuristen den Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsfeier vor: selbst schuld, sie verpassten ein Highlight! Ein extra aus ca. 400 km Entfernung Angereister verabschiedete sich mit den Worten, dass sich jeder Kilometer gelohnt habe.
In der Tat: Zahlreiche neugierige Studenten und Referendare beiderlei Geschlechts traten an die Stelle der Profis – und trugen zu einer Diskussion in bei solcher Gelegenheit selten gesehener Tiefe bei: Jeder Vortragende stellte sich in bewundernswerter Weise auf den Nachwuchs ein. Dazu war es nötig, sich sowohl der Basics als auch der Systematik zu versichern, bevor man zu den Änderungsvorschlägen Stellung nehmen konnte. Das gelang den Vortragenden bestens. Spontan mischte sich eine Vorlesung StPO mit der Auseinandersetzung über in Zusammenhänge eingebettete Details und ihre mögliche Fortentwicklung. Allen Anwesenden eröffnete sich so ein beinahe sinnlich fassbarer, jedenfalls klarer, unverschleierter und sehr verständlicher Blick auf die Problemfelder. Lösungsmöglichkeiten wurden ebenso begreiflich wie ihre Grenzen. Das Erstaunlichste: Über Berufsgruppen hinweg! Niemand verzog sich in das Schneckenhaus seiner persönlichen Interessen: Wissenschaft, Praxis und Ministeriale im wechselseitigen Verständnis für die jeweiligen Aufgaben und Funktionen rangen um der Sache Bestes! Charakterisiert dieses Niveau den Gesetzgebungsprozess: Chapeau – und danke, wenn es auch im politischen Teil des Verfahrens so bleiben sollte!
II. Das die Diskussion befeuernde Grußwort, RiBGH Prof. Dr. Mosbacher, Karlsruhe/Leipzig und „Die umstrittene Inbegriffsrüge“, Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider, Leipzig
RiBGH Prof. Dr. Mosbacher beschränkte sich nicht auf sein Grußwort. Er schlug sogleich Pflöcke in die Diskussion, spießte konfliktträchtige Folgen des Vorschlags der Kommission zur Schaffung der Pflicht des Vorsitzenden, den Inhalt im Selbstleseverfahren eingeführter Urkunden mündlich in der Hauptverhandlung vorzutragen, auf und zeigte sich als Befürworter der Einführung zumindest teilweiser Videographierung der Hauptverhandlung, einem Prüfauftrag der Kommission. Als ad-hoc Korreferent stellte er in Absprache mit Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider im Rahmen von dessen Vortrag einen selbstformulierten Gesetzesvorschlag zu einerseits möglicher, andererseits aber nur begrenzter und damit auf Handhabbarkeit zielender revisionsrechtlicher Überprüfbarkeit vor. Erfolgreich soll sie danach dann sein, wenn die Videoaufnahme eindeutige Abweichungen der Urteilsfeststellungen in schwerwiegendem Maße dokumentiere. Die Einigkeit der beiden Vertreter der Bundes-Justiz beschränkte sich in diesem Punkt darauf, dass dies eine erhebliche Durchbrechung des bisher bis auf wenige Ausnahmen geltenden Rekonstruktionsverbots der Hauptverhandlung darstellen würde. Während Mosbacher davor warnte, sich Neuem zu verschließen, zeigte Schneider den mit der möglichen Änderung verbundenen Strukturwandel in mehrfacher Hinsicht auf.
Beginnen würde dies bereits mit der Aufnahme selbst. Insbesondere nicht Kamera-Gewöhnte verhielten sich nicht so unbefangen wie sonst. Stünden die Aufzeichnungen dem Gericht vor der Urteilsberatung zur Verfügung, so müsse dies auch für Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor den Plädoyers gelten. Und auch für die Rechtsmittel-, insbesondere für die Revisionsbegründung. Das Vorhandensein einer als authentisch geltenden Aufzeichnung der Hauptverhandlung würde eine Sogwirkung entfalten, welche jegliche Beschränkung auf Teile des gerichtlichen Geschehens binnen Kurzem als illusorisch erscheinen ließe und zudem den Zweck des Unmittelbarkeitsprinzips ad absurdem führe: maßgeblich sei nicht mehr all das, was das Gericht wahrnehme, miterlebe auch jenseits vielleicht wohlformulierter oder gedrechselter Worte – Gesten, Reaktionen, zuweilen unwillkürliche, die Stimmung, das „Klima“ – sondern nur noch das, was die Kamera einfange, letztlich der von der Situation unabhängige, allem übrigen entkleidete rein rationale Sinngehalt gesprochener Worte – unabhängig von deren aus dem Zusammenhang abzuleitender Überzeugungskraft. Nicht mehr, was der erkennende Richter aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung schöpfe, sondern eine reduktionistische Scheinrationalität, nicht das, wovon der Tatrichter überzeugt sei, sondern wovon er nach Auffassung des Revisionsgerichts hätte überzeugt sein müssen, fände dessen Gnade.
Angesichts dieser prozessrechtsimmanenten Argumentation traten die von Schneider ebenfalls herausgestellten nicht in den Griff zu bekommenden praktischen Schwierigkeiten schon beinahe in den Hintergrund: Aufgrund der sachlich unumgänglichen Notwendigkeit, auch Negativ- und solche Tatsachen in der Revisionsbegründung vorzutragen, welche geeignet sein könnten, ihrer Begründetheit den Boden zu entziehen, müssten bereits die Verteidiger im Revisionsverfahren nach monate- oder jahrelanger Hauptverhandlung wochenlang „fernsehen“, gefolgt von der Tatstaatsanwaltschaft zwecks Fertigung der Gegenerklärung, der Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht vor deren Stellungnahme und Antragstellung, und schließlich dem Revisionsgericht selbst. Dies sei für Verteidiger nur bei Angeklagten realistisch, bei denen es nicht auf das Geld ankomme, und führe zu einer zeitlichen Ausdehnung des Revisionsverfahrens, welche alle bisherigen Fristen sprenge und mit dem Beschleunigungsgebot in Haftsachen auch dann nicht vereinbar wäre, wenn der personelle Mehrbedarf wider Erwarten gedeckt werden würde. Sehr menschlich legte der Bundesanwalt den Wandel seiner Auffassung dar: in seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim GBA habe er noch forsch dem Fortschritt das Wort geredet – bis er sich nunmehr davon überzeugt habe, dass es nur ein scheinbarer wäre. Unter Hinweis auf die Notwendigkeit, Fehlurteile im möglichen Umfang zu vermeiden, erntete Schneider heftigen Widerspruch aus dem Publikum, ohne dass allerdings ein Weg zur Lösung der von ihm aufgezeigten Probleme sichtbar geworden wäre. Schließlich erwies sich Schneider allerdings doch nicht als Apologet der Versteinerung. Der Gegenauffassung kam er mit dem Vorschlag entgegen, Tonaufnahmen wichtiger Vernehmungen zuzulassen, weil die bloße Audio-Aufzeichnung die Befangenheit weniger beeinträchtige. Ließen sich damit aber die beschriebenen Probleme umschiffen? Oder doch nur mindern? Vielleicht jedoch in einem Maße, das die Vorteile an Beweissicherheit die Inkaufnahme der Nachteile dann rechtfertigen würde.
III. Die Referate
1. „Überblick über die Vorstellungen der StPO-Kommission“, Ministerialdirigent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Korte, Berlin
Das planmäßig erste Referat hielt Ministerialdirigent Dr. Korte, unter dessen Verantwortung der Kommissionsbericht im BMJV in einen Gesetzesentwurf münden wird. Nachdem er die Zusammensetzung der Kommission vorgestellt und dargestellt hatte, dass das BMJV sich an der Arbeit der Kommission beteiligt hätte, ohne allerdings über ein Stimmrecht zu verfügen, gewichtete er die Ergebnisse auch danach, mit welcher Mehrheit sie zustande kamen. Insbesondere bei sehr knappen Abstimmungen liege es nahe, sehr genau zu prüfen, inwieweit der Kommission gefolgt werden könne. Aufgeteilt auf die Verfahrensabschnitte ging Dr. Korte anschließend auf einen Teil der Vorschläge näher ein.
Bemerkenswert war dabei, dass er nicht nur Änderungsvorschläge erwähnte, sondern auch ausdrücklich betonte, dass manche Regelungen auf den Prüfstand gestellt worden wären, sich jedoch gezeigt hätte, dass das geltende Recht angemessenere Regelungen enthalte als es bei Verwirklichung erwogener Änderungen der Fall wäre. Der Kommisionsbericht bestätigte insbesondere manche Regel für die Zeit ab Eröffnung des Hauptverfahrens, so die Besetzung der Strafkammern, die Annahmeberufung, die Sprungrevision, die Beschränkung des Wahlrechtsmittels auf das JGG, die Revisionsbegründungsfrist, die amtswegige Prüfungspflicht der Sachurteilsvoraussetzungen auch im Revisionsverfahren sowie dessen Maß an Schriftlichkeit und Begründungspflicht, aber auch das Recht der Wiederaufnahme.
Die in den letzten Jahren ausgeweiteten Richtervorbehalte sollen bis auf die eng begrenzte Ausnahme der Blutprobenentnahme erhalten bleiben. Aber auch insoweit soll die Zuständigkeit des Richters nicht schlicht entfallen, sondern durch eine Regelzuständigkeit des Staatsanwalts ersetzt werden. Da dieser aber ebenso wie de lege lata der Richter ausschließlich auf eine einzige Erkenntnisquelle zurückgreifen kann, nämlich den (fern-)mündlichen Bericht des kontrollierenden Polizeibeamten, sprechen gegen eine solche Umgestaltung dieselben Argumente wie gegen das geltende Recht: Ein Gewinn an Rechtstaatlichkeit lässt sich damit trotz Entfallens eines (überflüssigen) bürokratischen Schritts nicht erreichen, sondern nur eine Vermehrung der Zahl unausgeschlafener Staatsanwälte – oder glaubt jemand an das Wunder des Erfüllens des zusätzlichen Personalbedarfs durch die Länder? Bleiben soll auch der Richtervorbehalt für Obduktionen – und das, obwohl sich nur Stimmen finden, welche sich angesichts einer anzunehmenden erheblichen Dunkelziffer für eine Ausweitung ihrer Anzahl aussprechen, es keine (erkennbar) missbräuchlichen staatsanwaltschaftlichen Anträge gibt, sondern vielmehr die Überlastung der Ermittlungsrichter zu Verzögerungen führt, die angesichts der Flüchtigkeit mancher Beweise durchaus die Gefahr ihres Verlusts bergen.
2. „Verteidigerrechte im Ermittlungsverfahren“, Frau Prof. Dr. Beckemper, Leipzig
Frau Prof. Dr. Beckemper befasste sich anschließend mit einigen möglichen Neuerungen für die Verteidigung. Dabei beeindruckte insbesondere ihre schwerpunktmäßige Problematisierung des Rechts auf Pflichtverteidigung bei Freiheitsentziehung. Seit der Novelle 2009 markiert § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO den Beginn der Untersuchungshaft als Zeitpunkt einsetzender Pflichtverteidigung. Das bedeutet, dass die Zeit davor nicht darunter fällt. Das wird von den Strafverteidigern insbesondere für die Phase nach vorläufiger Festnahme heftig kritisiert. Die Referentin anerkannte die Berechtigung dieser Kritik: plötzlicher Freiheitsentzug stehe zumindest in einem Spannungsverhältnis zum notwendigen kühlen Ventilieren der Verteidigungsmöglichkeiten und damit deren optimaler Gestaltung. Sowohl bei der ersten Vernehmung, regelmäßig durch geschulte Polizeibeamte, als auch bei der Vorführung vor den (Ermittlungs-)Richter bestehe daher die Gefahr vermeidbarer Selbstbelastung und unpräziser, die Glaubwürdigkeit beeinträchtigender Aussagen.
Sie blieb dabei jedoch nicht etwa stehen, sondern schlüpfte aus der Rolle der reinen Wissenschaftlerin zusätzlich in die ergänzende einer Praktikerin. Dabei konstatierte sie, durchaus noch ganz Wissenschaftlerin, ein Spannungsverhältnis zwischen dem Interesse an optimaler Verteidigung und dem Beschleunigungsgrundsatz. Die Vorführung vor den Richter müsse schon aus verfassungsrechtlichen Gründen schnellstmöglich vonstatten gehen. Sie verzögere sich bereits heute aufgrund der gebotenen Anhörung, ggf. Überprüfung daraus gewonnener Erkenntnisse und der Kenntnisnahme der polizeilichen Ermittlungsergebnisse seitens der allein antragsberechtigten Staatsanwaltschaft, der unumgänglichen Lektüre der Akten seitens des Ermittlungsrichters vor Beginn der Vorführung und der Klärung etwaiger sich ihm stellender Fragen. Würde sich in der Zwischenzeit zwar wohl noch Gelegenheit für die Bestellung eines Pflichtverteidigers bieten, so ließe sich aber dessen sachgerechte Verteidigungsfähigkeit nicht auch noch gewährleisten. Der Beschuldigte habe ein Recht auf einen Verteidiger seiner Wahl. Ob dieser jedoch gerade Zeit habe, sich ihm in der kurzen Zeit vor der Vorführung zu widmen, sei alles andere als sicher. Gerade in komplexen Fällen sei es zudem mit bloßer Kontaktaufnahme nicht getan, sondern die Sach- und Beweislage müsse intensiv erörtert, ggf. überprüft werden. Gelegenheit biete sich dazu jedoch nicht binnen des kurzen und nicht zur Disposition des Beschuldigten stehenden Zeitfensters. Mit erkennbarem Unbehagen zog sie aus den Umständen die Konsequenz, dass die geltende Regelung beizubehalten sei, weil und solange sich keine Lösung der mit einer Vorverlagerung der Pflicht zur Bestellung eines Verteidigers verbundenen Probleme abzeichne.
3. „Änderungen im Beweisantragsrecht“, Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider, Leipzig
Bevor Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider zu seinen bereits dargestellten Ausführungen zur Videographierung in der Hauptverhandlung und den damit zusammenhängenden Problemen der Inbegriffsrüge ansetzte, wandte er sich dem Thema Präklusion von Beweisanträgen zu. Sehr eindrucksvoll erwies er sich als rechtstaatlicher Verteidiger der Notwendigkeit eines Beweisantragsrechts als Ergänzung der Pflicht zur Amtsaufklärung, § 244 Abs. 2 StPO. Er wandte sich sowohl gegen die Bestimmung eines Zeitpunktes, bis zu dem Beweisanträge nur gestellt werden dürften, als auch gegen die vom 1. Strafsenat des BGH entwickelte Lösung, nach der das Gericht in exzeptionellen Fällen eine Frist mit der Folge setzen dürfe, deren Überschreitung als Indiz für Prozessverschleppung wirke. Mit Nachdruck sprach er sich für eine Regelung aus, die allgemein und nicht nur für bestimmte Fälle gelte. Als sachgerecht betrachtet er im Einklang mit der Kommission den Zeitpunkt des Abschlusses der von Amts wegen vorgesehenen Beweisaufnahme. Das verlangt natürlich ein den Verfahrensstoff verlässlich beherrschendes Gericht, denn nur dann lässt sich das Beweisprogramm sachgerecht voraussehen. In Anlehnung an eine vom 5. Strafsenat mit Unterstützung der Bundesanwaltschaft schon vor längerer Zeit entwickelte und von der Kommission aufgenommene Rechtsprechung sprach er sich für die Möglichkeit aus, dass das Gericht nach dem genannten Zeitpunkt eine Frist zum Stellen ergänzender Beweisanträge setzen dürfe, dies allerdings lediglich (wie bei Hilfsbeweisanträgen) zur Folge haben solle, danach ohne genügende Entschuldigung gestellte Anträge erst in den Urteilsgründen bescheiden zu müssen, regelmäßig also ihre Zurückweisung zu begründen. Die Reaktion überraschte: es blieb jeglicher Widerspruch aus! Ersichtlich ist dieser Weg auch aus wissenschaftlicher und der Sicht der Verteidigung konsensfähig: der Bundesgesetzgeber muss diese Steilvorlage also nur noch verwandeln und dabei nicht einmal mehr einen Torhüter überwinden!
4. „Transfer im Ermittlungsverfahren erhobener Beweise in die Hauptverhandlung“, Rechtsanwalt Prof. Dr. König, Berlin
Im Abschlussreferat widmete sich Rechtsanwalt Prof. Dr. König Fragen des Beweistransfers aus dem Ermittlungsverfahren in die Hauptverhandlung. Er zeigte den geringen gesetzgeberischen Spielraum für eine Ausdehnung auf. Das Konfrontationsrecht des Beschuldigten verlange nach der Möglichkeit, einem Zeugen Fragen stellen zu dürfen. Aus Sorge vor Beweismittelverlust oder der Warnfunktion gegenüber einem über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens noch gar nicht in Kenntnis gesetzten Beschuldigten verzichte aber die Justiz bereits heute häufig auf die Beteiligung der Verteidigung bei richterlichen Vernehmungen. Das werde bei der Möglichkeit des Transfers polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Vernehmungen in die Hauptverhandlung nicht anders sein, erzwinge damit aber die Vernehmung des Zeugen vor dem erkennenden Gericht, jedenfalls auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten. Hinzu komme, dass Verteidiger durchaus nicht immer Zeit hätten, die Gelegenheit der Beteiligung an Vernehmungen wahrzunehmen. Zusätzliche Aufgaben im Ermittlungsverfahren stießen überdies an wirtschaftliche Grenzen.
In Anerkennung dieser einschränkenden Umstände assoziierte Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider spontan eine Variante: Nicht konsentierter Transfer nur dann, wenn der Verteidiger bei der Vernehmung (oder einer anderen Maßnahme, z.B. Augenschein) im Ermittlungsverfahren tatsächlich anwesend war. Aufstöhnend kommentierte Rechtsanwalt Sättele dies mit der Unverständnis ausdrückenden Bemerkung, warum denn die Verteidigung jede Verbesserung solle „erkaufen“ müssen.
Ein weiterer Schwerpunkt des letzten Vortrags knüpfte an den im Grußwort von RiBGH Prof. Dr. Mosbacher abgelehnten Vorschlag der Kommission an, zukünftig den (wie bei Erörterungen gemäß §§ 202a und 212 StPO) „wesentlichen Inhalt“ im Selbstleseverfahren eingeführter Urkunden mündlich in der Hauptverhandlung vorstellen zu müssen. Rechtsanwalt Prof. Dr. König stellte sich hingegen auch insoweit hinter die Kommission. Er blieb dabei jedoch nicht stehen, sondern interpretierte ihn sehr extensiv. Dem von der Kommission mit 11:10 Stimmen angenommenen, in der knappen Begründung aber nicht weiter problematisierten Vorschlag einer schlichten Pflicht zur Mitteilung legte er, wohl aufgrund der Beschränkung auf die „Wesentlichkeit“ ihres Inhalts, das Verständnis bei, damit habe der Vorsitzende zugleich die aus der Sicht des Gerichts bejahte Beweisbedeutung insbesondere des verlautbarten Teils des Urkundeninhalts zu dokumentieren.
Setzte sich die so ausgelegte Regelung durch, so wäre die Verteidigung einem seit langem verfolgten Ziel einen Schritt näher gekommen, die Sichtweise des Gerichts bereits vor Abschluss der Beweisaufnahme zu erfahren, um darauf noch vor Urteilsverkündung reagieren zu können. Zulässig ist dies bereits heute und nicht erst seit dem Verständigungsgesetz, nur erzwingbar ist es nicht. Das Spannungsverhältnis zum Verbot vorweggenommener Beweiswürdigung ist nicht zu übersehen. Auf Widerspruch stieß König aber vor allem aufgrund der Unklarheiten, ob und in welchem Maße Angeklagter und Verteidiger darauf vertrauen dürften, dass nicht vorgetragene Inhalte selbstgelesener Urkunden keinen Eingang in die Urteilsfindung, jedenfalls nicht in einer den Angeklagten belastenden Art finden würden. Diese Erwägung spricht nun allerdings nicht nur gegen die erweiternde Interpretation Königs, sondern gegen den Kommissionsvorschlag als solchen. Mosbacher nannte ihn den einzigen von ihm als abwegig empfundenen und fragte, wie denn der wesentliche Inhalt einer jeden der in einem oder mehreren Stehordnern abhefteten Rechnungen mit einem immer gleichen steuerrelevanten Fehler bestimmt werden solle: mit dem Betrag? Das stelle das Selbstleseverfahren insgesamt in Frage. Wiewohl in der heftigen Diskussion die Skepsis gegen diesen Vorschlag der Kommission zu überwiegen schien, waren sich alle, die sich zu Wort meldeten einig, dass Bemühungen gerechtfertigt wären, Missbräuche des Selbstleseverfahrens (z.B.: „sämtliche in der Anklageschrift aufgeführten Urkunden oder in den Ordnern 1 – x abgehefteten Schriftstücke“) zukünftig abzustellen.
IV. Fazit
Ein Fazit zu ziehen war und ist nicht schwer: Der Kommission ist es bemerkenswerterweise gelungen, eine erstaunliche Anzahl weitgehend konsentierter Vorschläge zu formulieren. Die Leipziger Diskussion führte insoweit lediglich zu mancher Notwendigkeit, sie im Detail noch weiterzuentwickeln und präziser zu fassen – eine Aufgabe, der sich das BMJV sowieso bereits stellt, dafür jedoch manch wertvolle Anregung erhielt. Der Konsens betrifft v.a. punktuelle Verbesserungen. Deutlich wurde hingegen im Blick auf Vorschläge, deren Realisierung spürbare Eingriffe in die Systematik der StPO zur Folge hätte, dass das geltende Recht manchem der vorgetragenen Ansinnen deutlich besser gerecht wird als es einzelne in der Praxis aufgetretene Unstimmigkeiten vermuten lassen – und dass Novellierungsvorschläge zuweilen mit noch größeren Nachteilen verbunden sein könnten. Das spricht nicht generell gegen tiefergehende Eingriffe in das geltende Strafprozessrecht, wohl aber für ein duales Vorgehen beim Umgang mit den (positiven = ändernden wie negativen = Änderung ablehnenden) Kommissionsvorschlägen: Die punktuellen Verbesserungen sollten schnellstmöglich Eingang in das Bundesgesetzblatt finden. Demgegenüber bedarf es der Vermeidung von Schnellschüssen mit systematischer Wirkung – insoweit ist noch intensiveres Prüfen, Nachdenken und Differenzieren erforderlich.
Beides hat die DZWiSt/WisteV-Veranstaltung in überzeugender Klarheit verdeutlicht. Wer dabei war, konnte sich bei Speis und Trank, aber auch nachwirkend, sowohl am Tiefgang der Referate und ihrer Diskussion als auch an einer berufsübergreifenden Übereinstimmung in wesentlichen kleineren und weiterreichenden Aspekten erfreuen. Herzlichen Dank allen genannten Aktiven und dem aufmerksamen Publikum.
[:en]
I. Einstimmung
3 Juristen – 4 Meinungen. Eine Professorin, ein Ministerialdirigent, ein Richter, ein Staatsanwalt, ein Verteidiger: Was soll das schon „bringen“, wenn diese Fünf miteinander, selbst unter der besonnenen Regie des Berliner Rechtsanwalts Alexander Sättele, über den am 13.10.2015 veröffentlichten Bericht der vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz eingesetzten Experten-Kommission diskutieren? Eine ganze Menge – jedenfalls sehr „WisteV-like“, zumindest im Sächsischen Advent an der Leipziger Universität! Waren die in Verbindung mit der Dependance von BGH und GBA stehenden Leipziger Veranstaltungen, diesmal gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Wirtschaftsstrafrecht (DZWiSt) durchgeführt, in den letzten Jahren meist sogar überbucht, so zogen ihr in diesem Jahr eine bemerkenswerte Anzahl von Berufsjuristen den Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsfeier vor: selbst schuld, sie verpassten ein Highlight! Ein extra aus ca. 400 km Entfernung Angereister verabschiedete sich mit den Worten, dass sich jeder Kilometer gelohnt habe.
In der Tat: Zahlreiche neugierige Studenten und Referendare beiderlei Geschlechts traten an die Stelle der Profis – und trugen zu einer Diskussion in bei solcher Gelegenheit selten gesehener Tiefe bei: Jeder Vortragende stellte sich in bewundernswerter Weise auf den Nachwuchs ein. Dazu war es nötig, sich sowohl der Basics als auch der Systematik zu versichern, bevor man zu den Änderungsvorschlägen Stellung nehmen konnte. Das gelang den Vortragenden bestens. Spontan mischte sich eine Vorlesung StPO mit der Auseinandersetzung über in Zusammenhänge eingebettete Details und ihre mögliche Fortentwicklung. Allen Anwesenden eröffnete sich so ein beinahe sinnlich fassbarer, jedenfalls klarer, unverschleierter und sehr verständlicher Blick auf die Problemfelder. Lösungsmöglichkeiten wurden ebenso begreiflich wie ihre Grenzen. Das Erstaunlichste: Über Berufsgruppen hinweg! Niemand verzog sich in das Schneckenhaus seiner persönlichen Interessen: Wissenschaft, Praxis und Ministeriale im wechselseitigen Verständnis für die jeweiligen Aufgaben und Funktionen rangen um der Sache Bestes! Charakterisiert dieses Niveau den Gesetzgebungsprozess: Chapeau – und danke, wenn es auch im politischen Teil des Verfahrens so bleiben sollte!
II. Das die Diskussion befeuernde Grußwort, RiBGH Prof. Dr. Mosbacher, Karlsruhe/Leipzig und „Die umstrittene Inbegriffsrüge“, Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider, Leipzig
RiBGH Prof. Dr. Mosbacher beschränkte sich nicht auf sein Grußwort. Er schlug sogleich Pflöcke in die Diskussion, spießte konfliktträchtige Folgen des Vorschlags der Kommission zur Schaffung der Pflicht des Vorsitzenden, den Inhalt im Selbstleseverfahren eingeführter Urkunden mündlich in der Hauptverhandlung vorzutragen, auf und zeigte sich als Befürworter der Einführung zumindest teilweiser Videographierung der Hauptverhandlung, einem Prüfauftrag der Kommission. Als ad-hoc Korreferent stellte er in Absprache mit Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider im Rahmen von dessen Vortrag einen selbstformulierten Gesetzesvorschlag zu einerseits möglicher, andererseits aber nur begrenzter und damit auf Handhabbarkeit zielender revisionsrechtlicher Überprüfbarkeit vor. Erfolgreich soll sie danach dann sein, wenn die Videoaufnahme eindeutige Abweichungen der Urteilsfeststellungen in schwerwiegendem Maße dokumentiere. Die Einigkeit der beiden Vertreter der Bundes-Justiz beschränkte sich in diesem Punkt darauf, dass dies eine erhebliche Durchbrechung des bisher bis auf wenige Ausnahmen geltenden Rekonstruktionsverbots der Hauptverhandlung darstellen würde. Während Mosbacher davor warnte, sich Neuem zu verschließen, zeigte Schneider den mit der möglichen Änderung verbundenen Strukturwandel in mehrfacher Hinsicht auf.
Beginnen würde dies bereits mit der Aufnahme selbst. Insbesondere nicht Kamera-Gewöhnte verhielten sich nicht so unbefangen wie sonst. Stünden die Aufzeichnungen dem Gericht vor der Urteilsberatung zur Verfügung, so müsse dies auch für Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor den Plädoyers gelten. Und auch für die Rechtsmittel-, insbesondere für die Revisionsbegründung. Das Vorhandensein einer als authentisch geltenden Aufzeichnung der Hauptverhandlung würde eine Sogwirkung entfalten, welche jegliche Beschränkung auf Teile des gerichtlichen Geschehens binnen Kurzem als illusorisch erscheinen ließe und zudem den Zweck des Unmittelbarkeitsprinzips ad absurdem führe: maßgeblich sei nicht mehr all das, was das Gericht wahrnehme, miterlebe auch jenseits vielleicht wohlformulierter oder gedrechselter Worte – Gesten, Reaktionen, zuweilen unwillkürliche, die Stimmung, das „Klima“ – sondern nur noch das, was die Kamera einfange, letztlich der von der Situation unabhängige, allem übrigen entkleidete rein rationale Sinngehalt gesprochener Worte – unabhängig von deren aus dem Zusammenhang abzuleitender Überzeugungskraft. Nicht mehr, was der erkennende Richter aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung schöpfe, sondern eine reduktionistische Scheinrationalität, nicht das, wovon der Tatrichter überzeugt sei, sondern wovon er nach Auffassung des Revisionsgerichts hätte überzeugt sein müssen, fände dessen Gnade.
Angesichts dieser prozessrechtsimmanenten Argumentation traten die von Schneider ebenfalls herausgestellten nicht in den Griff zu bekommenden praktischen Schwierigkeiten schon beinahe in den Hintergrund: Aufgrund der sachlich unumgänglichen Notwendigkeit, auch Negativ- und solche Tatsachen in der Revisionsbegründung vorzutragen, welche geeignet sein könnten, ihrer Begründetheit den Boden zu entziehen, müssten bereits die Verteidiger im Revisionsverfahren nach monate- oder jahrelanger Hauptverhandlung wochenlang „fernsehen“, gefolgt von der Tatstaatsanwaltschaft zwecks Fertigung der Gegenerklärung, der Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht vor deren Stellungnahme und Antragstellung, und schließlich dem Revisionsgericht selbst. Dies sei für Verteidiger nur bei Angeklagten realistisch, bei denen es nicht auf das Geld ankomme, und führe zu einer zeitlichen Ausdehnung des Revisionsverfahrens, welche alle bisherigen Fristen sprenge und mit dem Beschleunigungsgebot in Haftsachen auch dann nicht vereinbar wäre, wenn der personelle Mehrbedarf wider Erwarten gedeckt werden würde. Sehr menschlich legte der Bundesanwalt den Wandel seiner Auffassung dar: in seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim GBA habe er noch forsch dem Fortschritt das Wort geredet – bis er sich nunmehr davon überzeugt habe, dass es nur ein scheinbarer wäre. Unter Hinweis auf die Notwendigkeit, Fehlurteile im möglichen Umfang zu vermeiden, erntete Schneider heftigen Widerspruch aus dem Publikum, ohne dass allerdings ein Weg zur Lösung der von ihm aufgezeigten Probleme sichtbar geworden wäre. Schließlich erwies sich Schneider allerdings doch nicht als Apologet der Versteinerung. Der Gegenauffassung kam er mit dem Vorschlag entgegen, Tonaufnahmen wichtiger Vernehmungen zuzulassen, weil die bloße Audio-Aufzeichnung die Befangenheit weniger beeinträchtige. Ließen sich damit aber die beschriebenen Probleme umschiffen? Oder doch nur mindern? Vielleicht jedoch in einem Maße, das die Vorteile an Beweissicherheit die Inkaufnahme der Nachteile dann rechtfertigen würde.
III. Die Referate
1. „Überblick über die Vorstellungen der StPO-Kommission“, Ministerialdirigent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Korte, Berlin
Das planmäßig erste Referat hielt Ministerialdirigent Dr. Korte, unter dessen Verantwortung der Kommissionsbericht im BMJV in einen Gesetzesentwurf münden wird. Nachdem er die Zusammensetzung der Kommission vorgestellt und dargestellt hatte, dass das BMJV sich an der Arbeit der Kommission beteiligt hätte, ohne allerdings über ein Stimmrecht zu verfügen, gewichtete er die Ergebnisse auch danach, mit welcher Mehrheit sie zustande kamen. Insbesondere bei sehr knappen Abstimmungen liege es nahe, sehr genau zu prüfen, inwieweit der Kommission gefolgt werden könne. Aufgeteilt auf die Verfahrensabschnitte ging Dr. Korte anschließend auf einen Teil der Vorschläge näher ein.
Bemerkenswert war dabei, dass er nicht nur Änderungsvorschläge erwähnte, sondern auch ausdrücklich betonte, dass manche Regelungen auf den Prüfstand gestellt worden wären, sich jedoch gezeigt hätte, dass das geltende Recht angemessenere Regelungen enthalte als es bei Verwirklichung erwogener Änderungen der Fall wäre. Der Kommisionsbericht bestätigte insbesondere manche Regel für die Zeit ab Eröffnung des Hauptverfahrens, so die Besetzung der Strafkammern, die Annahmeberufung, die Sprungrevision, die Beschränkung des Wahlrechtsmittels auf das JGG, die Revisionsbegründungsfrist, die amtswegige Prüfungspflicht der Sachurteilsvoraussetzungen auch im Revisionsverfahren sowie dessen Maß an Schriftlichkeit und Begründungspflicht, aber auch das Recht der Wiederaufnahme.
Die in den letzten Jahren ausgeweiteten Richtervorbehalte sollen bis auf die eng begrenzte Ausnahme der Blutprobenentnahme erhalten bleiben. Aber auch insoweit soll die Zuständigkeit des Richters nicht schlicht entfallen, sondern durch eine Regelzuständigkeit des Staatsanwalts ersetzt werden. Da dieser aber ebenso wie de lege lata der Richter ausschließlich auf eine einzige Erkenntnisquelle zurückgreifen kann, nämlich den (fern-)mündlichen Bericht des kontrollierenden Polizeibeamten, sprechen gegen eine solche Umgestaltung dieselben Argumente wie gegen das geltende Recht: Ein Gewinn an Rechtstaatlichkeit lässt sich damit trotz Entfallens eines (überflüssigen) bürokratischen Schritts nicht erreichen, sondern nur eine Vermehrung der Zahl unausgeschlafener Staatsanwälte – oder glaubt jemand an das Wunder des Erfüllens des zusätzlichen Personalbedarfs durch die Länder? Bleiben soll auch der Richtervorbehalt für Obduktionen – und das, obwohl sich nur Stimmen finden, welche sich angesichts einer anzunehmenden erheblichen Dunkelziffer für eine Ausweitung ihrer Anzahl aussprechen, es keine (erkennbar) missbräuchlichen staatsanwaltschaftlichen Anträge gibt, sondern vielmehr die Überlastung der Ermittlungsrichter zu Verzögerungen führt, die angesichts der Flüchtigkeit mancher Beweise durchaus die Gefahr ihres Verlusts bergen.
2. „Verteidigerrechte im Ermittlungsverfahren“, Frau Prof. Dr. Beckemper, Leipzig
Frau Prof. Dr. Beckemper befasste sich anschließend mit einigen möglichen Neuerungen für die Verteidigung. Dabei beeindruckte insbesondere ihre schwerpunktmäßige Problematisierung des Rechts auf Pflichtverteidigung bei Freiheitsentziehung. Seit der Novelle 2009 markiert § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO den Beginn der Untersuchungshaft als Zeitpunkt einsetzender Pflichtverteidigung. Das bedeutet, dass die Zeit davor nicht darunter fällt. Das wird von den Strafverteidigern insbesondere für die Phase nach vorläufiger Festnahme heftig kritisiert. Die Referentin anerkannte die Berechtigung dieser Kritik: plötzlicher Freiheitsentzug stehe zumindest in einem Spannungsverhältnis zum notwendigen kühlen Ventilieren der Verteidigungsmöglichkeiten und damit deren optimaler Gestaltung. Sowohl bei der ersten Vernehmung, regelmäßig durch geschulte Polizeibeamte, als auch bei der Vorführung vor den (Ermittlungs-)Richter bestehe daher die Gefahr vermeidbarer Selbstbelastung und unpräziser, die Glaubwürdigkeit beeinträchtigender Aussagen.
Sie blieb dabei jedoch nicht etwa stehen, sondern schlüpfte aus der Rolle der reinen Wissenschaftlerin zusätzlich in die ergänzende einer Praktikerin. Dabei konstatierte sie, durchaus noch ganz Wissenschaftlerin, ein Spannungsverhältnis zwischen dem Interesse an optimaler Verteidigung und dem Beschleunigungsgrundsatz. Die Vorführung vor den Richter müsse schon aus verfassungsrechtlichen Gründen schnellstmöglich vonstatten gehen. Sie verzögere sich bereits heute aufgrund der gebotenen Anhörung, ggf. Überprüfung daraus gewonnener Erkenntnisse und der Kenntnisnahme der polizeilichen Ermittlungsergebnisse seitens der allein antragsberechtigten Staatsanwaltschaft, der unumgänglichen Lektüre der Akten seitens des Ermittlungsrichters vor Beginn der Vorführung und der Klärung etwaiger sich ihm stellender Fragen. Würde sich in der Zwischenzeit zwar wohl noch Gelegenheit für die Bestellung eines Pflichtverteidigers bieten, so ließe sich aber dessen sachgerechte Verteidigungsfähigkeit nicht auch noch gewährleisten. Der Beschuldigte habe ein Recht auf einen Verteidiger seiner Wahl. Ob dieser jedoch gerade Zeit habe, sich ihm in der kurzen Zeit vor der Vorführung zu widmen, sei alles andere als sicher. Gerade in komplexen Fällen sei es zudem mit bloßer Kontaktaufnahme nicht getan, sondern die Sach- und Beweislage müsse intensiv erörtert, ggf. überprüft werden. Gelegenheit biete sich dazu jedoch nicht binnen des kurzen und nicht zur Disposition des Beschuldigten stehenden Zeitfensters. Mit erkennbarem Unbehagen zog sie aus den Umständen die Konsequenz, dass die geltende Regelung beizubehalten sei, weil und solange sich keine Lösung der mit einer Vorverlagerung der Pflicht zur Bestellung eines Verteidigers verbundenen Probleme abzeichne.
3. „Änderungen im Beweisantragsrecht“, Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider, Leipzig
Bevor Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider zu seinen bereits dargestellten Ausführungen zur Videographierung in der Hauptverhandlung und den damit zusammenhängenden Problemen der Inbegriffsrüge ansetzte, wandte er sich dem Thema Präklusion von Beweisanträgen zu. Sehr eindrucksvoll erwies er sich als rechtstaatlicher Verteidiger der Notwendigkeit eines Beweisantragsrechts als Ergänzung der Pflicht zur Amtsaufklärung, § 244 Abs. 2 StPO. Er wandte sich sowohl gegen die Bestimmung eines Zeitpunktes, bis zu dem Beweisanträge nur gestellt werden dürften, als auch gegen die vom 1. Strafsenat des BGH entwickelte Lösung, nach der das Gericht in exzeptionellen Fällen eine Frist mit der Folge setzen dürfe, deren Überschreitung als Indiz für Prozessverschleppung wirke. Mit Nachdruck sprach er sich für eine Regelung aus, die allgemein und nicht nur für bestimmte Fälle gelte. Als sachgerecht betrachtet er im Einklang mit der Kommission den Zeitpunkt des Abschlusses der von Amts wegen vorgesehenen Beweisaufnahme. Das verlangt natürlich ein den Verfahrensstoff verlässlich beherrschendes Gericht, denn nur dann lässt sich das Beweisprogramm sachgerecht voraussehen. In Anlehnung an eine vom 5. Strafsenat mit Unterstützung der Bundesanwaltschaft schon vor längerer Zeit entwickelte und von der Kommission aufgenommene Rechtsprechung sprach er sich für die Möglichkeit aus, dass das Gericht nach dem genannten Zeitpunkt eine Frist zum Stellen ergänzender Beweisanträge setzen dürfe, dies allerdings lediglich (wie bei Hilfsbeweisanträgen) zur Folge haben solle, danach ohne genügende Entschuldigung gestellte Anträge erst in den Urteilsgründen bescheiden zu müssen, regelmäßig also ihre Zurückweisung zu begründen. Die Reaktion überraschte: es blieb jeglicher Widerspruch aus! Ersichtlich ist dieser Weg auch aus wissenschaftlicher und der Sicht der Verteidigung konsensfähig: der Bundesgesetzgeber muss diese Steilvorlage also nur noch verwandeln und dabei nicht einmal mehr einen Torhüter überwinden!
4. „Transfer im Ermittlungsverfahren erhobener Beweise in die Hauptverhandlung“, Rechtsanwalt Prof. Dr. König, Berlin
Im Abschlussreferat widmete sich Rechtsanwalt Prof. Dr. König Fragen des Beweistransfers aus dem Ermittlungsverfahren in die Hauptverhandlung. Er zeigte den geringen gesetzgeberischen Spielraum für eine Ausdehnung auf. Das Konfrontationsrecht des Beschuldigten verlange nach der Möglichkeit, einem Zeugen Fragen stellen zu dürfen. Aus Sorge vor Beweismittelverlust oder der Warnfunktion gegenüber einem über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens noch gar nicht in Kenntnis gesetzten Beschuldigten verzichte aber die Justiz bereits heute häufig auf die Beteiligung der Verteidigung bei richterlichen Vernehmungen. Das werde bei der Möglichkeit des Transfers polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Vernehmungen in die Hauptverhandlung nicht anders sein, erzwinge damit aber die Vernehmung des Zeugen vor dem erkennenden Gericht, jedenfalls auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten. Hinzu komme, dass Verteidiger durchaus nicht immer Zeit hätten, die Gelegenheit der Beteiligung an Vernehmungen wahrzunehmen. Zusätzliche Aufgaben im Ermittlungsverfahren stießen überdies an wirtschaftliche Grenzen.
In Anerkennung dieser einschränkenden Umstände assoziierte Bundesanwalt Prof. Dr. Schneider spontan eine Variante: Nicht konsentierter Transfer nur dann, wenn der Verteidiger bei der Vernehmung (oder einer anderen Maßnahme, z.B. Augenschein) im Ermittlungsverfahren tatsächlich anwesend war. Aufstöhnend kommentierte Rechtsanwalt Sättele dies mit der Unverständnis ausdrückenden Bemerkung, warum denn die Verteidigung jede Verbesserung solle „erkaufen“ müssen.
Ein weiterer Schwerpunkt des letzten Vortrags knüpfte an den im Grußwort von RiBGH Prof. Dr. Mosbacher abgelehnten Vorschlag der Kommission an, zukünftig den (wie bei Erörterungen gemäß §§ 202a und 212 StPO) „wesentlichen Inhalt“ im Selbstleseverfahren eingeführter Urkunden mündlich in der Hauptverhandlung vorstellen zu müssen. Rechtsanwalt Prof. Dr. König stellte sich hingegen auch insoweit hinter die Kommission. Er blieb dabei jedoch nicht stehen, sondern interpretierte ihn sehr extensiv. Dem von der Kommission mit 11:10 Stimmen angenommenen, in der knappen Begründung aber nicht weiter problematisierten Vorschlag einer schlichten Pflicht zur Mitteilung legte er, wohl aufgrund der Beschränkung auf die „Wesentlichkeit“ ihres Inhalts, das Verständnis bei, damit habe der Vorsitzende zugleich die aus der Sicht des Gerichts bejahte Beweisbedeutung insbesondere des verlautbarten Teils des Urkundeninhalts zu dokumentieren.
Setzte sich die so ausgelegte Regelung durch, so wäre die Verteidigung einem seit langem verfolgten Ziel einen Schritt näher gekommen, die Sichtweise des Gerichts bereits vor Abschluss der Beweisaufnahme zu erfahren, um darauf noch vor Urteilsverkündung reagieren zu können. Zulässig ist dies bereits heute und nicht erst seit dem Verständigungsgesetz, nur erzwingbar ist es nicht. Das Spannungsverhältnis zum Verbot vorweggenommener Beweiswürdigung ist nicht zu übersehen. Auf Widerspruch stieß König aber vor allem aufgrund der Unklarheiten, ob und in welchem Maße Angeklagter und Verteidiger darauf vertrauen dürften, dass nicht vorgetragene Inhalte selbstgelesener Urkunden keinen Eingang in die Urteilsfindung, jedenfalls nicht in einer den Angeklagten belastenden Art finden würden. Diese Erwägung spricht nun allerdings nicht nur gegen die erweiternde Interpretation Königs, sondern gegen den Kommissionsvorschlag als solchen. Mosbacher nannte ihn den einzigen von ihm als abwegig empfundenen und fragte, wie denn der wesentliche Inhalt einer jeden der in einem oder mehreren Stehordnern abhefteten Rechnungen mit einem immer gleichen steuerrelevanten Fehler bestimmt werden solle: mit dem Betrag? Das stelle das Selbstleseverfahren insgesamt in Frage. Wiewohl in der heftigen Diskussion die Skepsis gegen diesen Vorschlag der Kommission zu überwiegen schien, waren sich alle, die sich zu Wort meldeten einig, dass Bemühungen gerechtfertigt wären, Missbräuche des Selbstleseverfahrens (z.B.: „sämtliche in der Anklageschrift aufgeführten Urkunden oder in den Ordnern 1 – x abgehefteten Schriftstücke“) zukünftig abzustellen.
IV. Fazit
Ein Fazit zu ziehen war und ist nicht schwer: Der Kommission ist es bemerkenswerterweise gelungen, eine erstaunliche Anzahl weitgehend konsentierter Vorschläge zu formulieren. Die Leipziger Diskussion führte insoweit lediglich zu mancher Notwendigkeit, sie im Detail noch weiterzuentwickeln und präziser zu fassen – eine Aufgabe, der sich das BMJV sowieso bereits stellt, dafür jedoch manch wertvolle Anregung erhielt. Der Konsens betrifft v.a. punktuelle Verbesserungen. Deutlich wurde hingegen im Blick auf Vorschläge, deren Realisierung spürbare Eingriffe in die Systematik der StPO zur Folge hätte, dass das geltende Recht manchem der vorgetragenen Ansinnen deutlich besser gerecht wird als es einzelne in der Praxis aufgetretene Unstimmigkeiten vermuten lassen – und dass Novellierungsvorschläge zuweilen mit noch größeren Nachteilen verbunden sein könnten. Das spricht nicht generell gegen tiefergehende Eingriffe in das geltende Strafprozessrecht, wohl aber für ein duales Vorgehen beim Umgang mit den (positiven = ändernden wie negativen = Änderung ablehnenden) Kommissionsvorschlägen: Die punktuellen Verbesserungen sollten schnellstmöglich Eingang in das Bundesgesetzblatt finden. Demgegenüber bedarf es der Vermeidung von Schnellschüssen mit systematischer Wirkung – insoweit ist noch intensiveres Prüfen, Nachdenken und Differenzieren erforderlich.
Beides hat die DZWiSt/WisteV-Veranstaltung in überzeugender Klarheit verdeutlicht. Wer dabei war, konnte sich bei Speis und Trank, aber auch nachwirkend, sowohl am Tiefgang der Referate und ihrer Diskussion als auch an einer berufsübergreifenden Übereinstimmung in wesentlichen kleineren und weiterreichenden Aspekten erfreuen. Herzlichen Dank allen genannten Aktiven und dem aufmerksamen Publikum.