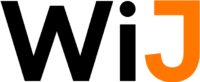Ingo Bott, Das Recht zu strafen
Grafit Verlag, 2017, 416 S., 13,00 Euro.
Am deutschen Strafrechtsautorenhimmel ist ein Platz frei geworden. Ferdinand von Schirach ist ins Fernsehen abgewandert. Kann Ingo Bott, Jahrgang 1983, mittlerweile Partner in einer Wirtschaftsstrafrechtsspezialboutiquekanzlei den Platz einnehmen und vielleicht sogar dauerhaft verteidigen?
Das Recht zu strafen ist Ingo Botts Erstlingsdebüt. Zunächst fällt die sprachliche Prägnanz auf. Die Sätze sind kurz und einprägend. Sie wirken jedoch weder abgehackt, noch gestelzt. Es liest sich einfach gut. Der alte Alfred Gleiss, der wahre Grandseigneur der Juristensprache, die man versteht, würde vor Freude Purzelbäume schlagen. Sprachkompetenz gepaart mit großem Vokabular weiß der Autor insgesamt vorzuweisen und zu Gunsten des Lesers einzusetzen. Dabei darf es auch mal derbe werden, wenn der jeweilige Charakter seinem Naturell nach es erfordert. Oder witzig. Oder anzüglich. Denn zumindest einige Protagonisten bewegen sich ungefähr im Alter des Autors, also noch im besten Paarungsalter. Erzählerische Zurückhaltung á la Kommissar Wallander wäre demnach schon umfeldmäßig fehl am Platz.
Für den Juristenleser, der sich durch juristisch nicht-fachlichen Stoff unterhalten möchte, ist es zusätzlich eine Freude, juristisch wahres Leben wiederzuerkennen. Welchen Strafverteidiger, Staatsanwalt oder Strafrichter juckt es nicht unangenehm unerträglich in den Fingern, wenn beim sonntagabendlichen Tatort mal wieder alle Vorgaben der Strafprozessordnung aus Gründen der Dramaturgie über Bord geworfen werden? Dieses Übel kommt auch für den sehr fachkundigen Leser bei diesem Roman sicher nicht auf. Ingo Bott weiß, wovon er schreibt und spricht. Auch wenn er sich nicht ganz dagegen erwehren kann, dem Trend zu folgen, die Staatsanwaltsprotagonisten in zu sehr rosa wolkiges Arbeitsumfeld zu versetzen. Zwar gibt es in hiesigem Krimi keine teuren Designerdrehstühle von Vitra und auch keine USM-Möbel, wie in so manchen Fernsehdarstellungen. Das ist schonmal gut. Dass der Posteingang der verschiedenen Ermittlungsverfahren indes der ermittelnden Staatsanwältin in einer blauen Postmappe von der Geschäftsstelle vorgelegt wird, ist gleichwohl durchschimmernde Großkanzleianwaltsvorstellung. Das Leben zwischen täglichen Bergen von roten Akten, die sich der Staatsanwaltsdezernent seit großen Kosteneinsparungsrunden jeden Tag selbst in sein Zimmerchen schleppen muss, wäre das wahre Leben der Berliner Justiz. Auch hat die Hauptprotagonisten erstaunlich viel Zeit, ständig mit den Polizeibeamten bei den alltäglichen Ermittlungen herumzuhängen. Hiervon abgesehen, ist das Leben im Berliner Strafrechtsmillieu gut recherchiert und anschaulich wiedergegeben.
Inhaltlich gelingt es dem Autor durch kleine Zeitsprünge, schnell Spannung aufzubauen und über die meisten der 440 Seiten aufrechtzuerhalten. Die kleinen Hänger zur Mitte bis Ende der ersten Hälfte werden durch gute Spannungspurts in der zweiten Halbzeit verdrängt. Der Leser kann sich hierbei mit den Sorgen, Zwängen und Gefühlen der Protagonisten gut identifizieren. Wobei auch die zahlreichen Details in den Darstellungen des Settings und der Personalien dienen. Ingo Bott hat hier ganz offenkundig – wenn es auch im Vorspann abgestritten wird – sehr viele wahre und eigene Erlebnisse eingeflochten. Ich bin mir sicher, dass die Ü30-Kaffeetasse tatsächlich auf seinem eigenen Schreibtisch steht. So viel Leidenschaft liegt in dieser und anderen Detaildarstellungen.
Von der weiteren Handlung, der persönlichen Verflechtung von Starverteidiger und der „heißesten Staatsanwältin Berlins“, den Strafverteidigern als Tätern und Opfern, soll an dieser Steller besser nicht zu viel verraten werden.
Ist das Buch also lesenswert? Klare Antwort: unbedingt. Sowohl für Strafrechtler, Juristen, Hobby-Juristen, Berliner und allgemein Krimi-Liebhaber. Man muss lediglich die eine oder andere Passage aushalten, bei denen sich Dialoge auch mal in allgemeineres Geplänkel ausweiten. Aber Philosophieren rund um Sokrates ist halt auch inhaltsbestimmender Teil der Storyline.
Kann Ingo Bott einen festen Platz im Strafrechtsautorengefüge einnehmen? Wohl auch das. Der Grundstein ist mit dem Debütalbum erfolgreich gelegt. Es besteht Vorfreude auf den nächsten Roman. Dieser muss dann allerdings umfänglich nicht zwingend wieder 50 Seiten mehr haben als die auch schon ins prosaische angrenzende Dissertation des Autors (In dubio pro Straffreiheit).