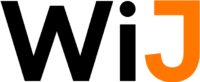In letzter Instanz: Das Strafrecht vor dem Bundesverfassungsgericht, EuGH und EGMR
Mein Vortrag[1] behandelt das Strafverfahren in „letzter Instanz“, wobei dieser Titel in jeglicher Hinsicht irreführend ist, denn keines der Gerichte, die ich behandeln möchte – der EuGH, der EGMR und das BVerfG – sind Instanzgerichte. Jedenfalls EGMR und BVerfG stehen zwar sozusagen am Ende der strafverfahrensrechtlichen „Nahrungskette“. Sie befinden sich dabei aber außerhalb des eigentlichen Instanzenzuges. Zu ihnen gelangt der Strafverfahren nicht aufgrund eingelegter Rechtsmittel, sondern aufgrund außerordentlicher Rechtsbehelfe, der Individualbeschwerde und der Verfassungsbeschwerde. Der EuGH wiederum urteilt – anders als die beiden anderen Gerichte – gar nicht über strafgerichtliche Entscheidungen, sondern begleitet nationale Verfahren bei ihrer Entstehung durch eine Befassung mit der Sache seitens der nationalen Justiz. Insoweit ist er ein Verfahrenshelfer, nicht aber ein Verfahrensbeurteiler. Gemeinsam ist EuGH, EGMR und BVerfG allerdings, dass sie allesamt „Endentscheider“ sind, ihre Judikate ihrerseits keiner Kontrolle unterliegen, wobei dies bezüglich des BVerfG nur mit Einschränkung gilt, denn dessen Entscheidungen werden jedenfalls inzidenter im Verfahren vor dem EGMR einer Kontrolle unterzogen, da dieser Gerichtshof – teils sehr zum Missfallen der Karlsruher Richter – das BVerfG als Teil des nationalen Rechtsweges begreift. Doch dazu später mehr.
I. EuGH
Beginnen möchte ich, auch wenn der Vortragstitel es anders formuliert, mit dem EuGH, weil er von allen drei Gerichten für uns Strafrechtler bislang die geringste Rolle spielt. Kurz möchte ich Ihnen vorstellen, über welche Fragen der EuGH eigentlich befindet, was er zu entscheiden hat.
Gemäß Art. 258 und 259 AEUV ist der EuGH zuständig für Vertragsverletzungsklagen. Dabei prüft er, ob die Mitgliedstaaten ihren unionsrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen sind. Kläger ist entweder die Kommission oder ein Mitgliedstaat. Beklagter ist ebenfalls ein Mitgliedstaat, wobei das Prinzip der Organverantwortlichkeit gilt. Das Handeln einer nationalen Behörde oder eines nationalen Gerichts ist dem Mitgliedstaat zuzurechnen. Auf dem Gebiet des Strafrechts ist ein Vertragsverletzungsverfahren denkbar, wenn ein Mitgliedstaat es unterlassen hat, die unionsrechtlichen vorgeschriebenen Sanktionsgesetze zum Schutz der Rechtsgüter und Interessen der Union zu erlassen. Anlass für die Erhebung der Klage kann aber auch eine nicht im Einklang mit Unionsrecht stehende Auslegung oder Anwendung von innerstaatlichen strafrechtlichen Normen sein. Hierzu ein Beispiel: Wie Sie alle wissen, schützt der deutsche Betrugstatbestand grundsätzlich auch den Unwissenden oder harscher ausgedrückt: Auch den explizit „Dummen“ oder „Uneinsichtigen“. Sie alle kennen die juristischen Schulfälle, bei deren Lektüre man sich fragt, wie „um Gottes Willen kann man auf diesen Schwindel hereinfallen?“ Prägnantes und anschauliches Beispiel ist der Sachverhalt aus BGHSt 34, 199:
Der Angeklagte organisierte den Vertrieb für Verjüngungs- und Abmagerungsmittel sowie für „Haarverdicker“ und „Nichtraucherpillen“. Wie er wusste, waren sämtliche Produkte ebenso wirkungslos wie harmlos. Er verkaufte sie zu Preisen zwischen 46,50 DM bis 76 DM „ohne jedes Risiko“ per Nachnahme zuzüglich Versandspesen mit „Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen mit voller Geldzurückgarantie“. Auf Grund von Erfahrungen war er von einem Reklamationsanteil von höchstens 10 % aller Bestellungen ausgegangen. Tatsächlich wurde dieser Prozentsatz lediglich bei den „Schlank-Pillen“ fast erreicht und lag im Übrigen niedriger. Zur Erledigung der Reklamationen sowie für die von Januar bis Oktober 1984 aufgegebenen Werbeanzeigen für etwa 600.000 DM wurde ihm von seinen Hinterleuten stets ausreichend Geld zur Verfügung gestellt. Laut Anklage kam es zu 255 Bestellungen. Mit der Werbung wurden durch die gezielte Auswahl der Werbeträger vor allem Hausfrauen und Arbeitnehmer mit einem Haushaltseinkommen um 2.000 DM angesprochen. Den Produkten wurden, wie der Angeklagte wusste, Eigenschaften und Wirkungen zugeschrieben, die sie nicht hatten. Er glaubte zunächst selbst nicht daran, dass jemand darauf hereinfallen würde. So sollte das „Hollywood-Lifting-Bad“, angeblich aus „taufrischem Frischzellenextrakt“, im Blitztempo von nur zwölf Bädern wieder schlank, straff und jung formen, und zwar „mit 100 %iger Figurgarantie“. Verblüfft und zufrieden hätten Testpersonen festgestellt, „dass sie um herrliche zehn, fünfzehn oder mehr Jahre verjüngt“ und zur Figur eines Filmstars geliftet worden seien. Mit dem angeblich von einem Schweizer Schönheitschirurgen erfundenen Mittel „Frischzellen-Formel Zellaplus 100“ könne man schon nach der ersten Anwendung von nur zehn Minuten „mindestens fünf Jahre jünger“ werden, nach vollständiger Behandlung „so jung wie vor 25 Jahren“. Beim Einnehmen der „Schlank-Pille M-E-D 300“ müsse man sogar reichlich essen, „damit die ungeheure Fettabschmelzkraft mit genügend Nahrung ausgeglichen“ werde. Der „Haarverdicker- Doppelhaar“ verdopple das Haar binnen zehn Minuten, auch Schuppen, Flechten, fettiges oder zu trockenes Haar würde mit 100 %iger Garantie beseitigt. In dieser Art wurde für sämtliche Produkte geworben. Die Käufer solcher Waren werden nach deutschem Recht vor unredlichem Verhalten ihrer Geschäftspartner durch das Strafrecht grundsätzlich geschützt. Deshalb vermochte der BGH der Wertung des Landgerichts, das einen Irrtum der Besteller bezweifelte, nicht beizutreten.
Das europäische Recht hat jedoch eine völlig andere Vorstellung vom sich im Warenverkehr bewegenden Homo Oeconomicus. Dieser ist ein aufgeschlossener, orientierter und informierter Teilnehmer am Geschäftsverkehr, ein informierter Durchschnittsverbraucher. So formuliert es jedenfalls Art. 5 der RL 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken. Folge ist, dass klar zu durchschauende Unwahrheiten und Übertreibungen nicht die Qualität einer betrugsrelevanten Täuschungshandlung annehmen können. Europäisches Recht kollidiert insoweit mit deutschem Strafrecht, und es stellt sich die Frage, ob nicht jedenfalls dann, wenn ein Sachverhalt mit europäischem Bezug vorliegt, etwa wenn es um einen im europäischen Raum grenzübergreifenden Warenbetrug geht, auf den vom Europarecht vorgegebenen Täuschungshorizont des Verfügenden als einem informierten Verbraucher abgestellt werden muss.
Weiterhin befasst sich der EuGH gemäß Art. 263 und 264 AEUV mit Nichtigkeitsklagen. Mitgliedstaaten, der Rat der Europäischen Union, die Kommission und das Parlament können die Erklärung der Nichtigkeit von Rechtsakten der Gemeinschaft oder von Teilen von diesen beantragen. Dasselbe Recht steht natürlichen und juristischen Personen bezüglich solcher Rechtsakte zu, durch die sie unmittelbar und individuell betroffen sind. Da es ein europäisches Strafrecht nur rudimentär gibt – es existieren zwar Normen, die es der EU gestatten, zur Durchsetzung europäischer Zielrichtlinien die erforderlichen Regelungen zu treffen, wozu im Einzelfall auch Strafnormen gehören könnten; von diesen Normen ist in strafrechtlicher Hinsicht aber noch nicht Gebrauch gemacht worden -, besitzt diese Möglichkeit, den EuGH anzurufen, noch keine praktische strafrechtliche Bedeutung.
Gleiches gilt für die Untätigkeitsklage gemäß Art. 265 AEUV. Die Untätigkeitsklage ist ein Unterfall der Vertragsverletzungsklage aus Art. 258, 259 AEUV. Fassen Unionsorgane vertragswidrig keinen Beschluss, können andere Unionsorgane oder Mitgliedstaaten, zum Teil aber auch natürliche oder juristische Personen, den Gerichtshof anrufen, um die Unrechtmäßigkeit des Untätigbleibens feststellen zu lassen.
Mehr und mehr Bedeutung in der juristischen Praxis gewinnt demgegenüber ein anderer Rechtsbehelf, mit dem man sich an den EuGH wenden kann. Es ist dies das so genannte Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267 AEUV. Gemäß Art. 267 AEUV entscheidet der Gerichtshof auf Vorlage nationaler Gerichte im Wege der Vorabentscheidung über die Auslegung der Verträge, dem so genannten Primärrecht, oder die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union – Sekundärrecht. Gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV sind nationale Gerichte, deren Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, die also am Ende des nationalen Instanzenzuges stehen, zur Anrufung des EuGH sogar verpflichtet. In Kürze gesagt: Das Vorabentscheidungsverfahren dient dazu, die Vereinbarkeit nationaler Rechtsanwendung mit dem europäischen Recht sicherzustellen. Und insoweit kann auch das Strafrecht, mithin auch das deutsche Strafrecht, auf den Prüfstein in Luxemburg gelegt werden.
Zwei Beispiele, in denen nationales Strafrecht im Hinblick auf seine Konformität mit europäischen Rechtsvorgaben überprüft wurde, möchte ich nun kurz vorstellen.
Der erste Fall betrifft die Republik Italien (NJW 2018, 217). Das italienische Strafrecht kennt eine Vorschrift, nach der bei einer Unterbrechung der Verjährungsfrist diese nicht von neuem zu laufen beginnt, sondern sich ihre Dauer lediglich um ein Viertel ihrer Gesamtdauer verlängert. Diese Vorschrift hat der EuGH grundsätzlich für unvereinbar mit Art. 325 AEUV erachtet. Nach Abs. 1 dieses Artikels müssen die Mitgliedstaaten gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete Straftaten so abschreckend bekämpfen, dass hierdurch ein effektiver Schutz gewährleistet ist. Abs. 2 des § 325 Abs. 2 AEUV fordert zudem, dass die Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der Union nicht hinter den Maßnahmen zurückstehen dürfen, die der Mitgliedstaat zur Bekämpfung von Angriffen auf seine eigenen finanziellen Interessen bereithält. Insofern fordert der EuGH von den italienischen Gerichten grundsätzlich, die Verjährungsvorschriften, die aus seiner Sicht die Abschreckungswirkung der Straftatbestände einschränken, unberücksichtigt zu lassen. Eine Ausnahme hat er allein unter dem Gesichtspunkt der verbotenen Rückwirkung zugelassen. Insofern hätten die italienischen Gerichte zu klären, ob die Vorschriften über die Verjährung dem materiellen oder dem formellen Strafrecht angehören. Sollte ersteres der Fall sein, könnte ihre Nichtberücksichtigung gegen das auch im europäischen Recht verankerte Rückwirkungsverbot – Art. 49 GRC – verstoßen.
Das zweite Beispiel, das ich vorstellen möchte, ist brandaktuell und betrifft den Auslieferungsverkehr innerhalb der EU aufgrund des sog. Europäischen Haftbefehls (NJW 2018, 686). Das OLG Bremen hatte dem EuGH im Juli 2015 die Frage unterbreitet, ob die Auslieferung eines Verfolgten gestattet werden könne, wenn zwar im ersuchenden Staat grundsätzlich die Gefahr einer menschenunwürdigen Unterbringung in der Haft drohe, dieser Staat aber Zusicherungen, die auf eine menschenwürdige Behandlung abzielten, abgebe. Der EuGH verneinte diese Frage mit Blick auf Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der in seinem Wortlaut mit Art. 3 EMRK identisch ist und bestimmt, dass niemand der Folter oder der unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung unterworfen werden darf. Wie Art. 3 EMRK – so der EuGH – sei auch Art. 4 der Grundrechtecharta ein nicht einschränkbares, also ein absolutes Recht. Zwar fordere der Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl grundsätzlich von einem ersuchten Staat die Auslieferung eines Verfolgten. Da Art. 4 der Charta jedoch absolut wirke, könne er im Ergebnis einer Auslieferung entgegenstehen. Die Pflicht, auszuliefern und zum anderen die Pflicht, die Grundrechte zu wahren, müssten dergestalt in Einklang gebracht werden, dass der ersuchte Staat unter Fristsetzung vom ersuchenden Staat konkrete Zusicherungen über die Einhaltung der Individualrechte verlange. Bis zum Eingang der Antwort sei das Auslieferungsverfahren aufzuschieben. Könne die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung letztlich nicht ausgeschlossen werden, müsse die ersuchte Justiz darüber entscheiden, ob das Übergabeverfahren, also das Verfahren über die Auslieferung, zu beenden sei.
An diese Vorgaben des EuGH glaubte sich nun das OLG Hamburg in einem Auslieferungsfall nach Rumänien zu halten. Es war sich bewusst, dass dem Verfolgten dort maximal ein individueller Raum von 3 m² in der Haft zur Verfügung stehen würde. An einer Auslieferung sah es sich gleichwohl nicht gehindert. Der europäische Rechtsraum sei nicht zuletzt durch das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung und des gegenseitigen Vertrauens geprägt. Es sei allen Mitgliedstaaten zu unterstellen, dass sie die durch Art. 4 Grundrechtecharta und Art. 3 EMRK vorgegebenen Gewährleistungen einhalten würden. Zudem dürfe die zu gewährleistende Funktionsfähigkeit der europäischen Strafrechtspflege im Auslieferungsverkehr nicht aus dem Blick geraten. Der Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl sehe auf ein entsprechendes Dokument die Auslieferung des Verfolgten zwingend vor.
Gegen die Entscheidung des OLG erhob der Verfolgte die Verfassungsbeschwerde und diese hatte Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht hob den Beschluss des OLG wegen Verstoßes gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG auf. Der Strafsenat hätte – so die Karlsruher Richter – seinen Fall zur Vorabentscheidung dem EuGH vorlegen müssen. Inwieweit der Aspekt der Funktionsfähigkeit oder Funktionstüchtigkeit der europäischen Strafrechtspflege geeignet ist, die Menschenwürde beeinträchtigende Haftbedingungen zu kompensieren, habe der EuGH auf Vorlage des OLG Bremen oder eines anderen Gerichts noch nicht entschieden. Wegen Art. 267 Abs. 3 AEUV – das OLG ist in Auslieferungsentscheidungen das letztinstanzliche Gericht – war die Verpflichtung zur Vorlage an den EuGH auch zwingend. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stammt vom 19. Dezember 2017 und hat jedenfalls vorläufig wohl den Auslieferungsverkehr mit Rumänien zum Erliegen gebracht. Ähnliche Schicksale drohen den auslieferungsrechtlichen Beziehungen mit anderen osteuropäischen Staaten, Griechenland aber auch Italien, wo aufgrund von Überbelegungen menschenunwürdige Haftbedingungen vorherrschen können. Eins jedenfalls sollte deutlich geworden sein: Die Bedeutung des EuGH für den Bereich des deutschen Strafrechts darf nicht mehr unterschätzt werden.
II. Der EGMR
Das Schicksal, in seiner Bedeutung unterschätzt zu werden, teilt der EGMR in Straßburg mit dem Gerichtshof in Luxemburg sicherlich nicht. Die Gewährleistungen der EMRK in ihrer Auslegung durch den EGMR sind inzwischen fester Bestandteil unserer Strafrechtsordnung. In ihren Auswirkungen haben die Entscheidungen der Richter aus Straßburg zum Teil weitreichende Folgen gehabt. Man denke nur an das Urteil zum alten Recht der Sicherungsverwahrung, das zu einer Neufassung dieser Maßregel im Gesetz und zu weitreichenden Umgestaltungen der Vollzugsrealität geführt hat oder das Urteil zu § 329 StPO, der in seiner alten Fassung die Verwerfung der strafrechtlichen Berufung ermöglichte, wenn statt des geladenen Angeklagten nur ein zur Verhandlung bereiter Verteidiger erschienen war und dadurch das Recht aus der Konvention, sich durch einen Rechtsbeistand verteidigen zu lassen, verletzte. Es ist inzwischen in das kollektive Bewusstsein der Angehörigen der Strafjustiz in Deutschland eingesickert, dass die Gewährleistungen der EMRK den gleichen Stellenwert genießen wie die durch die Strafverfahrensordnung vorgegebenen Rechte und Pflichten. Zwar steht die Konvention nicht, wie in anderen Ländern, über dem einfachen Strafverfahrensrecht. Sie beansprucht allerdings denselben Rang und ist deshalb – was auch der BGH betont – mit ihren Gewährleistungen stets zu beachten. Die EMRK soll ein ordnungsgemäßes, rechtsstaatliches und vor allem faires Verfahren bewirken. Wir können den Aspekt des fairen Verfahrens natürlich auch aus unserer Verfassung, nämlich dem Rechtsstaatsprinzip in Art. 20 Abs. 3 GG, herleiten. Explizit angesprochen wird das faire Verfahren als allgemeinverbindlicher Verfahrensgrundsatz aber nur in der Konvention. Hier in der Konvention sind seine wahren Wurzeln und weil es letztlich der Deutung des Gerichtshofs unterliegt, was das faire Verfahren ausmacht und wodurch es verletzt wird, ist es die Verfahrensmaxime, über die der EGMR letztlich den meisten Einfluss auf das Strafverfahren der nationalen Rechtsordnungen nimmt. Als Verstoß gegen das faire Verfahren lässt sich so ziemlich alles rügen, was uns in seiner rechtlichen Konsequenz merkwürdig erscheint. Ob die Rüge dann auch tatsächlich Erfolg hat, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Ein schönes Beispiel in diesem Zusammenhang ist der Sachverhalt im Individualbeschwerdeverfahren 10152/13. (Zum Verständnis: Die Individualbeschwerde ist ein der Verfassungsbeschwerde ähnlicher Rechtsbehelf. Seine Struktur, wie auch die Struktur der VB, habe ich für Sie den Tagungsunterlagen beigefügt). Der Beschwerdeführer war durch das Amtsgericht wegen Betruges in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Nach Durchführung der Berufung wurde die Revision des Beschwerdeführers durch das OLG gemäß § 349 Abs. 2 StPO als offensichtlich unbegründet verworfen. Bevor die Generalstaatsanwaltschaft ihren diesbezüglichen Antrag angebracht hatte, hatte das OLG seine Auffassung von der Erfolglosigkeit des Rechtsmittels Staatsanwaltschaft und Beschwerdeführer mitgeteilt, womit es Letzteren wohl dazu bewegen wollte, die Revision zurückzunehmen. Der Beschwerdeführer lehnte daraufhin die Richter des Senats erfolglos wegen Besorgnis der Befangenheit ab. In der Zurückweisung seines Antrags sah er die Verletzung des fairen Verfahrens. Die Individualbeschwerde hatte keinen Erfolg. Zwar stellte der Gerichtshof fest, dass das Verhalten des Revisionsgerichts fragwürdig sein könnte, wenn es in der innerstaatlichen gerichtlichen Praxis unüblich oder gar gesetzlich verboten wäre, die Rechtsauffassung des Gerichts den Parteien zu übermitteln. Dies sei im deutschen Strafrecht aber gerade nicht der Fall. Auch die Art und Weise der Kundgabe der rechtlichen Auffassung stoße auf keine Bedenken. Seine Rechtsauffassung hatte das Gericht erst mitgeteilt, nachdem der Beschwerdeführer sein Rechtsmittel begründet habe. Mit der Offenlegung seiner Rechtsauffassung sei es dann in einen juristischen Diskurs mit den Verfahrensbeteiligten eingetreten. Der Staatsanwaltschaft habe es freigestanden, sich dieser Rechtsauffassung anzuschließen oder sie aber abzulehnen. Auf eine Parteilichkeit der Richter könne jedenfalls nicht geschlossen werden, weshalb auch das Verfahren als solches nicht unfair gewesen sei.
Erfolg hatte die Individualbeschwerde eines Beschwerdeführers demgegenüber im Urteil des EGMR vom 27. April 2017 in der Sache 73607/13. Beschwerdeführer war ein Strafverteidiger, dem von der Verlobten seines Mandanten ein Honorarbetrag überwiesen worden war. Die Staatsanwaltschaft vermutete eine inkriminierte Herkunft des Geldes und klärte über die Banken die finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers, einen Zeitraum von zwei Jahren umfassend, umgehend auf. Die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden in den Ermittlungsakten dokumentiert. Der EGMR sah hierin einen Verstoß gegen Art. 8 EMRK. Gemäß dieser Regelung hat jede Person ein Recht auf Achtung ihres Privatlebens. Den Eingriff in die Rechtssphäre des Beschwerdeführers erachtete der Gerichtshof als unverhältnismäßig. Der Anlass – vermutete kriminelle Herkunft des Verteidigerhonorars – habe einen derart massiven Eingriff, wie er letztlich vorgenommen wurde, nicht gerechtfertigt.
Interessant ist auch das Urteil des EGMR vom 12. November 2015 zur Reichweite der Unschuldsvermutung (NJW 2016, 3645). Der bereits vorbestrafte Beschwerdeführer hatte ein richterliches Geständnis über eine von ihm begangene Straftat abgelegt, weshalb eine laufende Bewährung widerrufen wurde. Jedoch hatte der Beschwerdeführer zuvor sein Geständnis widerrufen. Aus diesem Grund sah der EGMR im Gegensatz zu den deutschen Gerichten die Unschuldsvermutung als verletzt an. Ohne eine rechtskräftige Aburteilung könnten neue Straftaten den Widerruf einer Bewährung nur dann rechtfertigen, wenn ein glaubhaftes, überprüfbares und zum Zeitpunkt des Widerrufs noch existentes Geständnis abgelegt worden sei.
In den letzten Jahren ist eine Vielzahl strafprozessualer Normen des deutschen Strafrechts einer Überprüfung durch den EGMR unterzogen worden, so etwa auch die Vorschrift des § 251 StPO, die es unter anderem gestattet, die Vernehmung eines Zeugen durch die Verlesung einer Niederschrift über seine frühere Vernehmung zu ersetzen, wenn der Zeuge sich nachhaltig geweigert hat, in der Verhandlung aufzutreten. Der Gerichtshof sieht das faire Verfahren durch eine solche Vorgehensweise nicht als verletzt an. Allerdings fordert er für eine Verwertbarkeit der schriftlichen Aussage, dass diese durch andere Beweismittel auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden kann. Zudem darf die verschriftliche Aussage nicht das einzige Beweismittel sein, das zur Verurteilung beiträgt. Denn in diesem Zusammenhang ist stets zu berücksichtigen, dass die Schriftform der Aussage es dem Angeklagten unmöglich macht, sein Konfrontationsrecht nach der Konvention auszuüben und Nachfragen an den Belastungszeugen zu stellen (Urteil vom 17. April 2014 – 9154/10 -).
Das angesprochene Konfrontationsrecht des Angeklagten sah der Gerichtshof unter anderem in einem Urteil vom 19. Juli 2012 – 26171/07 – als verletzt an. Dem Beschwerdeführer war vorgeworfen worden, seine Schwester tätlich mit einem Beil angegriffen zu haben. Über den Vorfall sagten die Geschädigte und die Eltern des Beschwerdeführers vor einem Ermittlungsrichter aus. In der Hauptverhandlung verweigerten die Zeugen dann die Aussage. Verurteilt wurde der Beschwerdeführer aufgrund der Vernehmung des Ermittlungsrichters, der vom Inhalt der Zeugenaussagen berichtete. Allein die Vernehmung eines Zeugen vom Hörensagen, also eines mittelbaren Zeugen, sah der EGMR noch nicht als Verletzung des Rechtes auf ein faires Verfahren und eine Verletzung des Konfrontationsrechtes an. Zur Annahme einer Konventionswidrigkeit kam er jedoch aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls. Die Staatsanwaltschaft hatte es im Ermittlungsverfahren versäumt, vor der Vernehmung durch den Ermittlungsrichter dem Beschwerdeführer einen Verteidiger beizuordnen. Dadurch hatte dieser während des gesamten Verfahrens nicht die Möglichkeit, ihn belastende Zeugen konfrontativ zu befragen. In seiner Gesamtheit betrachtete der Gerichtshof der Strafverfahren daher als unfair.
Eins sollte damit hinreichend deutlich geworden sein: Über den Grundsatz des fairen Verfahrens hat der EGMR einen weitreichenden Einfluss auf die nationalen Strafrechtsordnungen, auch wenn – was häufig betont wird, wenn das nationale Recht in Konflikt mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs gerät – die Entscheidungen verbindliche Geltung nur zwischen den Parteien des in Straßburg geführten Verfahrens besitzen. Doch bei dieser Argumentation handelt es sich im Endeffekt, um mit Shakespeare zu sprechen, um „viel Lärm um nichts“. Denn die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat der EMRK muss natürlich darauf achten, nicht konventionswidrig zu handeln und muss daher auch Entscheidungen zur Kenntnis nehmen, beachten und gegebenenfalls sogar legislatorisch umsetzen, an denen sie als Partei gar nicht beteiligt war.
Insoweit mag auch die folgende Entscheidung von Interesse sein, die die Frage der Wahrung öffentlich-rechtlicher Geheimhaltungspflichten anschneidet. Beteiligt an dem Verfahren 2156/10, welches durch Urteil des EGMR vom 25. Juli 2017 endete, waren die Niederlande. Beschwerdeführer war ein Geheimdienstmitarbeiter, gegen den Anklage wegen Landesverrats erhoben worden war. Zu seiner Verteidigung wollte er seiner Geheimhaltungspflicht unterfallende Tatsachen, die in den Strafakten nicht erwähnt waren, mit seinem Verteidiger erörtern. Dies wurde ihm unter Hinweis auf eine dann zwingend in Aussicht stehende, weitere Anklage wegen Landesverrats untersagt. Der EGMR fand für das Vorgehen der niederländischen Behörden deutliche Worte. Zwar seien staatliche Mitarbeiter grundsätzlich beruflichen Geheimhaltungspflichten unterworfen. Diese Geheimhaltungspflichten dürften jedoch kein Hemmschuh für die Durchführung einer effektiven Verteidigung in einem Strafverfahren sein. Der EGMR sah das niederländische Verfahren deshalb als unfair an.
Die Bedeutung, die der Gerichtshof dem Grundsatz des fairen Verfahrens beimisst, zeigt sich auch an einer die Ukraine betreffenden Entscheidung vom 25. Juli 2017 – 2945/16 -. Diese Entscheidung verdeutlicht, dass ein Verfahren auch dann unfair sein kann, wenn die zur Beurteilung durch den Gerichtshof anstehende Verfahrenskonstellation nicht auf einem Verschulden staatlicher Behörden beruht. In dem Fall, über den der EGMR zu befinden hatte, konnte eine Berufung gegen eine strafrechtliche Verurteilung nicht durchgeführt werden, weil sich die Verfahrensakten in einem von der Regierung nicht mehr kontrollierten Gebiet, nämlich einem von der Ukraine abtrünnigen Gebiet in der Ost-Ukraine befanden. Der Gerichtshof gestand den ukrainischen Behörden zu, nicht absichtlich das Strafverfahren vereitelt zu haben. Allerdings vermisste er Anstrengungen, das Berufungsverfahren zu ermöglichen. So monierte er, dass eine angemessene Prüfung der Möglichkeit einer Rekonstruktion der in Verlust geratenen Verfahrensakten nicht in Betracht gezogen worden war.
III. Das BVerfG
Kommen wir nun zu unserem letzten Protagonisten, dem BVerfG. Warum habe ich dieses an das Ende der Betrachtung gestellt? Ganz einfach aus dem Grund, weil es für uns in der alltäglichen strafjuristischen Arbeit trotz einer Europäisierung unseres Rechtskreises immer noch die größte Bedeutung besitzt. Sein Prüfungsfeld beschränkt sich nicht auf ausgewählte Aspekte des strafrechtlichen Bereichs, wie die Harmonisierung nationaler Normen mit europäischem Recht oder Verfahrensprinzipien. Das BVerfG überprüft den gesamten Bereich des Strafrechts, sowohl das formelle als auch das materielle Recht. Zwei Ihnen natürlich bekannte Entscheidungen möchte ich hierfür als Beispiel nennen. Da ist zum einen die Senatsentscheidung vom 23. Juni 2010 – 2 BvR 2559/08 u. a. – zum Untreuetatbestand. Mit dieser Entscheidung hat das BVerfG einen jahrzehntelang andauernden Streit über die Bestimmtheit der Strafvorschrift des § 266 StGB beendet, indem es festgestellt hat, dass die Norm grundsätzlich mit Art. 103 Abs. 2 GG zu vereinbaren ist. Dabei hat der Senat durchaus eingeräumt, dass der Wortlaut des Untreuetatbestandes – mit Verlaub gesagt – doch recht unscharf formuliert ist, wenn man sich allein die Tatbestandsmerkmale der Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht und des Vermögensnachteils vor Augen führt. An der grundsätzlichen Verfassungsgemäßheit ließ das Gericht jedoch keine Zweifel aufkommen und rekurrierte diesbezüglich auf die vorhandene, die Tatbestandsmerkmale präzisierende Rechtsprechung der Strafgerichte. Dieses Argument ist ein interessantes und – wie ich finde – durchaus anzweifelbares. Der Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 Abs. 2 GG verpflichtet den Gesetzgeber, Strafvorschriften so präzise zu formulieren, dass deren Adressat, der Bürger, erkennen kann, welches Verhalten unter Strafe gestellt ist. In Bezug genommen ist damit der Gesetzeswortlaut, nicht aber dessen juristische Interpretation, die ohnehin allein uns Fachleuten, nicht aber dem Laien bekannt ist. Darüber hinaus darf die Verfassungsgemäßheit einer Norm nicht davon abhängen, dass zu ihr bereits eine gerichtliche Auslegung vorliegt. Dann würde über die Verfassungsgemäßheit nämlich allein der Zeitablauf entscheiden. Verfassungswidrig wäre die Norm, solange sich noch keine gerichtliche Auslegungspraxis entwickelt hat. Verfassungsgemäß wäre sie, wenn eine solche Praxis sich etabliert hätte. Und auf die bloße Interpretationsfähigkeit einer Norm abzustellen, also die Möglichkeit einer Deutung durch die Gerichte, kann auch kein Argument für die Verfassungsgemäßheit einer Strafvorschrift sein, denn dann würde das Bestimmtheitsgebot im Ergebnis leerlaufen, denn die Strafgerichte sind stets dazu aufgerufen, geltendes Recht anzuwenden und dieses, sofern es Unklarheiten aufweist, zu interpretieren. Das Vorgehen des BVerfG im Fall des § 266 StGB zeigt jedoch exemplarisch den Umgang des Gerichts mit Vorschriften des materiellen, aber – worauf ich in meinem zweiten Fallbeispiel noch eingehen werde – auch des formellen Strafrechts. Das Gericht tut sich grundsätzlich schwer, über einer Strafvorschrift den Stab der Verfassungswidrigkeit zu brechen und dies umso mehr, wenn die Vorschrift aufgrund der Dauer ihres Bestandes bereits eine gewisse „Rechtstradition“ entwickelt hat. Ein eher unrühmliches Beispiel für diese These ist meines Erachtens auch die Entscheidung zum Inzest in § 173 StGB (NJW 2008, 1137). Hier hatte das BVerfG die Chance, seine in einigen früheren Entscheidungen zum Ausdruck gekommene These faktisch zu untermauern, dass Recht, also auch Strafrecht, sich überleben und damit verfassungswidrig werden kann. Leider hat es diese Chance verstreichen lassen und an dem Dinosaurier des § 173 StGB festgehalten. Lesens- und bemerkenswert im Zusammenhang mit dieser Entscheidung ist meines Erachtens allein das Sondervotum des Richters Hassemer zur Verfassungswidrigkeit der Norm.
Nur was ist es eigentlich, was das BVerfG häufig zögern lässt, die Verfassungswidrigkeit einer Strafvorschrift auszusprechen? Ist es eine berechtigte Zurückhaltung, die dem Wunsch entspringt, sich nicht an die Stelle des Gesetzgebers zu setzen? Ein solches Argument lässt sich natürlich erst mal trefflich hören. Bloß in anderen Rechtsbereichen, denken wir etwa aktuell an das Steuerrecht, hat das Gericht weniger derartige Skrupel. Es mag letztlich etwas damit zu tun haben, das Strafrecht eine besondere Materie ist, die besondere Aufmerksamkeit genießt und besondere Emotionen hervorruft. Seit Jahren schon ist zu beobachten, dass der Gesetzgeber meint, auf bestimmte gesellschaftliche und soziale Phänomene – auch – mit dem Strafrecht reagieren zu müssen und sich damit zum Teil erheblich von der Idee des Strafrechts als Ultima Ratio entfernt. Stichwort: „Symbolisches Strafrecht“. Denken wir nur an die Änderung des § 46 StGB. Beweggründe und Ziele des Täters sind – so die Norm – bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Dies war seit jeher so. Nun hat der Gesetzgeber ausgeführt, dass dies besonders auch für rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Motive gilt – eine pure, schon immer in der Praxis geübte Rechtswirklichkeit, womit sich die gesetzliche Neufassung lediglich als deklaratorisch erweist. Ein weiteres Beispiel ist die Vorschrift des § 114 StGB, der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Auch das dort beschriebene Unrecht war schon vorher strafbar und konnte nicht zuletzt bei Erheblichkeit über eine Vorschrift wie § 224 StGB erfasst werden. Gleichwohl hat sich der Gesetzgeber bemüßigt gesehen, hier einen Sondertatbestand zu schaffen. Die Diskussionen um solche Tatbestände werden häufig aufgeregt und emotionsgeladen geführt, und man kann sich vorstellen, dass solche Debatten in der Öffentlichkeit möglicherweise auch die Richter des BVerfG nicht gänzlich unbeeindruckt lassen.
Aber ich will das Gericht nicht nur schelten. Wenn wir zur Entscheidung über die Untreue zurückkehren, können wir durchaus auch positive Ansätze entdecken, wie etwa die Kreation des „Verschleifungsverbots“. Völlig zu Recht hat das BVerfG ausgeführt, dass die Frage des Vermögensnachteils nicht gleichzusetzen ist mit der Frage der Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht. Pflichtverletzung und Vermögensnachteil sind zwei unterschiedliche, voneinander getrennt zu sehende Tatbestandsmerkmale, die nicht in einen Topf geworfen werden dürfen. Zudem darf von einem Nachteil im Sinne des § 266 StGB auch nur dann ausgegangen werden, wenn sich dieser in Zahlen ausdrücken lässt, weil nur dann eine Aussage über einen Vermögensverlust getroffen werden kann. Diese Ausdeutung des Tatbestandes durch das BVerfG trägt fraglos zu dessen Systematisierung bei, wobei hierzu vorrangig die Strafgerichte berufen gewesen wären. Befasst sich das BVerfG mit einzelnen Tatbestandsmerkmalen einer Strafvorschrift hat man doch eher den Eindruck von einer „Superrevisionsinstanz“, die das Gericht nicht sein will. Aber vielleicht geht es nicht ohne eine solche Revisionsinstanz. Die Autorität des Verfassungsgerichts und seine Stellung in unserem Rechtssystem ermöglichen es ihm jedenfalls, bedeutsame juristische Streitfragen abschließend und allgemeinverbindlich zu entscheiden.
Nun zum zweiten Beispiel: Es ist dies die Entscheidung des Zweiten Senats zur Sachentscheidungsbefugnis des Revisionsgerichts auf Grundlage des § 354 Abs. 1 Buchst. a StPO vom 14. Juni 2007 – 2 BvR 1447/05 u. a. -. Der Gesetzgeber hatte mit dem Justizmodernisierungsgesetz aus dem Jahre 2004 die Entscheidungskompetenzen der Revisionsgerichte erweitert. Diese können nach der neuen Vorschrift des § 354 Abs. 1 Buchst. a StPO bei einem Fehler im Rechtsfolgenbereich von der Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung absehen, wenn die durch das Tatgericht verhängte Strafe trotz des Rechtsfehlers angemessen erscheint. Hinter dieser recht harmlosen Formulierung steckt etwas Revolutionäres, nämlich die Zubilligung eigener Strafzumessungstätigkeit des Revisionsgerichts. Damit stellt sich die Vorschrift als Fremdkörper im Revisionsrecht dar. Strafzumessung erfolgt nach Durchführung einer Beweisaufnahme über die Strafzumessungstatsachen. Eine Beweisaufnahme führt das Revisionsgericht aber gar nicht durch. Aufhänger für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu § 354 Abs. 1 Buchst. a StPO war ein möglicher Verstoß gegen das – auch – in Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Recht auf ein faires Verfahren. Das BVerfG hielt es nicht für akzeptabel, dass dem Revisionsgericht bei Anwendung des § 354 Abs. 1 Buchst. a StPO ein möglicherweise nicht mehr aktueller und lediglich vom Tatgericht festgestellter Strafzumessungssachverhalt zur Verfügung steht. Allerdings zog es hieraus nicht die Konsequenz der Verfassungswidrigkeit der Norm, sondern implantierte in das Revisionsverfahren ein so vom Gesetz nicht vorgesehenes Verfahren über die Anhörung der Verfahrensbeteiligten zum Strafzumessungssachverhalt. Diesen wird Gelegenheit gegeben, sich zur Aktualität und Vollständigkeit der Strafzumessungstatsachen zu äußern. Das BVerfG hat mit eigenen Worten damit den Weg der verfassungskonformen Auslegung gewählt, wobei, da, wie gesagt, das Anhörungsverfahren im Gesetz gar nicht vorgesehen ist, weniger eine Auslegung als eine richterliche Rechtsfortbildung vorliegt. Konsequenter – und das ist keine Frage – wäre es gewesen, die Vorschrift für verfassungswidrig zu erklären. Dass dies nicht geschehen ist, zeigt nur wieder, dass das Gericht im Bereich des Strafrechts geneigt ist, den mit der Einführung einer Strafnorm verbundenen gesetzgeberischen Willen nicht zu korrigieren. Es wäre sehr wünschenswert, wenn es bei Fehlgriffen des Gesetzgebers, die aufgrund seiner Aktivität auf dem Bereich des Strafrechts vermutlich zukünftig nicht weniger werden, diese Zurückhaltung aufgeben würde. Vielleicht könnte dazu beitragen, den Anteil von Strafrechtlern unter den Richterinnen und Richtern zu steigern.
Eines ist dessen ungeachtet klar: Jede nur einigermaßen bedeutsame Novellierung unseres Strafrechts wird früher oder später auf dem Tisch des BVerfG zur Prüfung liegen. Seien wir mit diesem im Endeffekt also nicht allzu ungnädig.
[1] Vortrag, gehalten am 20.01.2018 auf WisteV-wistra-Neujahstagung. Der Vortragsstil wurde beibehalten.