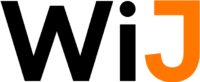Junges Wirtschaftsstrafrecht 2.0 – Neue Perspektiven auf Theorie und Praxis
Tagungsbericht zur Gemeinschaftsveranstaltung Junges Strafrecht e.V. und Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V. (WisteV) an der Goethe-Universität am 11.10.2019 in Frankfurt a.M.
Am 11.10.2019 fand zum zweiten Mal die Tagung Junges Wirtschaftsstrafrecht 2.0 – Neue Perspektiven auf Theorie und Praxis an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. statt. Die Gemeinschaftsveranstaltung der Junges Strafrecht e.V. und der WisteV bot aufstrebenden Talenten aus Theorie und Praxis mit dieser zweiten Auflage ein weiteres Mal die Möglichkeit, neue Ideen und kreative Ansätze auf dem Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts zu präsentieren.
I. Panel I: Internal Investigations
Nach der Begrüßung durch Wiss. Mit. Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy und Rechtsanwalt Dr. Alexander Paradissis übernahm Rechtsanwalt Dr. David Pasewaldt, LL.M. die Moderation des ersten Panels zu Internal Investigations, das der Autor mit einem Vortrag zur Zeugenbeistandschaft und „investigation Defence“ eröffnen durfte.
Im ersten Teil seines Vortrags betonte er die Wichtigkeit des Zeugenbeistandes unter Verweis auf die Entscheidungen des BVerfG vom 08.10.1974 (BVerfGE 38, 105) und 10.03.2010 (StraFo 2010, 243), wonach zum einen die Lage eines Zeugen sehr viel eher der eines Beschuldigten entspreche und die mit seiner Aussage verbundene Problematik prinzipiell keine andere sei als die bei der Einlassung des Beschuldigten. Zum anderen bedürfe nicht die Zuziehung eines Beistandes einer Rechtfertigung, sondern dessen Ausschluss. Hinsichtlich der Aufgaben des Zeugenbeistandes betonte er den besonderen Wert der Vorbereitung des Zeugen auf die Vernehmungssituation bzw. das Interview. Er machte deutlich, dass es trotz der Gefahr der Strafverfolgung eine erzwingbare arbeitsrechtliche Pflicht zur Teilnahme an Befragungen gebe, soweit der unmittelbare Arbeitsbereich betroffen sei oder es um Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Arbeitsleistung gehe. Bei Wahrnehmungen außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs bestehe eine Auskunftspflicht aus der arbeitsvertraglichen Treuepflicht hingegen nur, wenn die Interessen des Arbeitgebers im Einzelfall überwiegen. Einen Rechtsanspruch auf Hinzuziehung eines Rechtsanwalts habe der Interviewte zurzeit noch nicht, obwohl die BRAK-Thesen zum Unternehmensanwalt im Strafrecht das Recht des Interviewten auf Hinzuziehung eines Rechtsanwalts als Standard einer Internal Investigation zählen und ein entsprechender Anspruch teilweise bereits aktuell aus Gesichtspunkten der Waffengleichheit und Fürsorgepflicht hergeleitet wird. Darüber hinaus existiere aktuell entgegen der BRAK-Thesen auch keine gesetzliche Pflicht zur Belehrung des Interviewten, selbst wenn sie nach Maßgabe des rechtsstaatlichen Gedankens der Fairness geboten sein könne. Ein Rechtsanwalt sei nicht gehindert, mehrere Zeugen zu vertreten, weil die Zeugenbeistandschaft keine Verteidigung sei und § 146 StPO demnach keine Anwendung finde. Mit Blick auf die berufsrechtlichen Vorgaben könnten aber vor allem mögliche Interessenskonflikte und widerstreitende Interessen einer Mehrfachvertretung entgegenstehen. Die Kostenübernahme könne als Aufwendungsersatzanspruch oder Anspruch aus Fürsorgegesichtspunkten durch den Arbeitgeber erfolgen.
Im zweiten Teil seines Vortrages berichtete der Autor über mögliche Änderungen durch den Entwurf des VerSanG. So soll künftig auf eine mögliche Verwendung der Aussage in einem Strafverfahren hinzuweisen sein und ein gesetzlicher Anspruch auf einen Zeugenbeistand sowie eine diesbezügliche Belehrungspflicht eingeführt werden. Schließlich soll Interviewten ein Auskunftsverweigerungsrecht eingeräumt werden, sofern die Beantwortung der Frage die Gefahr der Verfolgung des Interviewten oder naher Verwandten wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit zur Folge haben könnte.
Im dritten und letzten Teil gab der Autor Hinweise zum Recht des Zeugenbeistandes zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung und zum Auskunftsverweigerungsrecht des Zeugen in Bezug auf Fragen zum Beratungsgespräch mit seinem Zeugenbeistand. So habe das AG Neuss (StraFo 1999, 139) entschieden, dass die umfassende Beratung eines Zeugen die Anwesenheit des beratenden Anwalts in der Hauptverhandlung auch außerhalb der beistandsbewehrten Zeugenvernehmung voraussetze. Nach einem Urteil des OVG Berlin (StraFo 2001, 375) könne darüber hinaus ohne Weiteres von einem Missbrauch des Anwesenheitsrechts eines anwaltlichen Zeugenbeistands nicht ausgegangen werden. Auch stünde dem Anwesenheitsrecht die Entscheidung des BVerfG (BVerfGE 38, 105) nicht entgegen, weil die Entscheidung keine öffentliche Hauptverhandlung und damit keine potentielle Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes zum Gegenstand hatte. Dass dem Zeugen ein Auskunftsverweigerungsrecht auf Fragen zustehe, die den Inhalt der mit seinem Anwalt geführten Beratungsgespräche betreffen, habe das OLG Düsseldorf (NStZ 1991, 504) entschieden. Das OLG Düsseldorf habe insoweit ausgeführt, dass man den Zeugen gerade der Gefahr aussetzen würde, vor der ihn das Gesetz schützen will, wenn man ihn zwingen wollte, den Inhalt der Beratungsgespräche mit seinem Beistand den übrigen Verfahrensbeteiligten zu offenbaren. Das Recht des Zeugen, sich in einer Konfliktlage für die Verweigerung von Angaben zu entscheiden, würde durch die Verneinung eines entsprechenden Auskunftsverweigerungsrechts gerade durch die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe in der Hauptverhandlung in sein Gegenteil verkehrt.
Die anschließende Diskussion drehte sich um die Schaffung eines möglichen Spannungsverhältnisses durch das VerSanG-E in der Weise, dass einerseits eine vollumfängliche interne Aufklärung und Kooperation mit der Staatsanwaltschaft gefordert würde und andererseits Auskunftsverweigerungsrechte geschaffen werden sollen. Von Seiten der Diskutanten wurde unter anderem vorgeschlagen, ein ernstes Bemühen des Unternehmens zur Aufklärung ausreichen zu lassen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass sich Belehrungspflichten bereits aktuell aus Datenschutzgründen ergeben könnten und es zivilprozessuale Möglichkeiten wie Ordnungsgeld oder Ordnungshaft in Bezug auf die Aussagepflicht des Arbeitnehmers gebe. Praktische Probleme bei der Aussagepflicht würden aber erst dadurch geschaffen, dass der Arbeitnehmer befürchten müsse, dass die Ergebnisse des Interviews oder das Protokoll selber an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben würden.
Im Anschluss referierten die Rechtsanwälte Felicitas Sussmann und Alexander Kaphahn zum Thema „Legal Privilege“? – Schweigerecht, Zeugnisverweigerung, Durchsuchungs- u. Beschlagnahmeverbote bei Internal Investigations. Sie begannen mit der Feststellung, dass ein Schutz für die vertrauliche Arbeit zwischen Anwalt und Mandanten geschaffen werden müsse und schilderten sodann das Legal Privilege in den USA und England. Im Anglo-Amerikanischen werde der Mandatenbegriff von den Gerichten weit ausgelegt. Im Rahmen des Legal Privilege sei die Kommunikation zwischen Anwalt und Mandanten unter dem Siegel der Vertraulichkeit („made in confidence“) zum Zwecke der Einholung und Bereitstellung von Rechtsrat („purpose of rendering legal advice“) geschützt. Nicht geschützt sei hingegen die Kommunikation des Anwalts mit Dritten, sowie eigene Arbeitsprodukte des Anwalts. Die Schutzweite und damit die Frage, ob ein Verwertungsverbot bestehe, hänge davon ab, ob Wertungen des Anwalts in das Papier eingeflossen seien. Die US-amerikanische Work Product Doctrine gewähre darüber hinaus keinen absoluten, sondern lediglich einen qualifizierten Schutz für Materialien, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines Gerichtsverfahrens durch eine Partei selbst oder deren Vertreter erstellt worden seien. Hier seien konkrete Anhaltspunkte für ein bevorstehendes Gerichtsverfahren erforderlich.
Im Vereinigten Königreich bestehe das Legal Privilege zum einen in einem Legal Advice Privilege. Dieses schütze die vertrauliche Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant, soweit sie dazu diene, Rechtsrat zu erteilen oder zu erhalten. Darüber hinaus seien die Lawyers Privileged Working Papers erfasst, die zwar nicht Gegenstand der Mandantenkorrespondenz seien, aber die Beratung vorbereiten würden und zwar auch dann, wenn diese nicht von dem Anwalt an den Mandanten übermittelt worden seien. Zum anderen schütze das Litigation Privilege die Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant oder Anwalt/Mandant mit einer dritten Partei, die dem überwiegenden Zweck diene, Rechtsrat zu erhalten oder zu erteilen oder Beweise oder Informationen in Bezug auf einen Rechtsstreit zu sammeln. Es müsse vernünftigerweise mit einem Rechtsstreit zu rechnen sein und die Kommunikation müsse gerade der Vorbereitung und nicht der Vermeidung eines solchen dienen. Im Vereinigten Königreich werde auch der Mandantenbegriff enger ausgelegt. So sei in einem Fall beispielsweise die Herausgabe bejaht worden, weil es sich bei den betroffenen Mitarbeitern nicht um Mandanten gehandelt habe. Die Reichweite eines Verzichts auf den Vertrauensschutz über einen sog. Waiver beruhe auf einer Wertentscheidung im jeweiligen Einzelfall.
Sodann stellten Sussmann/Kaphahn die Schutzinstrumente nach deutschem Recht dar. So diene das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 StPO dem Schutz des Vertrauensverhältnisses bzw. des Mandatsverhältnisses. Das Beschlagnahmeverbot nach § 97 StPO solle eine Umgehung des Zeugnisverweigerungsrechts verhindern und knüpfe an den Gewahrsam an. Aus der aktuellen Jones-Day Entscheidung ergebe sich, dass die Regelung in § 97 StPO abschließend sei. Die Maßnahmen bei Zeugnisverweigerungsberechtigten nach § 160a StPO verböten Ermittlungsmaßnahmen gegen Rechtsanwälte, soweit diese Erkenntnisse erbringen würden, über die der Rechtsanwalt das Zeugnis verweigern dürfte. § 148 StPO schütze darüber hinaus die Verteidigerkommunikation unabhängig von dem Gewahrsam. Daran anschließend gingen Sussmann/Kaphahn darauf ein, dass diese Schutzinstrumente nur fragmentarischen Schutz böten. Insbesondere sei im Rahmen des § 148 StPO problematisch, wann eine beschuldigtenähnliche Stellung vorliege. Eine beschuldigtenähnliche Stellung sei mit dem BVerfG zu bejahen, wenn eine künftige Nebenbeteiligung nach objektiven Gesichtspunkten in Betracht komme. Sodann schilderten sie Probleme, die auftreten könnten, wenn das Unternehmen in eine Konzernstruktur eingebunden sei. So könne die Staatsanwaltschaft durch Verfahrenstrennung und -verbindung Einfluss auf die beschuldigtenähnliche Stellung innerhalb desselben Verfahrens nehmen. Abschließend stellten sie mögliche Änderungen und Folgen durch das VerSanG dar und gingen im Rahmen dessen insbesondere auf den zeitlichen Schutzbereich sowie die Zuordnung typischer Dokumentenarten in der internen Untersuchung zu dem Schutzniveau nach §§ 148, 97 StPO ein.
Die anschließende Diskussion drehte sich maßgeblich um die Beschlagnahmefreiheit von Papieren, die sich bei einer beratenden Kanzlei befinden.
In dem letzten Vortrag des ersten Panels stellte Staatsanwalt beim BMJV Dr. Adrian Jung das Thema „Disclosure“ als komplexe Strategie – Zur Bedeutung von Internal Investigations für die Individualverteidigung („Compliance Defense“) und Unternehmensverteidigung (Sanktionsminderungsgrund) vor und berichtete im Zuge dessen ausführlich über den VerSanG–E. Ziel des VerSanG sei nicht die strafrechtliche Aufarbeitung des Sachverhalts. Es gehe auch nicht um die Frage, ob sich Unternehmen mit Internal Investigations befassen müssten, sondern nur um die Frage, wie Internal Investigations als Fremdkörper im Strafprozessrecht geregelt würden. Momentan sei die Rechtslage jedenfalls unbefriedigend. So sei bereits unklar, ob Internal Investigations überhaupt im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt werden könnten. Für die Strafverfolgungsbehörden seien Ermittlungen in Unternehmen sehr aufwändig.
Mit dem neuen VerSanG soll ein Anreizmodell und kein Disclosure nach US-Vorbild in dem Sinne geschaffen werden, dass die Ermittlungslast auf Private übertragen werde. In Deutschland sollte die Durchführung von Internal Investigations freiwillig sein. Jung erläuterte sodann, dass sich der Sanktionsrahmen um die Hälfte reduzieren könne, wenn die neu geschaffenen Vorgaben eingehalten würden und mehr Einstellungen möglich würden. Es werde auch eine Geldauflage auf Bewährung geschaffen. Diese wird umso einfacher zu erreichen sein, je geringer der Strafrahmen sei. Als Nebenfolge sei die Veröffentlichung der Entscheidungen vorgesehen. Ferner werde ein sogenanntes Sanktionsbescheidverfahren installiert, das mit dem Strafbefehlsverfahren vergleichbar sei. Dieses Verfahren würde dann auch für die Vermögensabschöpfung gelten, die entgegen des aktuellen § 30 OWiG von der Sanktion getrennt werde. Der VerSanG-E sehe ferner vertypte Sanktionsminderungsgründe vor, die nur greifen würden, wenn die Internal Investigations nach Maßgabe der dann geltenden Regeln durchgeführt würden.
Ein weiterer Punkt sei, dass Unternehmensvertreter nicht mehr gleichzeitig auch Unternehmensverteidiger sein könnten. Zwar seien Internal Investigations nicht per se Verteidigung; sie könnten aber Verteidigung werden. Durch eine allgemeine Zusammenarbeits- und Offenlegungspflicht sollen Spannungsfelder aus Offenlegungspflichten vermieden werden. Ein Beweisverwertungsverbot soll es in diesem Zusammenhang nicht geben, weil nicht zu erwarten sei, dass Arbeitnehmer nur dann Straftaten offenlegen würden. Von großem Interesse für die Strafverfolgungsbehörden sei die Offenlegung der Ergebnisse der Internal Investigation. Die Staatsanwaltschaft müsse aber, und zwar auch dann, wenn von dem Unternehmen ein „Sündenbock“ präsentiert werde, sicherstellen, dass alles ordnungsgemäß abgelaufen sei. Dafür müsse die Staatsanwaltschaft dann aber auch Zugriffsmöglichkeiten haben, um gegebenenfalls auch entlastendes Material sicherzustellen. Hierfür soll die Staatsanwaltschaft die Herrin des Ermittlungsverfahrens bleiben und trotzdem auf die Unternehmen und Berater Rücksicht nehmen. Während der Durchführung der Internal Investigation werde die Staatsanwaltschaft von strafprozessualen Maßnahmen absehen und das Verfahren für diese Dauer einstellen. Die Verjährung werde dann ruhen. Sodann führte Jung aus, dass es kein Legal Privilege geben werde. Durch § 18 VerSanG-E werde die Beschlagnahme möglich sein. Allerdings werde durch die Ausweitung der Beschuldigteneigenschaft § 148 StPO viel schneller greifen, jedoch nicht per se für verbandsinterne Untersuchungen. Jung schloss seinen Vortrag mit der Feststellung, dass die Ermittlungen auch nach vom VerSanG-E weiterhin von der Staatsanwaltschaft geführt werden. Die Verteidigung werde aber an vielen Stellen Einfluss nehmen können.
In der anschließenden Diskussion stellte Jung klar, dass § 97 StPO nur für Verteidiger und Beschuldigte gelten werde. Dies werde vom Gesetzgeber sprachlich klargestellt. Aus dem Plenum wurde angemerkt, dass ein Verteidiger für eine gute Verteidigung auch heute schon den Sachverhalt im eigenen Interesse aufklären müsse. Jung entgegnete, dass insoweit keine vertypten Strafmilderungsgründe geschaffen werden sollen und stellte klar, dass durch den Gesetzesentwurf eigene interne Untersuchungen nicht vermieden werden sollen. Sie würden eben nur nicht obligatorisch zur Strafmilderung führen. Danach gefragt erklärte Jung zum Abschluss, dass es zwar keine Sentencing Guidelines geben werde. Möglicherweise werde es aber Änderungen in der RiStBV geben.
In dem letzten Vortrag des ersten Panels stellte Prof. Dr. Suzan Denise Hüttemann Problemlagen und Verteidigungsmöglichkeiten von Unternehmen als Betroffene grenzüberschreitender Vermögensabschöpfung dar. Im Rahmen der Definition der Rechtsnatur der Vermögensabschöpfung in den unterschiedlichen Rechtssystemen führte sie aus, dass in den zivil- und verwaltungsrechtlichen Bereichen häufig erleichterte materielle Voraussetzungen gelten, es Beweiserleichterungen gebe und man damit konfrontiert sei, dass nicht strafrechtliche Gerichte oder Behörden zuständig seien. Sodann gab sie einen Überblick über die grenzüberschreitende Vermögensabschöpfung, die zum einen in der Herausgabe (sonstige Rechtshilfe) und zum anderen in der Vollstreckungshilfe bestehen könne, jeweils verbunden mit vorläufigen Sicherungsmaßnahmen. Im internationalen Vergleich sei die Herausgabe von Vermögensgegenständen unüblich. Die Gründe für das deutsche System seien historisch bedingt. Jedenfalls stünden Unternehmen nicht im Zentrum der bisherigen Regelungen. Vielmehr seien die Regelungen auf natürliche Person zugeschnitten. Zum Verhältnis von Herausgabe und Vollstreckungshilfe gelte, dass die Vollstreckungshilfe ab Rechtskraft einer Einziehungsentscheidung Vorrang genieße. Sodann stellte Hüttemann die Rechtsgrundlage und Zulässigkeitsvoraussetzungen der Vollstreckungshilfe für Einziehungsentscheidungen im vertragslosen Bereich dar. Hierbei stellte sie insbesondere klar, dass nach § 48 S. 2 IRG auch Einziehungsentscheidungen nicht-strafrechtlicher Gerichte ausreichen, sofern dort eine Straftat zugrunde liegt. Anschließend stellte sie auch das Verfahren und die Entscheidung im Rahmen der Vollstreckungshilfe dar. So entscheidet das LG über die Zulässigkeit der Vollstreckung. Gegen entsprechende Entscheidungen sei die sofortige Beschwerde zum OLG und die Vorlage an den BGH möglich. Im Rahmen der Zulässigkeit müsse auch die beiderseitige Einziehbarkeit in der Form geprüft werden, dass eine Einziehung bei sinngemäßer Umstellung des Sachverhalts auch in Deutschland hätte angeordnet werden können. Hier bestünden gute Verteidigungsmöglichkeiten, wenn es sich um eine ausländische Strafe gegen Unternehmen handele. Es komme dann immer auf den konkreten Einzelfall an.
Daran anschließend stellte Hüttemann die Vollstreckungshilfe bei der Einziehung mit EU-Staaten dar. Die Zulässigkeitsvoraussetzung bestünden in dem Vorliegen eines Ersuchens, der Vorlage des Originals oder einer beglaubigten Abschrift der Entscheidung und des standardisierten Formblattes sowie der beiderseitigen Einziehbarkeit. Die Anwendung sei insoweit enger, als die Entscheidung von einem Strafgericht in einem Strafverfahren erlassen worden sein müsse. Bei 32 Deliktskategorien werde allerdings auf die Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit als Voraussetzung für die Einziehbarkeit in Deutschland weitestgehend verzichtet. Die Ablehnungsgründe seien sehr begrenzt. Zuständig sei die Staatsanwaltschaft am Belegenheitsort, weshalb auch die Prüfung der fakultativen Ablehnungsgründe im Ermessen der Staatsanwaltschaft stünde. Hiergegen bestünde die Möglichkeit eines Antrages auf gerichtliche Entscheidung beim LG. Das LG prüfe sodann die Zulässigkeit nach zwingenden Voraussetzungen und Ermessensfehlerfreiheit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft.
In ihrem Ausblick betonte Hüttemann, dass die EU-Kommission Defizite sehe und in Bezug auf die Umsetzung der Rahmenbeschlüsse Sicherstellung und Einziehung kritisch sei. So sei in Deutschland z.B. die Anhörung und Einschaltung des LG nicht Rahmenbeschlusskonform. Neu für die Vollstreckung sei jedenfalls ein vorgesehener Grundrechtsvorbehalt in Ausnahmefällen. So könne die Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung vermeiden, wenn sie Grundrechte verletzen würde. Im Ergebnis sei festzustellen, dass die grenzüberschreitende Abschöpfung zu wenig genutzt werde. Die Gründe hierfür seien aber nicht nur regulatorischer Art. So müssten z.B. entsprechende Kenntnisse und die personelle Ausstattung erhöht werden. Ferner sei ein besseres asset tracing nötig und es müsse die Bereitschaft zur Anwendung der bestehenden Mechanismen erhöht werden. Es existiere eine starke Fragmentierung in den Mitgliedstaaten. Praktisch seien jedenfalls keine erfolgreichen Vollstreckungen ausländischer Titel zu verzeichnen.
II. Panel II: Staatenübergreifende Ermittlungsverfahren
In dem ersten Vortrag des zweiten Panels, das staatenübergreifende Ermittlungsverfahren zum Gegenstand hatte und von Richter Dr. Mavany moderiert wurde, stellte Wiss. Mit. Kilian Wegner die Rechtshilfe im grenzüberschreitenden (Steuer-)Strafverfahren dar. Hierbei beschränkte er sich auf die Auslieferung im Rahmen der sogenannten großen Rechtshilfe und gab zunächst einen Überblick über die einschlägigen Vorschriften des Auslieferungsrechts. Hierzu sei zwischen dem europäischen Bereich, für den der europäische Haftbefehl (§§ 78 ff. IRG) gelte und dem außereuropäischen Bereich des europäischen Auslieferungsübereinkommens inklusive der 4 Zusatzprotokolle und Zusatzabkommen, sowie dem Bereich zu unterscheiden, in dem ausschließlich bilaterale Auslieferungsübereinkommen existieren. Zu den wesentlichen Unterschieden der Regelungsregime führte Wegner aus, dass es im vertragslosen Auslieferungsverkehr keine Auslieferung von Deutschen gebe und die gesetzliche Höchststrafe mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe vorsehen müsse. Im Regelfall erfolge keine Prüfung des Tatverdachts. Bei konkurrierender deutscher Gerichtsbarkeit sei Voraussetzung, dass keine zumindest beschränkt rechtsfähige Erledigung im Inland vorliege oder Verjährung nach deutschem Recht eingetreten sei. Wenn die §§ 3 ff. StGB nicht anwendbar seien, komme es auf eine Rechtskraft und deutsche Verjährung hingegen nicht an. Es dürfe auch kein Verstoß gegen den ordre public vorliegen. Gegeben sein müsse aber die beiderseitige Strafrechtswidrigkeit, weil nach § 3 Abs. 1 IRG die Auslieferung nur zulässig sei, wenn die Tat auch nach deutschem Recht eine rechtswidrige Tat ist, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht, oder wenn Sie bei sinngemäßer Umstellung des Sachverhalts auch nach deutschem Recht eine solche Tat wäre.
Wegner konstatierte, dass aktuell viele Fragen noch nicht geklärt seien, was er an einem Beispiel mit den Ländern Japan und USA verdeutlichte. Hier stellte sich im Ergebnis die Frage, ob eine hypothetische Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts (§§ 3 ff. StGB) gefordert werden müsse. Darüber hinaus sei ungeklärt, welcher Bewertungsmaßstab bei nicht-strafrechtlichen Vorfragen maßgeblich sei. Dies verdeutlichte Wegner an einem Beispiel, in dem T im Staat A Anteile an einer Immobilien-Holding im Wege eines sogenannten Share-Deals erworben und sich dabei nach dem Recht des Staates A wegen Verkürzung von Grunderwerbsteuer strafbar gemacht habe, in Deutschland dasselbe Geschäft allerdings grunderwerbsteuerfrei wäre. Ob in einem derartigen Fall eine Auslieferung möglich wäre, sei in der Rechtsprechung kontrovers entschieden worden. So habe das OLG Hamburg (GA 1989, 172) die Auslieferbarkeit bejaht, wohingegen unter anderem das OLG Frankfurt (NJW 1973, 1569) und das OLG Karlsruhe (Justiz 1986, 225) eine Auslieferbarkeit verneinten. Das KG Berlin (Beschl. v. 15.02.2019 ([4] 151 AuslA 178/17 [10/18]) habe die Frage der Auslieferbarkeit im Ergebnis offengelassen.
Dem gegenüber stellte Wegner sodann den Auslieferungsverkehr nach dem europäischen Auslieferungsübereinkommens. Hier gelten die gleichen Voraussetzungen mit dem Unterschied, dass keine Verjährung nach deutschem Recht (anders: 4. Zusatzprotokolle) und keine rechtskraftfähige Erledigung im Inland vorliegen dürfe sowie eine beiderseitige Straftatbestandsmäßigkeit gefordert werde. In Bezug auf das Erfordernis der beiderseitigen Strafrechtswidrigkeit nach dem europäischen Auslieferungsübereinkommen gelte dem Grundsatz, dass keine Auslieferung wegen Fiskalstraftaten Betracht kommt (Art. 5 EuAusÜbK). Das 2. Zusatzprotokoll modifiziere diesen Grundsatz jedoch dahingehend, dass es genüge, wenn in Deutschland vergleichbares Handeln strafbar sei. Zum Auslieferungsverkehr nach Maßgabe des europäischen Haftbefehls erläuterte Wegner die Besonderheit unter anderem des nur eingeschränkten Erfordernisses der beiderseitigen Strafrechtswidrigkeit. So müsse erstens bei Fiskaldelikten in Deutschland keine vergleichbare Steuer existieren und zweitens keine Prüfung der beiderseitigen Strafrechtswidrigkeit bei Katalogdelikten erfolgen. Zum Schluss stellte er fest, dass es wertungswidersprüchlich sei, dass Deutschland umso mehr Vorbehalte bei der Auslieferung geltend mache, je enger die vertraglichen Beziehungen zu diesen Ländern seien.
Daran anschließend referierte Rechtsanwalt Dr. Grözinger über die Anforderungen an die Individualverteidigung in staatenübergreifenden Ermittlungsverfahren am Beispiel USA und Deutschland. Er leitete seinen Vortrag damit ein, dass ihm im Rahmen der Verteidigung im Zusammenhang mit dem Dieselskandal immer wieder Fragestellungen begegneten, weil er als Strafverteidiger in einem grenzüberschreitenden Sachverhalt an mehreren Fronten zu verteidigen habe. Dies stelle den Verteidiger vor große Herausforderungen. Die staatenübergreifende Strafverteidigung biete aber gleichzeitig auch Chancen. Zu Beginn einer staatenübergreifenden Strafverteidigung sei zu fragen, ob es überhaupt ein Strafverfahren im Ausland gebe, ob dieses Strafverfahren den eigenen Mandanten auch dann tangiere, wenn das Verfahren gegen ihn in Deutschland bereits rechtskräftig beendet wurde und welche Gefahren drohen könnten. In Bezug auf die USA sei zu bedenken, dass es ein allgemeines völkerrechtliches Doppelbestrafungsverbot nicht gebe. In diesem Zusammenhang sollte der Verteidiger stets die Möglichkeit der Anrechnung einer im Ausland verbüßten Strafe gemäß § 51 Abs. 3 StGB und § 153c StPO im Blick haben, der die Möglichkeit der Einstellung im Falle einer Auslandsverurteilung vorsehe. Gerade im Verhältnis Deutschland – USA müsse darüber hinaus berücksichtigt werden, dass wegen der dort stark ausgeprägten Vergleichs- und Kooperationskultur Gefahren für den eigenen Mandanten auch von Seiten des Unternehmens drohen könnten. Unternehmen seien in den USA häufig darauf angewiesen, sich einen sog. Cooperation Credit zu erarbeiten, um in den Genuss eines „Deals“ mit der Staatsanwaltschaft zu kommen. Grundlage für den Erhalt eines solchen Cooperation Credits sei die vollumfängliche Kooperation des betroffenen Unternehmens. So könnte zum Beispiel alles, was der Mandant im Rahmen einer internen Untersuchung gegenüber den Unternehmensanwälten äußert, an das Department of Justice (DOJ) weitergeleitet und schlussendlich gegen sie verwendet werden. Sodann erklärte Grözinger das Non Prosecution Agreement (NPA), das Deferred Prosecution Agreement (DPA) und das Cooperation Agreement oder Plea Agreement. Das NPA sei mit den §§ 153, 153a StPO und das Cooperation Agreement mit der Kronzeugenregelung nach § 46b StGB vergleichbar.
Grözinger führte weiter aus, dass eine Kooperation in den USA über das sog. Proffering funktioniere, was bedeute, dass entweder der Verteidiger im Wege eines Attorney Proffers oder der Mandant im Wege eines Client Proffers dem DOJ Informationen anbiete. Wichtig sei zu wissen, dass in den USA – anders als in Deutschland – auch Beschuldigte im Rahmen ihrer Einlassungen gegenüber einer Bundesbehörde eine strafrechtlich abgesicherten Wahrheitspflicht haben. Falschaussagen würden wegen Obstruction of Justice oder konkreter Making of False Statement mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Faktisch handele es sich hierbei um einen „Catch-all“, also einen Auffangstraftatbestand. Grözinger empfahl, dem Mandanten von Reisen außerhalb der Bundesrepublik strikt abzuraten, wenn er möglicherweise Target in einem US-Strafverfahren sei, weil andere EU-Staaten nach dem zwischen der USA und der EU geschlossenen Auslieferungsabkommen zur Auslieferung von Unionsbürgern verpflichtet seien.
Zum Schluss vertrat Grözinger die These, dass sämtliche Vernehmungen durch nationale Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des sog. Diesel-Skandals unverwertbar seien, an denen US-amerikanische Ermittler teilnahmen. Der deutsch-amerikanische Rechtshilfevertrag lasse die Anwesenheit von Bundesagenten des DOJ in Zeugenvernehmungen zwar ausdrücklich zu. Problematisch sei aber, dass der Anwendungsbereich der Delikte der Obstruction of Justice und konkret der des Making of False Statement nach US-Recht extraterritorial ausgelegt werde. Dies führe dazu, dass sich Zeugen und Beschuldigte in einer deutschen Vernehmung, die unter Anwesenheit von Bundesagenten des DOJ durchgeführt wird, nach US-Recht strafbar machen können. So schaffe die deutsche Staatsanwaltschaft für die Betroffenen aufgrund des massiven Strafverfolgungsrisikos eine faktische Wahrheitspflicht, die mit dem deutschen Strafverfahren unvereinbar und die aufgrund des damit einhergehenden Geständnisdrucks als unzulässiger Zwang im Sinne von § 136a Abs. 1 S. 2 StPO zu werten sei.
In dem dritten Vortrag des zweiten Panels berichtete Rechtsanwalt Dr. Neuber ebenfalls am Beispiel Deutschland und USA über die Anforderungen an die Unternehmensverteidigung in staatenübergreifenden Ermittlungsverfahren. Nach der Definition staatenübergreifender Ermittlungsverfahren stellte er die These auf, dass nicht das Ziel der Unternehmensverteidigung das staatenübergreifende Ermittlungsverfahren außergewöhnlich mache, sondern der Umstand, dass eine Vielzahl ungewohnter Faktoren den Weg dorthin erheblich erschweren können. So sei überhaupt zunächst ein potentiell staatenübergreifendes Ermittlungsverfahren zu identifizieren. Hierzu sei zu ergründen, ob es Anhaltspunkte für grenzüberschreitende „Tatorte“ gebe, ob der Mandant grenzüberschreitend operiere oder ob es Mutter-, Tochter- oder Partnerunternehmen gebe, welche im Ausland tätig seien und in den Vorgang involviert sein könnten. Weiter sei zu fragen, ob es personelle Verflechtungen zu ausländischen verbundenen Unternehmen oder Anhaltspunkte dafür gebe, dass Rechtshilfeersuchen gestellt worden seien. Im Rahmen einer Akutberatung und –verteidigung bei Zwangsmaßnahmen sei zu berücksichtigen, dass nach § 110 Abs. 3 StPO der Zugriff auf räumlich getrennte Server möglich sei und die Befugnisse an der deutschen Grenze nur dann enden würden, wenn der Server nicht in einem Staat der Cybercrime Convention belegen sei und der Berechtigte nicht zustimme. Deshalb sei zumindest im Rahmen der Akutberatung zunächst zu empfehlen, eine entsprechende Zustimmung nicht zu erteilen.
Sodann referierte Neuber zur Findung der Verteidigungsstrategie und der Grundfrage, ob kooperiert oder streitig verteidigt werden soll. Hierbei sei unter anderem zu berücksichtigen, dass eine Kooperation Risiken beinhalte und ausländische Beschlagnahmeregeln größeren Schutz böten als nationale. Beispielhaft sei das US-amerikanische Legal Privilege. Das darüber hinaus existierende Attorney Client Privilege schütze die Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant im Zusammenhang mit einer rechtlichen Beratung. Die sog. Work Product Doctrine umfasse den Schutz der Dokumente, die der Anwalt in Erwartung eines Rechtsstreits erstelle. Es drohe allerdings der Verlust des Schutzes bei der freiwilligen Herausgabe zum Beispiel an Dritte. Die Folge könne dann die Heraus- bzw. Weitergabe an das DOJ (Subpoena) oder an die Gegenseite im US-amerikanischen Zivilverfahren (Pre Trial Discovery) sein. Sei die Herausgabe allerdings erzwungen worden, ginge der Beschlagnahmeschutz nicht verloren, weshalb der Angriff einer möglicherweise rechtswidrigen Beschlagnahmeanordnung geboten sei. Im Rahmen einer streitigen nationalen Verteidigung sei bei einer vorangegangenen Verfahrensbeendigung in den USA durch einen „strafprozessualen Vergleich“ (Deferred Prosecution Agreement / Non Prosecution Agreement) das Kernelement eines solchen Vergleichs zu berücksichtigen. Dieses bestehe darin, dass der so ausgehandelte Sachverhalt (Statement of Facts) auch über die amerikanische Grenze hinweg unantastbar sei. Ein In-Frage-Stellen dieses Sachverhalts könne zur Aufkündigung des Vergleichs durch das DOJ führen. Dies müsse der Verteidiger erkennen und akzeptieren. In einer solchen Konstellation bestehe eine Verteidigungsmöglichkeit darin, für die Einhaltung der deutschen Prozessregeln durch Staatsanwaltschaft – insbesondere hinsichtlich der Erhebung unmittelbarer Beweise – zu streiten. Im Stadium der Verfahrensbeendigung seien dann insbesondere „Verhandlungen“ zwischen der Verteidigung und der Staatsanwaltschat hinsichtlich Höhe der Unternehmensgeldbuße zu führen. Hierbei sei insbesondere die Anrechnung ausländischer vollstreckter Strafen nach § 51 Abs. 3 StPO analog zu diskutieren. Aufgrund der Separate Sovereign Doctrine würden derartige verfahrensbeendenden Gespräche in den USA keine Geltung beanspruchen.
Zuletzt stellte Neuber im Rahmen des Ausblicks auf den VerSanG-E dar, dass die Ausweitung des Anwendungsbereichs des VerSanG auf Auslandstaten (ausländischer Mitarbeiter des deutschen Unternehmens begeht Straftat im Ausland) zu noch mehr parallelen Ermittlungsverfahren führen könne. Darüber hinaus würden die erheblichen Kooperationsanreize für Unternehmen wie zum Beispiel die Sanktionsmilderung um bis zu 50 % die Ausrichtung der globalen Verteidigungsstrategie vor noch größere Herausforderungen stellen.
In der anschließenden Diskussion beantwortete Grözinger die Frage, warum die Aussagen im Dieselverfahren im Rahmen einer Vernehmung durch einen deutschen Staatsanwalt unverwertbar sein sollen, nur weil Ermittler des DOJ anwesend waren, mit dem massiven Geständnisdruck. Zwar nehme der Rechtshilfevertrag mit den USA hierzu nicht ausdrücklich Stellung, allerdings gelte in diesem Verhältnis die Grundregel, dass alles erlaubt sei, was nicht verboten ist. Aus dem Plenum wird in diesem Zusammenhang die Parallele zu den Aussagen des Beschuldigten in der Hauptverhandlung für den Fall gezogen, dass eine Adhäsionsklage anhängig sei. In dieser Konstellation könne der Beschuldigte auch in Deutschland wegen einer falschen Aussage wegen Prozessbetruges verfolgt werden.
Zum Vortrag von Wegner wurde sodann angemerkt, dass es sich nur um einen scheinbaren Wertungswiderspruch handele, wenn ausgeführt werde, dass der vertragslose Auslieferungsverkehr leichter funktioniere als der Innereuropäische. Hierdurch sei über den Einzelfall noch nichts gesagt und es ergäben sich eben engere Regeln, wenn lange und viel zusammengearbeitet werde. Diesem Einwand würde Wegner allerdings nur zustimmen, wenn Deutschland ein Wahlrecht hätte. Der BGH und die OLG würden allerdings immer wieder entscheiden, dass es ein Wahlrecht nicht gebe. Der Wertungswiderspruch beziehe sich auch nur auf solche Staaten, die die engeren Voraussetzungen haben. Auf die Auslieferungshindernisse mit der Schweiz angesprochen, führte Wegner weiter aus, dass von dem ordre public als Auslieferungshindernis zum Beispiel mit der Schweiz von Deutschland kein Gebrauch gemacht werde. Von der Schweiz hingegen schon. Deutschland mache das über die Haftbedingungen. Nach der Rechtsprechung der OLG sperre der Vertrag das IRG.
An Grözinger wurde sodann die Frage gerichtet, ob in transnationalen Verfahren der Arbeitgeber nicht immer der Feind des Mitarbeiters sei und der Mitarbeiter hierüber auch zu belehren sei. Grözinger antwortete, dass es auf die konkrete Unternehmenskultur und auf die Frage ankomme, wie lange ein Mitarbeiter im Unternehmen nach Maßgabe der Business Judgement Rule noch haltbar sei. Es komme aber auch vor, dass sich Unternehmen schützend vor die Mitarbeiter stellten. Hingewiesen werden sollte auf den internationalen Bezug aber schon.
Sodann wurde an Neuber die Frage gerichtet, ob die mündliche Übermittlung von Informationen zum Verlust des Legal Privilege führe, was Neuber bejahte. Dies sei in den USA bereits gerichtlich entschieden.
Danach gefragt antwortete Wegner, dass ihm keine Statistik bekannt sei, dass es in Bezug auf die OLG-Bezirke verschiedene Praktiken hinsichtlich der internationalen Rechtshilfe gibt.
Nach den Folgen des VerSanG in Bezug auf die Individualverteidigung gefragt, antwortete Grözinger, dass sich bis auf einige Änderungen hinsichtlich der Beschlagnahme nicht viel ändern würde. Das VerSanG habe kaum Folgen und Wirkungen für die Individualverteidigung. Neuber ergänzte, dass die Verfolgung von Individuen wegen der verstärkten Möglichkeit von Einstellungen nach § 153a StPO zurückgehen könnten und sich vielleicht mehr auf die Unternehmen konzentriert werde. Möglicherweise verfolge das VerSanG maßgeblich fiskalische Interessen.
Aus dem Plenum wurde abschließend angemerkt, dass die Unterlassensstrafbarkeit durch das VerSanG immer weiter ausgebaut werde. Das VerSanG verschärfe die Haftung nicht nur für den Vorstand und die Aufsichtsebene, sondern auch für die Ebene darunter. Auf diese Weise ließe sich in einem Unternehmen immer und überall irgendeine Verantwortung begründen.
III. Panel III: Rechtsgutachten und Strafbarkeit von Berater und Beratenem im Wirtschaftsstrafrecht
Das dritte Panel zu Rechtsgutachten und der Strafbarkeit von Berater und Beratenem im Wirtschaftsstrafrecht wurde von Rechtsanwalt Lepper, LL.M. moderiert. Zunächst referierte Prof. Dr. Paul Krell zu der Strafbarkeit des Gutachters und Rechtsberaters im Wirtschaftsstrafrecht. Krell führte zunächst als mögliche Auskunftspersonen den Rechtsanwalt, Syndikus und Hochschullehrer an und erläuterte den Begriff des Rechtsrats als Oberbegriff für die Rechtsauskunft und Rechtsberatung einschließlich dem erstellen von Gutachten. In der bisherigen Diskussion stehe eindeutig der Fokus auf der Beihilfestrafbarkeit mit der Folge, dass die Erscheinungsformen der Anstiftung und mittelbaren Täterschaft weitgehend ausgeblendet würden. Als Ausgangsthesen formulierte er, dass die Berufsfreiheit nach einer restriktiven Lösung verlange, die ein unangemessenes Strafbarkeitsrisiko verhindere und die strenge Rechtsprechung zu vermeidbaren Verbotsirrtümern ein entsprechendes Bedürfnis schaffe. Weiter formulierte er, dass die rechtsberatenden Berufe grundsätzlich alle Beteiligungsformen verwirklichen könnten und das Restriktionsbedürfnis unabhängig von der Beteiligungsform bestehe. Schließlich hänge die Frage, welche Beteiligungsformen in Betracht kommen, maßgeblich von der Art des Irrtums ab, der bei der auskunftsersuchenden Person entstehe. Auch hiervon solle aber das Strafbarkeitsrisiko nicht abhängen. Was die Strafbarkeit des Gutachters und Rechtsberaters im Wirtschaftsstrafrecht anbelangt, so sei die Berufsfreiheit auch durch die Rechtsprechung zur Strafverteidigung und § 258 StGB sowie durch die Rechtsprechung zum Verteidigerhonorar und § 261 StGB betroffen. Die Berufsfreiheit sei auch einschlägig bei der jüngeren Rechtsprechung zu Abmahnschreiben. Der BGH habe hier allerdings zum Teil kein hinreichendes Problembewusstsein. In Bezug auf die Bejahung eines unvermeidbaren Verbotsirrtums sei der BGH sehr zurückhaltend. Insoweit gelte der Grundsatz, dass im Zweifel Rechtsrat einzuholen sei. Dann dürfte allerdings der Zugang hierzu nicht durch ein unangemessenes Strafbarkeitsrisiko verengt werden.
Am Fallbeispiel Putz (BGHSt 55, 191) erklärte Krell, dass die angenommene Mittäterschaft des Gutachters zweifelhaft und wegen des Verbotsirrtums auch mittelbare Täterschaft denkbar sei. Jedenfalls sei aber wegen der limitierten Akzessorietät auch Anstiftung oder Beihilfe möglich. Die objektiven Ansätze der Teilnahmedogmatik (Theorie der Sozialadäquanz, Theorie der professionellen Adäquanz und deliktischer Sinnbezug) zeigten insoweit keine großen Unterschiede. Der subjektive Ansatz, der einen Talentförderungswillen fordere, sei zwar strafrechtsdogmatisch unterlegen. Allerdings werde sich eine Theorie der Sozial-/professionellen Adäquanz ohne Berücksichtigung der subjektiven Seite kaum entwickeln lassen. In Bezug auf die Bewertung des Rechtsrats stellte Krell fest, dass die allgemeinen Lehren nicht ohne weiteres passen würden. So gehe es bei den subjektiven Ansätzen um das subjektive Verhältnis zum Sachverhalt und die Auskunftspersonen wisse bei Rechtsrat immer genau, was die auskunftsersuchende Person tun werde. Insofern wäre eine eigenständige Theorie der Adäquanz erforderlich, die andere Schwerpunkte setze. Bei der Abgrenzung von Anstiftung und Beihilfe sei jedenfalls zweifelhaft, dass in der Regel nur Beihilfe erwogen werde. Dies sei nur überzeugend, wenn die auskunftsersuchende Person ohnehin fest zur Tat entschlossen sei, was wohl nicht dem Regelfall entsprechen dürfte. Sei der Ratsuchende allerdings nur zur Tat geneigt, könne er durch den Rechtsrat durchaus zur Tat bestimmt werden. Zur Einordnung des Gutachters in die Kategorie der mittelbaren Täterschaft führte Krell aus, dass in der Regel ein Strafbarkeitsdefizit gegeben sei, wenn beim Tatmittler z.B. nur ein vermeidbarer Verbotsirrtum vorliege. An der dann in Betracht kommenden Irrtumsherrschaft fehle es nur, wenn die auskunftsersuchende Person unabhängig von der Auskunft sowieso handeln werde. Mache die auskunftsersuchende Person die Entscheidung dagegen tatsächlich von der Auskunft abhängig, liege Tatherrschaft nahe. Dies gelte nach Krells Auffassung auch dann, wenn man mit Roxin auf die Hervorberufung des Tatentschlusses und nicht des Irrtums abstelle. Hier schlage die Abgrenzungsfrage zwischen Anstiftung und Beihilfe auf die mittelbare Täterschaft durch. In der Regel werde die Auskunftsperson auch um die Tatherrschaft wissen.
Daran anschließend skizzierte Krell die Lösung, dass zum einen ein Restriktionsbedürfnis nur bei Bezug zu einer rechtsberatenden Tätigkeit bestehe und es grundsätzlich an einer Täuschung über Tatsachen fehle. Zum anderen könne Rechtsrat nur eingeschränkt unrichtig sein. In den primär interessierenden Grenzfällen geht es in der Regel um normative Aussagen über das Recht, bei denen Letztbegründungen nicht möglich seien und daher Rechtsrat in dieser Konstellation – anders als bei deskriptiven Aussagen über das Recht – grundsätzlich auch nicht unrichtig sein könne. Krell schloss seinen Vortrag mit dem Fazit, dass eine Strafbarkeit auf dieser Grundlage allenfalls in Extremfällen in Betracht komme und hierdurch eine angemessene Restriktion erreicht werde. Die Lösung stünde auch im Einklang mit der Berufsfreiheit. In solchen Extremfällen läge in der Regel ein Irrtum der auskunftsersuchenden Person und damit Tatherrschaft der Auskunftspersonen vor, was zu einem Gleichlauf der Beteiligungsformen führe.
Im Anschluss daran beleuchtete Akad. Rätin a. Zt. Dr. Andrea Busch die Strafbarkeit des Beratenen trotz entlastendem Rechtsrat. Dabei differenzierte sie nach Fällen echter Fehlberatung und solchen der Beratung über ein sogenanntes Regelungsdefizit. Bei den Fällen der echten Fehlberatung sei zunächst auf erster Stufe das Vorliegen eines Irrtums zu prüfen. Die Fehlvorstellung des Ratsuchenden sei je nach Bezugspunkt bei einem rechtlichen Irrtum als Tatumstands- bzw. Verbotsirrtum und bei einem tatsächlichen Irrtum als Tatumstands-, Erlaubnistatumstands- und Entschuldigungstatumstandsirrtum zu klassifizieren. Die Abgrenzung der Irrtumsvorschriften sei z. B. bei Fehlvorstellung über die Reichweite von Blankettnormen teilweise streitig. Problematisch sei die Frage, ob ein Irrtum auch dann vorliege, wenn der Beratene nach Auskunftseinholung noch Zweifel habe. Der BGH verneine einen Verbotsirrtum, wenn die Rechtswidrigkeit für möglich erachtet und billigend in Kauf genommen worden sei (sogenannte bedingte Unrechtseinsicht). Dies werde aus verschiedenen Richtungen kritisiert. So sei zum einen das voluntative Element der Unrechtseinsicht an sich zweifelhaft und zum anderen würden die Anforderungen an das kognitive Element zum Teil für zu niedrig erachtet. Als eigene Lösung schlug Busch vor, einen Irrtum dann zu bejahen, wenn und solange der Ratsuchende dem Ratgeber und dessen fachlicher Auskunft noch grundsätzlich Vertrauen schenke (sogenannter Beratungsvertrauensirrtum). Auf diese Weise würden identische Grundsätze für Verbots-, Tatumstands- und Entschuldigungstatumstandsirrtümer gelten und die informationelle Abhängigkeit des Ratsuchenden berücksichtigt. Problematisch sei ferner die Annahme eines Irrtums, wenn der Beratene die außerstrafrechtliche Rechtswidrigkeit kenne. Diese Frage sei sehr streitig. Der BGH verneine einen Irrtum, wohingegen die andere Ansicht gut vertretbar sei, weil der Beratene schon dann eine Privilegierung verdient habe, wenn er sich jedenfalls vergewissert habe, dass sein Vorhaben nicht strafbar sei.
Auf zweiter Stufe prüfte Busch sodann die Rechtsfahrlässigkeit bzw. Vermeidbarkeit des Irrtums. Diese 2. Stufe werde dogmatisch unterschiedlich eingebunden. Einerseits als sekundäre selbstständige Fahrlässigkeitsprüfung, sofern die Fahrlässigkeit strafbar sei und andererseits sollen die Irrtümer nur beachtlich sein, wenn diese unvermeidbar seien. Trotz dieser unterschiedlichen Dogmatik bestünden im Wesentlichen übereinstimmende Kriterien bzw. Maßstäbe. Der BGH arbeite beim Verbotsirrtum mit einem Textbaustein. Ein berechtigtes Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft bestehe jedenfalls dann, wenn es sich aus Tätersicht um eine verlässliche Auskunftsperson und eine verlässliche Auskunft handele. Der Ratsuchende habe den Ratgeber hingegen auf äußere Anhaltspunkte bzw. Warnsignale auf Basis der allgemeinen Lebenserfahrung hin zu überprüfen. In der Regel werde die inhaltliche Unrichtigkeit der Auskunft für den Ratsuchenden nicht erkennbar sein. Im Zivilrecht verlange der BGH eine Plausibilitätsprüfung, was auf das Strafrecht übertragen werden könne. Grundsätzlich gelte aber die Regel, dass die gebotene Prüfungsintensität hinsichtlich der Plausibilität der Auskunft umso geringer sein könne je höher der Verlässlichkeitsgrad der Auskunftspersonen sei. Insofern gelte ein objektiviert-subjektiver Maßstab der Sorgfalt des Ratsuchenden in der Form, dass zu der Erkennbarkeit für jedermann oder für Angehörige des jeweiligen Verkehrskreises die individuellen Möglichkeiten des Ratsuchenden berücksichtigt werden müssen. Insoweit bestünde eine Parallele zum Maßstab in § 9 Abs. 2 öStGB und der Rechtsprechung des OGH.
Sodann stellte Busch die Definition der Plausibilitätskontrolle des BGH dar. Einleitend zu den Fällen der Beratung über ein sogenanntes Regelungsdefizit definierte sie zunächst den Begriff des Regelungsdefizits, wonach ein unklarer Gesetzestext und eine fehlende oder uneinheitliche Präzisierung in der Rechtsprechung erforderlich sei. Insoweit sei in Bezug auf die Schutzwürdigkeit des Ratsuchenden zu berücksichtigen, dass der Staat zwar einerseits die unklare Rechtslage verursacht habe, andererseits aber ein genereller Freibrief rücksichtsloses Austesten rechtlicher Grenzbereiche auf Kosten der jeweils geschützten Rechtsgüter fördern würde. Die Behandlung einer unklaren Rechtslage unabhängig von einer Beratung sei in der Rechtsprechung uneinheitlich. Busch schlug eine Lösung über die Schutzwürdigkeit vor, die in Prognosefällen, d. h. wenn der Ratgeber eine bestimmte zukünftige Rechtsprechungslinie prognostiziere, zu bejahen sei. In Fällen ergebnisoffener Beratung sei die Schutzwürdigkeit hingegen nur dann nicht abzulehnen, wenn ein Abwarten unzumutbar wäre.
Zum Schluss ihres Vortrages schilderte Busch den dogmatischen Anknüpfungspunkt des Verantwortungsausschlusses. Der Ansatz der Rechtsprechung und Teilen der Literatur, über die strafrechtlichen Irrtumsvorschriften zu gehen, werde kritisiert, weil aus einem an sich objektiven Problem ein subjektives gemacht werde. Eine andere Ansicht wolle das Gesetzlichkeitsprinzip aus Art. 103 Abs. 2 GG heranziehen. Dieser Ansatz sehe sich allerdings der Kritik einer pauschalen Entlastung des Ratsuchenden ausgesetzt, die keine Differenzierung ermöglichten. Dies führe Busch zu dem Ergebnis, dass de lege ferenda ein spezieller Schuldausschließungsgrund geschaffen werden müsse.
Das dritte Panel endete mit dem Vortrag von Rechtsanwalt Sven Diener zu dem Umgang mit Grenzen der Beratung in der Praxis. Nach einer kurzen Einleitung in die Thematik skizzierte Diener die möglichen Ziele einer Beratung. So könne der Mandant eine umfassende rechtliche bzw. strafrechtliche Bewertung eines Sachverhalts oder auch nur eine punktuelle (straf-) rechtliche Bewertung von Einzelfragen wünschen, die Bestandteil eines umfassenderen Sachverhalts sind. Dem Mandanten könne es aber auch nur um die Bestätigung der Zulässigkeit eines bestimmten Handelns oder Vorhabens gehen. Hinsichtlich des Umfangs der anwaltlichen Beratungspflichten werde in einer Reihe von zivilgerichtlichen Entscheidungen zur Frage der Anwaltshaftung hinsichtlich des Umfangs der anwaltlichen Beratungspflichten auf das jeweilige Mandatsverhältnis abgestellt. Nach der Rechtsprechung des BGH (NJW 2007, 2485) gelte, dass der Rechtsanwalt grundsätzlich zur allgemeinen, umfassenden und möglichst erschöpfenden Belehrung des Auftraggebers verpflichtet sei, soweit der Mandant nicht eindeutig zu erkennen gebe, dass er Rat nur in einer bestimmten Richtung bedarf. Der Rechtsanwalt habe den Mandanten in den Grenzen des Mandats diejenigen Schritte anzuraten, die zu dem erstrebten Ziel zu führen geeignet seien, und Nachteile für den Auftraggeber verhindern, soweit solche vorhersehbar und vermeidbar sind. Dazu habe er dem Auftraggeber den sichersten und gefahrlosesten Weg vorzuschlagen und ihn über mögliche Risiken aufzuklären, damit der Mandant zu einer sachgerechten Entscheidung in der Lage ist. Damit treffe den Rechtsanwalt zwar grundsätzlich eine Pflicht zur umfassenden – d.h. rechtsgebietsübergreifenden – Beratung. Der konkrete Umfang der anwaltlichen Pflichten richte sich allerdings gleichwohl nach dem erteilten Mandat und den Umständen des Einzelfalls. Das von der Rechtsprechung definierte Ziel der anwaltlichen Rechtsberatung bestehe deshalb darin, dem Mandanten eigenverantwortliche sachgerechte Entscheidungen in seiner Rechtsangelegenheit zu ermöglichen.
Zu den Problemen einer Beschränkung der Beratung auf einzelne Fragestellungen führte Diener aus, dass eine Berufung des Ratsuchenden auf einen Irrtum nur möglich sei, wenn dieser den Berater umfassend über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und einen Auftrag zur umfassenden Begutachtung erteilt habe. Nach Maßgabe der Rechtsprechung (BGH ZWH 2015, 243, 245) könne von einem juristischem Laien hingegen regelmäßig nicht erwartet werden, dass er die relevanten Rechtsfragen korrekt formuliere. Deshalb habe der Berater auch außerhalb des Auftrags liegende Rechtsfragen in den Blick zu nehmen, soweit diese für Begutachtung von Relevanz seien. In Bezug auf eine mögliche Pflicht des Beraters zur Erweiterung des Prüfungsumfanges sprach sich Diener dafür aus, eine solche Erweiterungspflicht nur dann anzunehmen, wenn die Berücksichtigung weiterer Aspekte möglicherweise zu einer Veränderung der kernstrafrechtlichen Bewertung führe. Eine Erweiterungspflicht lehne er allerdings dann ab, wenn es sich lediglich um eine Erweiterung der Haftungsrisiken im außerstrafrechtlichen Bereich handele. Im Rahmen der Beratung seien jene Fälle problematisch, in denen eine klare Aussage über eine potentielle strafrechtliche Relevanz des geplanten Handelns mangels gesicherter Rechtsprechung zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht möglich sei. Hier besteht insbesondere die Gefahr von Rückschaufehlern bei einer nachträglichen anderen Bewertung durch die Ermittlungsbehörden. Dies dürfe aber nicht dazu führen, bei unklarer Rechtslage stets das rechtlich denkbare worst-case-Szenario zum Maßstab des Handelns zu erklären.
Zum Inhalt des Gutachtens erklärte Diener, dass sich die Würdigung grundsätzlich an der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu orientieren habe. Eine abweichende oder im Ergebnis unzutreffende rechtliche Bewertungen bei Erteilung einer reinen Rechtsauskunft werde von der Rechtsprechung jedoch akzeptiert, wenn dem Rat nicht nur eine „Feigenblattfunktion“ im Sinne eines Gefälligkeitsgutachtens zukomme, die Begutachtung objektiv, sorgfältig, verantwortungsbewusst und insbesondere nach pflichtgemäßer Prüfung der Sach- und Rechtslage erfolgte sowie der Anwalt von der Straflosigkeit des Verhaltens nach umfassender Abwägung nach bestem Wissen und Gewissen überzeugt sei. Problematisch seien zudem die Fälle, in denen die Rechtsauskunft um eine Handlungsempfehlung erweitert werde. Hier bestehe mit Blick auf die Rechtsprechung das Risiko, dass die Handlungsempfehlung nicht mehr in den Bereich der sogenannten neutralen Handlung falle. Insbesondere dann nicht, wenn die Empfehlung für eine risikoreichere Alternative auf einer wirtschaftlichen Zweckmäßigkeitserwägung beruhe und hierdurch tatsächliche Risiken relativiert würden.
Zum Schluss seines Vortrages gab Diener eine Empfehlung für die Ausgestaltung eines neutralen Gutachtens. Hierzu sei die innere Unabhängigkeit und Objektivität des Beraters ebenso wichtig wie die Berücksichtigung der Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit. Die Begutachtung habe darüber hinaus auf der Grundlage eines vollständigen Sachverhalts zu erfolgen und die Vertrauenswürdigkeit des Gutachtens zu gewährleisten. Schließlich seien keine Handlungsempfehlungen aufgrund von Zweckmäßigkeitserwägungen abzugeben. Eine Strafbarkeit des Beraters werde bei Berücksichtigung dieser Grundsätze auch dann regelmäßig abzulehnen sein, wenn sich im Nachgang herausstellen sollte, dass die seinerzeit erteilte Rechtsauskunft ex post anders zu bewerten sei.
In der abschließenden Diskussion wurde Krell gefragt, ob es einen unvermeidbaren Verbotsirrtum beim Gutachter gebe. Krell beantwortete die Frage dahingehend, dass entsprechende Fälle jedenfalls sehr selten sein dürften. Vorstellbar wäre dies jedenfalls, wenn der Gutachter trotz gründlichster Recherche eine Gerichtsentscheidung übersehen habe. Nach einer Strafbarkeit des Gutachters wegen Mittäterschaft gefragt antwortete er, dass grundsätzlich alle Beteiligungsformen verwirklicht werden könnten. Die Fälle der mittelbaren Tätigkeit seien allerdings auf Extremfälle beschränkt. Busch ergänzte, dass ein Irrtum auch dann bejaht werden müsse, wenn der Beratene trotz Vertrauen auf den Berater „Bauchgrummeln“ habe. Es dürfe nicht per se schädlich sein, sich Gedanken zu machen. Aus dem Plenum wurde der Vorschlag geäußert, zur Auflösung der Problematik ein sog. Rechtsklärungsverfahren einzuführen. Es bestünde allerdings heute schon das Problem, dass Behörden in vielen Fällen die Auskunft verweigern würden. Problematisch sei weiter, dass es in Deutschland kein Case Law gebe. Möglicherweise sei eine größere Bindungswirkung von Gerichtsurteilen wünschenswert.
Ende der Veranstaltung
Die Rechtsanwälte Dr. Alexander Paradissis und Dr. Max Schwerdtfeger bedankten sich bei allen Referenten, Moderatoren und Teilnehmern. Sie fassten zusammen, dass alle viel praktisch Relevantes und zugleich wissenschaftlich Fundiertes haben lernen und mitnehmen können. Damit sei nahtlos an die vergangene Veranstaltung angeknüpft worden.