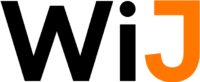Übernahme von Kosten für Verteidiger und Zeugenbeistände – eine Praxisübersicht
WiJ-Checklisten
I. Einleitung
Die Übernahme von Kosten für Verteidiger und Zeugenbeistände durch Unternehmen ist ein bereits viel beleuchtetes Themenfeld, zu der zahlreiche Literaturbeiträge und einige Urteile existieren. Aufgrund der Vielzahl an Beiträgen fällt der Umgang mit dem Thema in der Praxis jedoch oftmals schwer, da man sich im Dschungel von Aufsätzen und Urteilsanmerkungen schnell verliert. Dies gilt für Berufsanfänger sowie für erfahrene Strafverteidiger. Dieser Befund ist besonders deshalb problematisch, da das Thema von erheblicher Praxisrelevanz ist, insbesondere im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts. Umfangreiche und komplizierte Strafverfahren bieten oftmals keine andere Möglichkeit als eine Vergütung durch Unternehmen, wenn die Verteidigung des Beschuldigten lege artis erfolgen soll. Aufgrund der Länge und Komplexität vieler Verfahren, ist eine Vergütung allein nach den gesetzlichen Maßstäben für den Rechtsanwalt schlichtweg nicht wirtschaftlich.
Dass eine über die gesetzliche Vergütungsregelungen hinaus bestehende Vergütungsvereinbarung zulässig ist, ist unstreitig (vgl. nur § 3a RVG). Die Vergütung durch einen Dritten bringt jedoch besondere Probleme mit sich, die der Verteidiger kennen sollte, um die Vergütungsvereinbarung ordnungsgemäß umsetzen zu können und so straf- sowie berufsrechtliche Risiken zu vermeiden.
Dieser Beitrag soll daher in erster Linie dazu dienen, einen Überblick über die unterschiedlichen Fallgruppen zu verschaffen und dem Strafverteidiger als eine Art Checkliste in Tabellenform dienen. Hierbei sollen nicht alle Fragestellungen im Detail beantwortet, sondern überblicksartig aufgezeigt werden. Darüber hinaus wird auf entsprechende Quellen verwiesen, die sich vertiefend mit den jeweiligen Themen befassen.
Im Fokus des Beitrags stehen Fragen zu den strafrechtlichen Risiken der Dritten sowie des Strafverteidigers selbst. Des Weiteren geht es um die Frage, inwieweit der Beschuldigte gegebenenfalls einen Anspruch auf Zahlung der Verteidigerhonorare hat und welche steuerrechtlichen Aspekte hierbei zu berücksichtigen sind. Auch Themen wie die Übernahme der Kosten durch Rechtsschutzversicherungen sowie die Vergütung von Zeugenbeiständen werden beleuchtet.
II. Strafrechtliche Risiken des Dritten
Zunächst stellt sich die Frage, inwieweit bei der Vergütung des Rechtsanwalts durch einen Dritten für diesen strafrechtliche Risiken bestehen:
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Strafvereitelung (§ 258 StGB) | Verteidiger ist Organ der Rechtspflege. Mandatierung ist Grundlage für ein faires Verfahren. Es besteht kein Risiko einer Strafbarkeit nach dieser Norm. | BGH, Urt. v. 07.11.1990 – 2 StR 439/90, NJW 1991, 990 ff.); Brockhaus, ZWH 2012, 169; Spatscheck/Ehnert, StraFo 2005, 265. |
| Untreue (§ 266 StGB) | Es besteht potenziell das Risiko einer Strafbarkeit für den Dritten. Ausnahme: · Arbeitnehmer (Betroffener) hat einen Anspruch auf Kostenübernahme (s. auch III.) · Unternehmen trifft sachgerechte und pflichtgemäße Ermessensentscheidung (s. auch IV.) |
III. Kostenübernahme bzw. -erstattung
Hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Übernahme der Kosten durch seinen Arbeitgeber, stellt die Vergütung für den Arbeitgeber keine strafbare Untreue dar. Dies ergibt sich schon aus dem Grundsatz der strafrechtlichen Akzessorietät, wonach ein zivilrechtlich beziehungsweise gesellschaftsrechtlich zulässiges Verhalten eine untreuerelevante Pflichtwidrigkeit nicht begründen kann (vgl. nur Böttger, in: Wirtschaftsstrafrecht, 3. Kapitel Rn. 38).
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Vertragliche Ansprüche | Ein vertraglicher Anspruch des Arbeitnehmers, bspw. aus seinem Arbeitsvertrag, ist möglich, aber in der Praxis selten. Vorsicht (!): Im Einzelfall könnte vertragliche Regelung den Verdacht der Teilnahme wecken. Hierfür müssten aber entsprechende Anhaltspunkte für eine Beihilfehandlung vorliegen. | Scharf, in: MAH Strafverteidigung, § 43 Rn. 63. |
| Gesetzliche Ansprüche bei privatrechtlichem Arbeitgeber | Möglicher Anspruch aus § 670 BGB analog. Voraussetzung ist, dass der Tatvorwurf unmittelbar im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit steht, schuldlos begangen wurde und der Arbeitnehmer für die Aufwendungen keine besondere Vergütung erhält. | BAG, Urt. v. 16.03.1995 – 8 AZR 260/94, NJW 1995, 2372; Brockhaus, ZWH 2012, 169. |
| Gesetzliche Ansprüche für Organmitglieder | Möglicher Anspruch aus §§ 675 Abs. 1, 670 BGB. Gegebenenfalls auch Anspruch auf Kostenvorschuss aus § 669 BGB. Voraussetzung ist, dass das Verhalten keine Pflichtverletzung gegenüber der Gesellschaft darstellt. In Personenhandelsgesellschaften kann ein Anspruch aus § 716 BGB resultieren (§ 110 HGB a.F.) | Fleischer, in: Spindler/Stilz AktG, § 84 Rn. 70; Klimke, in: BeckOK GB, 40. Edition, Stand: 01.07.2023; Scharf, in: MAH StV § 43 Rn. 58. |
| Höhe der Vergütung | Grundsätzlich nur in Höhe der gesetzlichen Gebühren. Aber: Anspruch auch für Vergütungsvereinbarungen, wenn anwaltliche Hilfe zu gesetzlichen Gebühren nicht zu erlangen ist. Dürfte insb. in Wirtschaftsstrafverfahren regelmäßig der Fall sein. | BAG, Urt. v. 16.03.1995 – 8 AZR 260/94, NJW 1995, 2372; Brockhaus, in: FS Wessing, S. 253, 256; Spatscheck/Ehnert, StraFo 2005, 265. |
| Ansprüche in der öffentlichen Verwaltung | Anspruch kann aufgrund der öffentlich-rechtlichen Fürsorgepflicht begründet sein. Oftmals durch Gewährung eines zinslosen Darlehens, auf dessen Rückzahlung bei Freispruch oder Einstellung nach Antrag verzichtet werden kann. Graubereich bei geringem Verschulden oder Einstellungen nach § 153a StPO. | Rundschreiben des BMI vom 01.07.1985 – D I 4 – 211 481/1 – (GMBl. S. 432), geändert durch Bekanntmachung vom 22.05.1991 – gl. Az. – (GMBl. S. 497) sowie durch Rundschreiben vom 29.11.1999 – D I 4 – 211 481/1 – (GMBl. S. 497); RdErl. d. Innenministeriums – 24 – 1.42 – 2/08 – u.d. Finanzministeriums – IV – B 1110-85.4-IV A 2- vom 7. 7. 2008; Brockhaus, ZWH 2012, 169, 172; Brockhaus, in: FS Wessing, S. 253, 257; Scharf, in: MAH StV § 43 Rn. 9 ff. |
IV. Ermessensentscheidungen im Unternehmen
Hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf eine Übernahme der Verteidigerkosten, bedeutet dies nicht, dass das Unternehmen die Kosten nicht freiwillig übernehmen kann. Das Unternehmen hat in vielen Fällen ein erhebliches Interesse an einer ordentlichen Verteidigung seiner Arbeitnehmer, etwa weil Imageschäden oder wirtschaftliche Einbußen drohen. Bevor das Unternehmen die Entscheidung zur Kostenübernahme trifft, muss es eine sachgerechte und pflichtgemäße Ermessensentscheidung treffen, um strafrechtliche Risiken zu vermeiden.
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Ermessensentscheidung in privaten Unternehmen | Richtet sich nach den Sorgfaltspflichten des § 347 HGB (bzw. § 43 Abs. 1 GmbHG, § 93 Abs. 1 AktG). Es gilt die sog. Business-Judgement-Rule: Keine Pflichtwidrigkeit, wenn der Entscheider mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters handelt. Die Verantwortungsträger haben eine Abwägung vorzunehmen. Eine Kostenübernahme dürfte im Interesse des Unternehmens liegen, wenn eine Geldbuße nach § 30 OWiG, Imageschäden oder wirtschaftliche Einbußen drohen. | Brockhaus, ZWH 2012, 169, 172 f.; ders., in: FS Jürgen Wessing, S. 254, 260; Scharf, in: MAH StV § 43 Rn. 64 ff.; Grigoleit/Tomasic, in: Grigoleit, Aktiengesetz, § 93 Rn. 38 ff.; Spatscheck/Ehnert, StraFo 2005, 265, 268. |
| Mögliche Ermessensfehler | Pflichtwidrigkeit dürfte vorliegen, wenn der Mitarbeiter ausschließlich aus Eigeninteressen und zum Nachteil des Unternehmens handelte oder das Verhalten schon keinen Zusammenhang zu seiner Tätigkeit aufweist. Die Pflichtverletzung darf nicht „gravierend“ sein, bspw. durch fehlende Nähe zum Unternehmensgegenstand, Unangemessenheit hinsichtlich der Vermögenslage im Unternehmen, fehlende innerbetriebliche Transparenz sowie sachwidrige Motive. | BGH, Urt. v. 06.12.2001 – 1 StR 215/01, NJW 2002, 1585; Brockhaus, in: FS Jürgen Wessing, S. 254, 260 f.; Hoffmann/Wißmann StV 2001, 249, 251; Otto, in: FS Tiedemann, S. 693, 699; Spatscheck/Ehnert, StraFo 2005, 265, 268. |
| Besonderheiten für die AG | Grundsätzlich hat der Vorstand einen weiten Ermessensspielraum. Ausnahmsweise entscheidet der Aufsichtsrat, wenn Vorstandsmitglieder betroffen sind. Das Vorstandshandeln darf nicht „schlechterdings unvertretbar“ sein. | OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 07.12.2010 – 5 U 29/10, NZG 2011, 62; Scharf, in: MAH StV § 43 Rn. 83 f. |
| Besonderheiten für die GmbH | Grundsätze der AG sind übertragbar. Je großzügiger das Weisungsrecht der Gesellschafter ausgestaltet ist, desto weniger Ermessensspielraum steht der Geschäftsführung zu. Ist der Geschäftsführer betroffen, trifft Gesellschafterversammlung Entscheidung. | BGH, Urt. v. 04. 11. 2002 – II ZR 224/00, NJW 2003, 358; Pöschke, in: BeckOG GmbHG, § 43 Rn. 79 ff., 101 ff.; Scharf, in: MAH StV § 43 Rn. 90 ff. |
| Besonderheiten für Personenhandelsgesellschaften | Bei Entscheidung über die Kostenübernahme eines Geschäftsführers ist die Gesellschafterversammlung zuständig. Es bedarf eines Beschlusses nach § 116 Abs. 2 HGB. | Rehbinder, ZHR 148, 555, 574 f.; Scharf, in: MAH StV § 43 Rn. 93 f. |
| Ermessensentscheidung in öffentlich organisierten Unternehmen / Behörden | Grundsätzlich ist die Ermessensentscheidung am Sparsamkeitsprinzip und an etwaigen Schadensersatzforderungen auszurichten. Übernahme der Kosten kann aus Fürsorgepflicht geboten sein. Entscheidung kann etwa pflichtwidrig sein, wenn ein besonders schweres Verschulden oder eine Bereicherungsabsicht festgestellt wird. | BGH, Urt. v. 07.11.1990 – 2 StR 439/90, NJW 1991, 990; VG Berlin, Urt. v. 31.05.2017 – 28 K 15.17, BeckRS 2017, 116510; Otto, in: FS Tiedemann, 2008, 693, 704. |
V. Zahlungen durch Rechtsschutz- oder D&O-Versicherungen
Neben der Übernahme der Verteidigerkosten durch den Arbeitgeber, spielt insbesondere die Kostenübernahme durch Versicherungen in der Praxis eine bedeutende Rolle. Viele Unternehmen schließen für ihre Organmitglieder und leitende Angestellte sogenannte D&O-Versicherungen (Directors-and-Officers) ab, die zum Teil auch Kosten aus Strafverfahren übernehmen. Es handelt sich um Verträge zu Gunsten Dritter (LG Marburg, Urteil vom 03.06.2004 – 4 O 2/03, BeckRS 2004, 15685), bei der die Organmitglieder die versicherten Personen sind, die selbstständig Leistungen aus der Versicherung in Anspruch nehmen können.
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| D&O-Versicherungen | Können auch die Kosten strafrechtlicher Verteidigung umfassen. Vorsatztaten sind in der Regel ausgeschlossen. | Lange, DStR 2002, 1626; Nothoff, NJW 2003, 1350, 1351; Scharf, in: MAH StV § 43 Rn. 16 ff. Vgl. insbesondere Ziffer 7.1 GDV-Musterbedingungen AVB D&O. |
VI. Praxishinweise
Für die Verteidigung gibt es noch weitere Punkte, die in der praktischen Ausgestaltung der Kostenübernahme zu berücksichtigen sind.
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Rückzahlungsansprüche | Das Risiko einer Untreue kann vermindert werden, indem sich das Unternehmen vorbehält, die Kostenübernahme einzustellen, bereits gezahlte Kosten zurückzufordern und/oder Schadensersatzansprüche gelten zu machen. Es kann zudem sinnvoll sein, einen Beschluss der Vermögensinhaber einzuholen (tatbestandsausschließendes Einverständnis). | Brockhaus, FS Wessing, S. 252, 261; Kempf/Schilling/Oesterle, in: MAH Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, § 10 Rn. 245. |
| Dokumentation | Die Entscheidungsträger sollten ihre Ermessensüberlegungen dokumentieren, um diese im Zweifel darlegen zu können. | Kempf/Schilling/Oesterle, in: MAH Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, § 10 Rn. 244. |
| Vertragspartner | Es kann sinnvoll sein, die Vergütungsvereinbarung unmittelbar mit dem Dritten zu schließen, um Insolvenzrisiken des Betroffenen frühzeitig zu vermeiden (vgl. § 111i Abs. 2 StPO). | Brockhaus/Scheier, StraFo 2021, 178. |
VII. Straf- und berufsrechtliche Risiken der Verteidigung
Neben der Risiken, die für den Betroffenen und für den Dritten gelten, sollte die Strafverteidigung selbst darauf achten, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu handeln. Auch für den Verteidiger gibt es einige Fallstricke, die zu beachten sind, um straf- und berufsrechtliche Sanktionen zu vermeiden.
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Verschwiegenheitspflicht | Der Strafverteidiger ist Dritten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet. Problem insbesondere bei Rechnungsstellung, da der Rechnung ein Leistungsnachweis beiliegen muss. Lösung: Klausel in Honorarvereinbarung, dass Leistungsnachweise gegenüber Mandanten zu erbringen sind. Besser: Entbindungserklärung des Mandanten. | Brockhaus, StraFo 2019, 133, 140; Herrmann/Latz, in: MAH Vergütungsrecht, § 34 Rn. 37. |
| Interessenkollisionen (§§ 356 StGB, 43a Abs. 4 BRAO, 3 BRAO) | Die Verteidigung erfolgt ausschließlich im Interesse des Betroffenen. Insbesondere keine Weitergabe von Aktenteilen an D&O-Versicherungen, auch wenn dies mit Einverständnis des Mandanten abläuft (vgl. § 19 BORA, § 32f Abs. 5 StPO). | OLG Hamm, Beschl. v. 13.07.2023 – 20 U 64/22, NZWiSt 2024, 134 m. Anm. Peukert/Rhein; Meden/Schwerdtfeger/Petersen, StraFo 2024, 202, 203. |
| Geldwäsche (§ 261 StGB) | Privileg gilt auch bei Zahlung des Honorars durch Dritte | vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.1.2005 – 2 BvR 1975/03, NJW 2005, 1707, 1708; Dahs, Handbuch des Strafverteidigers, Rn 1230. |
VIII. Besonderheiten für Zeugenbeistände
Für Unternehmen kann es in der Praxis sinnvoll sein, auch Mitarbeitern, die als Zeugen vernommen werden sollen, einen Rechtsbeistand zur Seite zu stellen. Dabei sollten die Unternehmensverantwortlichen jedenfalls davon absehen, über den Beistand Einfluss auf den Zeugen zu nehmen. Darüber hinaus ergeben sich wenige Abweichungen im Vergleich zur Vergütung von Strafverteidigern.
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Interessenkollision zum Arbeitgeber | Jedenfalls ein Unternehmensanwalt sollte von einer Zeugenbeistandschaft absehen. Es spricht jedoch nichts gegen die Bestellung eines externen Vertreters. Auch für den Zeugenbeistand gilt, dass er trotz Vergütung durch einen Dritten, beispielsweise den Arbeitgeber, ausschließlich den Interessen des Zeugen verpflichtet ist. | Wessing/Ahlbrecht, in: Der Zeugenbeistand, Rn. 101 f., 425. |
| Anspruch auf Kostenübernahme | Ein Anspruch kann sich aus § 670 BGB analog ergeben, wenn das Verfahren in einem inneren Zusammenhang mit der (Organ-)Tätigkeit steht und sich der Betroffene pflichtgemäß verhalten hat. | Krause, BB Special 8 zu 2007 (Heft 28), S. 2, 3 m.w.N.; Wessing/Ahlbrecht, in: Der Zeugenbeistand, Rn. 426. |
IX. Steuerliche Behandlung
Für das Unternehmen bzw. den Arbeitgeber hat die Übernahme von Verteidigungs- und Zeugenbeistandskosten auch eine steuerliche Relevanz. Auftretende Fragen betreffen häufig die ertragsteuerliche Abzugsfähigkeit, die Lohnsteuerpflicht, den Vorsteuerabzug und die Rechnungsstellung.
1. Ertragsteuerliche Abzugsfähigkeit beim kostentragenden Unternehmen
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Betriebsausgabenabzug (§§ 4 Abs. 4 EStG, 8 Abs. 1 KStG)
| Zahlt eine Kapitalgesellschaft (GmbH, AG) die Verteidigungskosten eines Geschäftsführers/Mitarbeiters liegen stets Betriebsausgaben vor, da eine Kapitalgesellschaft keine außerbetriebliche Sphäre hat. Der Betriebsausgabenabzug darf den Gewinn jedoch nicht mindern, wenn eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt (s.u.). Übernimmt ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft die Verteidigungskosten für einen Mitarbeiter, kann diese als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, wenn dies durch den Betrieb veranlasst ist. Das ist bei der Übernahme von Verteidigungskosten generell der Fall und versteht sich von selbst, wenn der Tatvorwurf im ursächlichen Zusammenhang mit dem Betrieb bzw. der beruflichen Tätigkeit steht und unmittelbar hieraus erklärbar ist. Ist die Kostenübernahme mangels beruflicher Veranlassung als Arbeitslohn zu qualifizieren, liegt beim Arbeitgeber ebenfalls eine zum Betriebsausgabenabzug berechtigende betriebliche Veranlassung vor. Es kommt in diesem Fall nicht darauf an, dass der gegen den Arbeitnehmer erhobene Vorwurf im Zusammenhang mit dem Betrieb steht. Die vorstehenden Grundsätze gelten entsprechend für die Kostenübernahme einer Zeugenbeistandschaft bei Vernehmung eines Mitarbeiters. | BFH, Urt. v. 18.10.2007 – VI R 42/04, NJW 2008, 1342; Beschl. v. 17.8.2011 – VI R 75/10, DStR 2011, 2235; Biesgen, steueranwaltsmagazin 2014, 158, 161; Stetter, in: MAH StV § 44 Rn. 89. |
| Abzugsverbot (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8, 10 EStG) | Die Kosten für die Verteidigung bei einer Bestechung unterfallen dem Abzugsverbot gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 10 EStG. Das Abzugsverbot setzt voraus, dass der objektive und subjektive Straftatbestand erfüllt sind. Ein Abzugsverbot gemäß § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 S. 1 EStG besteht auch für Aufwendungen, die mit Geldbußen, Ordnungsgeldern und Verwarnungsgeldern im Zusammenhang stehen. | BFH, Urt. v. 14.5.2014 – X R 23/12, DStRE 2014, 1156; Urt. v. 15.4.2021 – IV R 25/18, DStR 2021, 1992; BMF-Schreiben v. 10.10.2002 – IV A 6 – S 2145 – 35/02, Rn. 8. Zur fehlenden Abzugsfähigkeit gemäß § 12 Nr. 4 EStG und dem Abzugsverbot nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 EStG bei Übernahme von (Straf-)Sanktionen und nicht auf Schadenswiedergutmachung gerichteten Auflagen siehe BFH, Urt. v. 16.9.2014 – VIII R 21/11, DStRE 2015, 647; Thürmer, in: Brandis/Heuermann EStG, § 4 Rn. 210 ff.; Drüen, in: Brandis/Heuermann EStG, § 4 Rn. 875 ff.; Heuel/Matthey, ZWH 2020, 64, 73; Höpfner, PStR 2015, 127. |
| Verdeckte Gewinnausschüttung (§ 8 Abs. 3 S. 2 KStG, § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG) | Die Übernahme von Verteidigungskosten eines Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft stellt eine verdeckte Gewinnausschüttung dar, welche den Gewinn der Gesellschaft nicht mindern darf und beim Gesellschafter zu steuerpflichtigen Einkünften führt, soweit diese durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Eine verdeckte Gewinnausschüttung kann insbesondere bei einem außerbetrieblichen Tatvorwurf gegen den Gesellschafter und einem zugleich fehlenden Betriebsinteresse an der Verteidigung gegen den Tatvorwurf vorliegen. | Heuel/Matthey ZWH 2020, 64 (70); Biesgen, steueranwaltsmagazin 2014, 158, 163. |
2. Lohnsteuerpflicht des Arbeitgebers
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Übernahme von Anwaltskosten durch den Arbeitgebers als Arbeitslohn (§ 19 Abs. 1 S. 1 EStG i.V.m. § 2 Abs. 1 LStDV, §§ 38 ff. EStG) | Der Arbeitslohn umfasst alle Einnahmen und sonstigen Vorteile, die dem Arbeitnehmer fürseine Beschäftigung zufließen. Maßgeblich ist das Veranlassungsprinzip und der Entlohnungscharakter. Eine Veranlassung durch das Arbeitsverhältnis besteht, wenn der dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zugewendete Vorteile mit Rücksicht auf das Arbeitsverhältnis zufließt. Ein Entlohnungscharakter ist gegeben, wenn der zugewendete Vorteil sich im weitesten Sinne als Gegenleistung für die Arbeitskraft darstellt. Die Zahlung von Verteidigungskosten durch den Arbeitgeber ist demnach kein steuerbarer Arbeitslohn, wenn der Arbeitnehmer ohnehin einen Anspruch auf Kostenerstattung hat, den der Arbeitgeber erfüllt. § 3 Nr. 50 Alt. 2 EStG ordnet (insoweit deklaratorisch und entbehrlich) die Steuerfreiheit von Auslagenersatz an. Das sind die Fälle, in denen das Ermittlungsverfahren bzw. der Tatvorwurf gegen den Arbeitnehmer unmittelbar aus seiner betrieblichen/beruflichen Tätigkeit erklärbar und durch sein berufliches (Fehl-)Verhalten veranlasst ist, unabhängig davon ob der Vorwurf zu Recht oder zu Unrecht erhoben worden ist. Arbeitslohn liegt dagegen vor, wenn der Tatvorwurf dem Privatbereich ohne beruflichen Bezug zuzuordnen ist oder auf privaten Umständen beruht, welche einen Berufszusammenhang aufheben oder überlagern. Unter letzteres fallen Konstellationen, in denen · die Tat nur bei Gelegenheit der Arbeitstätigkeit begangen worden ist, · der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber vorsätzlich schädigen wollte oder · der Arbeitnehmer sich oder einen Dritten bereichern wollte. Übernimmt der Arbeitgeber in diesen Fällen (freiwillig) die Verteidigungskosten geschieht dies mit Rücksicht auf das Arbeitsverhältnis. Der Arbeitnehmer erspart sich die Aufwendungen für seine Verteidigung. Bei der Zeugenbeistand dürften (auch wenn dies im Einzelnen nicht entschieden ist) die obigen Grundsätze entsprechend gelten. | BFH, Beschl. v. 17.8.2011 – VI R 75/10, DStR 2011, 2235; Beckschäfer, ZWH, 2012, 345; Heuel/Matthey, ZWH 2020, 64, 68; Stetter, in: MAH StV § 44 Rn. 98. Zu denselben Ergebnissen gelangt man, wenn man – bei entsprechender Anwendung der Rechtsprechung zur Übernahme von Sanktionen – das Arbeitnehmerinteresse an der Kostenübernahme (bspw. Verhältnis von Kosten zur Arbeitnehmervergütung) mit dem eigenbetrieblichen Arbeitgeberinteresse (bspw. Reputation) an der Verteidigung abwägt. Bei ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers liegt kein Arbeitslohn vor (BFH, Urt. v. 22.7.2008 – VI R 47/06, NJW, 2009, 1167; Urt. v. 14.11.2013 – VI R 36/12, DStR 2014, 136; Biesgen, steueranwaltsmagazin 2014, 158, 161 ff.; Höpfner, PStR 2015, 127, 131). |
| Nettolohnvereinbarung | Übernimmt das Unternehmen als Arbeitgeber auch die auf die Kostenübernahme entfallende Lohnsteuer, handelt es sich um eine sogenannte Nettolohnvereinbarung. Die zusätzlich übernommene Lohnsteuer stellt ebenfalls Arbeitslohn dar und ist bei der Lohnsteuer zu berücksichtigen. | Heuel/Matthey, ZWH 2020, 64, 73. |
3. Vorsteuerabzug des kostentragenden Unternehmens
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Kein Vorsteuerabzug des kostentragenden Unternehmens (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG) | Es besteht kein Vorsteuerabzug des Unternehmens für Anwaltskosten, wenn der Zweck der Anwaltsdienstleistung bzw. Verteidigung darin besteht, strafrechtliche Sanktionen gegen Personen zu vermeiden, auch wenn diese Mitglied der Geschäftsleitung oder Mitarbeiter des Unternehmens sind. Es wird keine Leistung für das Unternehmen im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG ausgeführt. Es fehlt am direkten und unmittelbaren Zusammenhang zwischen der anwaltlichen Verteidigung (Eingangsleistung) und der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens (Ausgangsleistung). Für die umsatzsteuerliche Beurteilung ist es ohne Belang, welche konkrete Tat der Geschäftsführung bzw. den Mitarbeiter vorgeworfen wird, ob der Vorwurf dem betrieblichen Bereich zuzuordnen ist oder das Unternehmen gegenüber der betroffenen Person zur Kostenübernahme verpflichtet ist. Die zum Vorsteuerabzug ergangene Rechtsprechung betrifft Verteidigungskosten. Ob die Voraussetzungen zum Vorsteuerabzug bei der Übernahme von Zeugenbeistandskosten vorliegen, ist nicht entschieden. | BFH, Urt. v. 11.4.2013 – V R 29/10, DStRE 2012, 577; EuGH, Urt. v. 21.2.2013 – C-104/12, DStR 2013, 411 m. Anm. Zugmaier; Beckschäfer, ZWH 2013, 324; Biesgen, steueranwaltsmagazin 2014, 158, 160. Ein Vorsteuerabzug ist dagegen bei der „Unternehmensverteidigung“ möglich, wenn zwischen dem Unternehmen und dem Verteidiger ein Mandatsverhältnis zur rechtlichen Interessenwahrnehmung/-vertretung besteht, etwa zur Abwehr einer Geldbuße(§§ 30, 130 OWiG) oder Einziehung (§§ 73 ff. StGB). Heuel/Matthey, ZWH 2020, 64, 67; Stetter, in: MAH StV § 44 Rn. 89. |
4. Rechnungsstellung durch den Verteidiger/Zeugenbeistand
| Problem | Rechtliche Bewertung | Quellen/Vertiefende Hinweise |
| Leistungsempfänger § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 UStG
| Das Unternehmen ist auch dann nicht umsatzsteuerlicherLeistungsempfänger, wenn mit dem Unternehmen eine gesonderte Vergütungsvereinbarung abgeschlossen wird. Leistungsempfänger ist der Mandant, welcher aus dem der Leistung zugrunde liegenden Schuldverhältnis als Auftraggeber berechtigt und verpflichtet ist. Das strafprozessuale Verteidigungs-/Zeugenbeistandsverhältnis besteht mit dem Mandanten selbst. Der Mandant wird daher auch (zur Vermeidung einer etwaigen Unternehmenseinwirkung und Interessenkollision) Auftraggeber bzw. Vertragspartner der Mandatsvereinbarung sein. Eine gesonderte Vergütungsvereinbarung mit dem Unternehmen ändert hieran nichts. | Zur Bestimmung des umsatzsteuerlichen Leistungsempfängers siehe BFH, Urt. v. 28.8.2013 – XI R 4/11, MWStR 2014, 305.
|
| Steuerschuld nach § 14c Abs. 2 S. 2 Alt. 2 UStG | Weist die Anwaltsrechnung das Unternehmen und nicht den Mandanten als Leistungsempfänger aus, soll (neben der geschuldeten Umsatzsteuer für die Leistung an den Mandanten) eine zusätzliche Steuerschuld des Anwalts gemäß § 14c Abs. 2 S. 2 Alt. 2 UStG bestehen können bis eine Rechnungsberichtigung erfolgt ist. | Biesgen, steueranwaltsmagazin 2014, 158, 159; Heuel/Matthey, ZWH 2020, 64, 66. Ob § 14c UStG bei einer Übernahme von Individualverteidigerkosten durch das Unternehmen Anwendung findet, kann in Frage gestellt werden. Eine zu beseitigende Gefährdung des Steueraufkommens im Sinne des § 14c Abs. 2 S. 3, 4 UStG besteht mangels Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmers nicht. Vgl. einschränkende Auslegung des § 14c UStG bei Rechnungen an Endverbraucher EuGH, Urt. v. 8.12.2022 – C-378/21, MwStR, 2023, 227; BMF-Schr. v. 27.2.2024 – III C 2 – S 7282/19/10001 :002, BStBl 2024 I S. 361. |