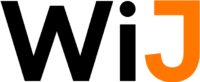Strafrechtliche Risiken bei der Sanktions-Compliance
Teil 2
Der erste Teil des Beitrags befindet sich in der dritten Ausgabe der WiJ (WiJ 03-2024).*
IV. Bekämpfung von Sanktionsumgehung
Bei den neueren Sanktionspaketen steht nebst Erweiterung der schon bestehenden Verbote und Sanktionslisten vor allem die Bekämpfung von Sanktionsumgehungen im Mittelpunkt. Denn seit längerer Zeit ist klar, dass die EU-Sanktionen gegen Russland vor allem über nicht-sanktionierte Drittländer massiv umgangen werden.[1] Die Umgehung von Sanktionen ist jedoch selbst auch verboten und trotz einiger Unsicherheiten mit nicht zu unterschätzenden Strafbarkeitsrisiken verbunden (siehe I.). Unternehmen müssen dabei eine eher unübersichtliche Compliance-Risikolandschaft navigieren, welche durch das 14. Sanktionspaket mit der Einführung bzw. Erweiterung von Sorgfaltspflichten zusätzlich an Komplexität gewann (siehe II.).
1. Umgehungsverbot als Ausgangspunkt
Ein von den meisten Sanktionstexten selbst vorgesehenes Umgehungsverbot stellt den Ausgangspunkt der Bekämpfung von Sanktionsumgehungen dar. Mit diesem sollen Handlungen beschränkt werden, die formal zwar nicht sanktioniert sind, aber in ihrer Wirkung den explizit verbotenen Handlungen gleichkommen.[2] Umgehungsverbote setzen also eine Art Ausgangsverbotstatbestand voraus, der durch die in Rede stehende Handlung umgangen wird oder werden soll – wie zum Beispiel eines der zahlreichen Ausfuhrverbote der Russland-VO (siehe I. 2.). So lautet bspw. Art. 12 der Russland-VO in seiner neuen Fassung:
„Es ist verboten, sich wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten zu beteiligen, mit denen die Umgehung der in dieser Verordnung vorgesehenen Verbote bezweckt oder bewirkt wird, auch wenn mit der Beteiligung an solchen Tätigkeiten dieser Zweck oder diese Wirkung nicht absichtlich angestrebt wird, es aber für möglich gehalten wird, dass sie diesen Zweck oder diese Wirkung hat, und diese Möglichkeit billigend in Kauf genommen wird.“[3]
Das so normierte Umgehungsverbot wurde durch das 14. Sanktionspaket jüngst erweitert, sodass nun auch die billigende Inkaufnahme von Sanktionsumgehungen explizit erfasst ist. Mithin genügt jetzt zweifelsfrei dolus eventualis. Tatsächlich ist diese ausdrückliche Berücksichtigung der billigenden Inkaufnahme aber eher als eine Klarstellung zu sehen. Der EuGH hatte nämlich schon in Bezug auf das Umgehungsverbot der (mittlerweile aufgehobenen) Iran-Sanktionsverordnung VO (EG) Nr. 423/2007 befunden,[4] dass das Wissens- und Wollenselement des Umgehungsverbots ebenfalls bei einer billigenden Inkaufnahme der Möglichkeit einer Umgehungswirkung erfüllt sei.[5] Das vom EuGH analysierte Umgehungsverbot ist mit dem Umgehungsverbot der Russland-VO in seiner Fassung vor dem 14. Sanktionspaket fast identisch, sodass eine entsprechende Lesart nahelag. Die EU-Kommission schien dies in ihrer Auslegung aber bisher nicht zu berücksichtigen,[6] weshalb der Unions-Gesetzgeber dies nun wohl ausdrücklich klarstellen wollte.[7]
Das Umgehungsverbot der Finanzsanktions-VO in dessen Art. 9 wurde auf die gleiche Weise geändert.[8] Jenes ist besonders im Hinblick auf die von der EU angestrebte Harmonisierung der strafrechtlichen Sanktionierung von Sanktionsverstößen relevant, da die in diesem Zusammenhang jüngst verabschiedete Richtlinie (siehe II. 2.) vor allem auf von Art. 9 Finanzsanktions-VO erfasste Umgehungshandlungen in Bezug auf eingefrorene oder zu meldende Vermögenswerte Bezug nimmt.[9]
Trotz reger legislativer Aufmerksamkeit und Aktivität zur Bekämpfung von Sanktionsumgehungen bestehen aber weiterhin zahlreiche Unklarheiten. So ist der Akt der Umgehung selbst nicht abschließend definiert und lässt sich bislang nur grob umreißen. Der EuGH geht zum Beispiel grundsätzlich davon aus, dass von Sanktionsumgehungsverboten solche Handlungen erfasst werden sollen, die
„unter dem Deckmantel einer Form vorgenommen werden, mit der eine Erfüllung des Tatbestands eines Verstoßes […] vermieden wird […], die jedoch als solche oder aufgrund ihres eventuellen Zusammenhangs mit anderen Aktivitäten unmittelbar oder mittelbar bezwecken oder bewirken, das […] Verbot auszuhebeln.“[10]
Ferner lassen sich ausgehend von der Praxis typische Umgehungs-Fallgruppen bilden. Jedoch untersagen viele der oft sehr weiten güterbezogenen Verbote explizit auch mittelbare Begehensweisen, ebenso wie bspw. die Ausfuhr „zur Verwendung in Russland“.[11] Laut EU-Kommission soll ebendiese Formulierung „zur Verwendung“[12] Sanktionsumgehungen verhindern, sodass teilweise von neben dem allgemeinen Umgehungsverbot bestehenden tatbestandsimmanenten Umgehungsverboten gesprochen wird.[13] In der Praxis ist aber oft nicht eindeutig, ab wann bei den typischen Fallgruppen bspw. ein (mittelbares) Ausfuhrverbot ausgehebelt und eine Umgehung stattfinden würde. Trotz dieser fließend verlaufenden Grenzen können diese typischen Umgehungskonstellationen als nützlicher Ausgangspunkt für Risikoanalysen von Unternehmen herangezogen werden (a.), da auch im Kontext von Sanktionsumgehungen strafrechtliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können (b.).
a) Typische Umgehungskonstellationen
aa) Verschleierung des Ursprungs zur Umgehung von Einfuhrverboten
Zur Umgehung der zahlreichen gegen seine zentralen Einnahmequellen gerichteten europäischen Einfuhrverbote greift Russland vermehrt zu Verschleierungsstrategien, um gewisse Produkte trotz der Sanktionen zum wichtigen EU-Absatzmarkt zu bringen. Die Umgehung der Einfuhrverbote ist unter anderem ein Thema bei russischem Holz, das vor allem über chinesische Holzhändler und Fabrikanten seinen Weg in die EU finden soll.[14] Hochwertiges russisches Birkenholz soll dabei in chinesischen Fabriken weiterverarbeitet oder nur umetikettiert und dann in die Union eingeführt werden.
Für Holz und Holzwaren besteht jedoch ein Einfuhrverbot, wenn diese russischen Ursprungs sind oder aus Russland ausgeführt werden.[15] Dabei kann sowohl die Umetikettierung als auch die Weiterverarbeitung in China als verbotene Umgehung des Einfuhrverbots bewertet werden. Durch die reine Umetikettierung und Ausfuhr aus China wird der russische Ursprung der Ware nur verschleiert, die Einfuhr geschieht somit „unter dem Deckmantel einer Form“,[16] mit der die Erfüllung des Einfuhrverbotstatbestands vermieden wird – bei dieser Konstellation könnte jedoch wohl auch vertreten werden, dass noch eine verbotene mittelbare Einfuhr vorliegt und nicht schon eine Umgehung des Einfuhrverbots. Wird das Holz in China hingegen weiterverarbeitet, kann es zollrechtlich als chinesischen Ursprungs gelten, sofern wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Verarbeitungen ursprungsbegründend wirken.[17] Die nun weiterverarbeitete Holzware wäre nicht mehr von dem Tatbestand des Einfuhrverbots erfasst, da sie weder russischen Ursprungs ist noch aus Russland ausgeführt wird. Erfolgt diese Weiterverarbeitung und darauffolgende Einfuhr in die EU über Drittländer aber alleine zu dem Zweck, nicht unter das Einfuhrverbot zu fallen, so liegt wohl eine verbotene Umgehung desselben vor. [18]
bb) Zwischenschaltung mehrerer Personen zur Umgehung von Ausfuhrverboten
Die Ausfuhrverbote der Russlandsanktionen werden auch oft durch die Zwischenschaltung von Personen, insbesondere in Drittländern, umgangen. Russland als das eigentliche Ziel der Ausfuhr wird dabei dadurch verschleiert, dass mehrere Zwischentransaktionen unter Einschaltung von Dritten in nicht sanktionierten Drittstaaten durchgeführt werden, bevor die Güter nach Russland gelangen. Auch von deutschen Unternehmen gefertigte Elektronikkomponenten sollen so über Tarnfirmen ihren Weg zur russischen Rüstungsindustrie gefunden haben, obwohl diese Güter strengen Ausfuhrverboten unterliegen.[19]
Bei diesen Konstellationen ist es jedoch oft schwer zu beurteilen, ob das Ausfuhrverbot noch greift oder ob schon eine Umgehung dessen stattfand. Wie schon angedeutet, untersagen die meisten Ausfuhrverbote, wie beispielsweise auch das Ausfuhrverbot für Dual-Use-Güter, ausdrücklich auch mittelbare Ausfuhren und Lieferungen nach Russland.[20] Es ist aber nicht eindeutig, wie weit nun eine solche mittelbare Ausfuhr reicht. Das Ausfuhrverbot ist weit auszulegen, sodass Zwischentransaktionen bis zum Eintreffen der Ware in Russland als noch vom Ausfuhrverbot erfasst gesehen werden könnten. Damit wäre das Umgehungsverbot in solchen Konstellationen aber wohl praktisch bedeutungslos. Problematisch wird diese unklare Abgrenzung vor allem in Hinblick auf die mögliche Strafbewehrung solcher Konstellationen (siehe IV. 1. b)). Zugleich ist es in der Praxis für Exporteure oft schwer (wenn nicht sogar unmöglich) zu beurteilen, ob eine reguläre transnationale Transaktion am Ende doch einen sanktionierten Bezug zu Russland aufweist. Dies könnte aber jedenfalls, ob nun gegen das Ausfuhr- oder das Umgehungsverbot, in objektiver Hinsicht einen Sanktionsverstoß bedeuten.
cc) Täuschung zur Umgehung von Ausfuhrverboten bzw. Genehmigungspflichten
Ausfuhrverbote können auch durch Täuschungen umgangen werden. Typischerweise beantragt in solchen Konstellationen ein Unternehmen eine Ausfuhrgenehmigung unter Angabe falscher Informationen, bspw. um von Ausnahmeregelungen eines Verbots zu profitieren. Die für die Genehmigung zuständige Behörde legt daraufhin diese falschen Angaben ihrer Entscheidung zugrunde und genehmigt die Ausfuhr. Mithin wird bei solchen Fällen die Ausfuhr auch „unter dem Deckmantel einer Form vorgenommen (…), mit der eine Erfüllung desTatbestands eines Verstoßes (…) vermieden wird“,[21] indem die Erfüllung des Ausfuhrverbotstatbestands durch die erschlichene Genehmigung umgangen wird. Namhaftes Beispiel in der Rechtsprechung ist dabei der Fall des deutschen Rüstungsunternehmens Heckler & Koch: Dessen Mitarbeiter erwirkten unter falschen Angaben zum Endverbleib von Waffenlieferungen in Mexiko eine Ausfuhrgenehmigung. Diese wäre ohne die Täuschung jedoch wahrscheinlich nie ergangen, da die Lieferung in Wirklichkeit an mexikanische Bundesstaaten mit bedenklicher Menschenrechtslage erfolgen sollte, wogegen Bedenken der zuständigen Ministerien bestanden. Durch die Täuschung wurde der Verstoß gegen ein Ausfuhrverbot bzw. eine Genehmigungspflicht umgangen. In der Konsequenz wurden die beteiligten Mitarbeiter nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 AWG für Verstöße gegen ein Ausfuhrverbot bzw. gegen eine Genehmigungspflicht strafrechtlich verurteilt; der BGH hat die Verurteilung bestätigt.[22]
dd) Umgehung des Verbots der technischen Hilfe
Vor allem nach Ansicht des BAFA können auch flankierende Verbote, wie das Verbot der Erbringung technischer Hilfe, umgangen werden. Technische Hilfe im Sinne der Russland-Sanktionen umfasst
„jede technische Unterstützung im Zusammenhang mit Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, Montage, Erprobung, Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleistung; technische Hilfe kann in Form von Anleitung, Beratung, Ausbildung, Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fertigkeiten oder in Form von Beratungsdiensten erfolgen und schließt auch Hilfe in verbaler Form ein“.[23]
So soll verhindert werden, dass EU-Unternehmen das sanktionierte Land dabei unterstützen, gelistete Güter selbst herzustellen oder auch deren Lebenszeit durch Reparatur zu verlängern. Dadurch würde das zentrale Ziel des jeweiligen Ausfuhrverbots konterkariert, das sanktionierte Land vom Zugang zu solchen (nutzbaren) Gütern abzuschneiden.
Nach Auffassung des BAFA wird dieses Verbot der technischen Hilfe aber umgegangen, sobald nicht gelistete Ersatzteile für die Reparatur eines seinerseits sanktionierten Gutes geliefert werden.[24] Diese Auffassung äußerte das BAFA bisher nur explizit in Bezug auf die Iran-Embargo-Verordnung (EG) Nr. 423/2007: „Ersatzteil-Lieferungen, die vorsätzlich und willentlich zur Reparatur eines gelisteten Guts erfolgten, seien daher als Umgehung verboten.“[25] Das schlägt sich jedoch auch als marktbekannte Praxis der Exportkontrollbehörden im Umgang mit den Russland-Sanktionen nieder.[26] Dabei scheint das BAFA sogar pauschal bei der Lieferung von Ersatzteilen eine Umgehung anzunehmen und begründet auf diese Weise die Ablehnung von Nullbescheid-Anträgen für solche Lieferungen. Diese grundsätzliche Einstufung von Ersatzteillieferungen für sanktionierte Güter als Umgehung des Verbots der technischen Hilfe wurde zudem vor kurzem auch von BAFA-Mitarbeitern in einer Fachzeitschrift explizit bestätigt.[27] Darüber hinaus scheint es in Anbetracht des weiten Umgehungsverbots naheliegend, dass das BAFA seine Auffassung beibehalten wird – die bloße billigende Inkaufnahme der Möglichkeit einer Reparatur mithilfe der gelieferten Ersatzteile könnte danach genügen, um eine verbotene Umgehung des Verbots der technischen Hilfe anzunehmen.
Die Lesart der BAFA ist nach unserem Verständnis zu weit. Die pauschale Annahme einer Umgehung widerspricht unseres Erachtens der Intention des europäischen Gesetzgebers und der Regelungssystematik der Russland-VO.[28] Gleichzeitig birgt sie das Risiko einer uferlosen Ausweitung der Sanktionen. Der Bestand an mit Ausfuhrverboten belegten Gütern ist abschließend geregelt und erfasst auch teilweise bestimmte explizit gelistete Ersatzteile, oft verbunden mit bestimmten Mindestwertgrenzen oder gesonderten Anforderungen.[29] Durch die Auslegung des BAFA wird aber dieser Bestand an von Ausfuhrverboten betroffenen Gütern über den Umweg des Umgehungsverbots und des Verbots der technischen Hilfe auf bedenkenswerte Weise ausgeweitet.[30] Außerdem bringt diese Sicht erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich, da Ausführer ihre Produkte nicht mehr verlässlich mit den Güterlisten der Sanktionen abgleichen können, sondern zusätzlich die ungeschriebene Erstreckung auf weitere Güter fürchten müssen.[31] Da so nicht erkennbar ist, welches Verhalten verboten ist, ist diese Auslegung nach unserem Verständnis nicht mit dem Bestimmtheitsgebot vereinbar. Dies wird umso deutlicher, wenn zudem die mögliche Strafbewehrung von Sanktionsumgehungen berücksichtigt wird.
b) Strafbarkeit von Verstößen gegen das Umgehungsverbot
Während die Strafbewehrung von Verstößen gegen die Ausfuhrverbote klar geregelt ist (siehe II.), bleibt die strafrechtliche Sanktionierung von Verstößen gegen das Umgehungsverbot von Unsicherheiten geplagt. So enthält das Außenwirtschaftsstrafrecht seit der AWG-Novelle 2013 keine explizite Strafbewehrung von Umgehungshandlungen. Der § 34 Abs. 1 Nr. 1 AWG a.F. hatte Verstöße gegen das Umgehungsverbot noch explizit strafbewehrt, wurde aber im Zuge der Neufassung des § 18 AWG gestrichen. Der deutsche Gesetzgeber reagierte damit auf die Bedenken der Rechtsprechung hinsichtlich der Bestimmtheit des Tatbestandsmerkmals der Umgehung.[32] Gleichzeitig sah der Gesetzgeber Umgehungskonstellationen trotz des Wegfalls der expliziten Strafbewehrung als immer noch zureichend strafrechtlich erfasst – und verstrickt sich dabei scheinbar in eine Fehlinterpretation der EuGH-Rechtsprechung:
Eine explizite Strafbewehrung von Umgehungshandlungen sei nicht nötig, da das in § 18 Abs. 1 Nr. 1 a) Var. 8 AWG n.F. enthaltene Bereitstellungsverbot weit auszulegen sei und es ermögliche, Umgehungshandlungen als vollendete oder versuchte Bereitstellungen strafrechtlich zu erfassen.[33] Erfasst seien so zum Beispiel „Lieferungen von wirtschaftlichen Ressourcen an gelistete Personen über Dritte oder Ausfuhren aus der BRD (über) sonstige Drittländer in der Absicht, diese von dort an Gelistete weiterzuliefern (…)“.[34] Ebenso seien damit Umgehungen der „direkten und indirekten Liefer-, Kauf-, Weitergabe- und Ausfuhrverbote von Gütern nach EU-Embargoverordnungen“ zureichend strafbewehrt.[35]
Für diese weite Lesart des Bereitstellungsverbots berief sich der Gesetzgeber auf die Rechtsprechung: Zum einen sei mit Verweis auf den BGH „Bereitstellen“ deckungsgleich mit „zur Verfügung stellen“.[36] Zurverfügungstellen (und damit auch Bereitstellen) sei dabei nach dem EuGH so umfassend auszulegen, dass es jede Handlung erfasse, die erforderlich ist, damit eine Person die Verfügungsbefugnis über einen betreffenden Vermögenswert erlangen kann.[37] Jedoch zieht der Gesetzgeber aus dem EuGH-Urteil nach unserem Verständnis nicht die richtigen Schlüsse. Er verkennt, wie das gleiche Urteil einige Randnummern später ausdrücklich klarstellt, dass das Bereitstellungsverbot und das Umgehungsverbot unterschiedliche Handlungen erfassen müssen.[38] Andernfalls hätte das Umgehungsverbot keine eigenständige Bedeutung und liefe praktisch ins Leere.[39] Vor diesem Hintergrund erschließt sich nicht, wieso der deutsche Gesetzgeber ausgerechnet mit dieser Begründung die Strafbewehrung von Umgehungshandlungen innerhalb der Strafbewehrung von Verstößen gegen das Bereitstellungsverbot lokalisieren will. Darüber hinaus kann durchaus in Zweifel gezogen werden, ob die gewählte Lösung im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot wirklich überzeugender als die Rechtslage vor der Novelle ist. [40]
Abgesehen von der Suche nach der rechtsdogmatisch sinnvollen Verortung der Strafbewehrung von Umgehungskonstellation bestehen Strafbarkeitsrisiken ohnehin angesichts des wie bereits beschrieben oft fließenden Übergangs zwischen mittelbaren Verhaltensweisen und Umgehungstatbeständen (siehe IV. 1. a) bb)).[41]
Weiter ist die Umgehung von Genehmigungspflichten durch Täuschung vergleichsweise klar strafbewehrt – wenn auch nicht als Verstoß gegen das Umgehungsverbot. § 18 Abs. 9 AWG stellt das Handeln (zum Beispiel eine Ausfuhr) auf Grundlage einer durch unrichtige oder unvollständige Angaben erschlichenen Genehmigung, dem Handeln ohne Genehmigung, mithin einem Verstoß gegen Genehmigungspflichten i.S.d. § 18 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 AWG, gleich.
Schließlich besteht die Möglichkeit einer strafrechtlichen Zurechnung der Umgehungshandlungen, auf die der Gesetzgeber selbst hinweist.[42] Die Grundsätze zur Strafbarkeit von mittelbarer Täterschaft, Anstiftung, Beihilfe und Versuch seien ebenso für Umgehungen der Ausfuhr-, Liefer-, Kauf- und Weitergabeverbote gültig (siehe III.).[43] Daher besteht für Umgehungshandlungen, wie zum Beispiel bei der verbotenen Einfuhr von russischem Holz über den nicht sanktionierten Drittstaat China, für sämtliche Beteiligte ohnehin ein nicht unerhebliches Risiko als Täter bzw. Teilnehmer nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 a) AWG straffällig zu werden.[44]
Die kürzlich verabschiedete EU-Richtlinie zur Harmonisierung der strafrechtlichen Sanktionierung von Sanktionsverstößen hätte für mehr Klarheit bei der Strafbarkeit von Sanktionsumgehungen sorgen können, tut dies aber leider nur in begrenztem Maße. Art. 3 Abs. 1 lit. h) Richtlinie (EU) Nr. 2024/1226 verlangt insofern, dass gewisse Umgehungskonstellationen im Zusammenhang mit auf Finanzsanktionen zurückzuführende eingefrorene Vermögenswerte und Meldepflichten unter Strafe zu stellen sind. Damit knüpft die Richtlinie wie schon angedeutet primär an das Umgehungsverbot in Art. 9 Finanzsanktions-VO an.[45] Für die Umgehung anderer zentraler restriktiver Maßnahmen wie die Ausfuhrverbote der Russland-VO ist die Richtlinie aber kaum aufschlussreich.
2. Sorgfaltspflichten und andere flankierende Maßnahmen
Insbesondere im Hinblick auf die Umgehung der Sanktionen wird von Unternehmen ein hohes Maß an Sorgfalt erwartet. Bei der Sanktions-Compliance gibt es jedoch keine „one-size-fits-all“-Herangehensweise. Die Beachtung von sanktionsbezogenen Sorgfaltspflichten setzt vielmehr unternehmensindividuelle und einzelfallbezogene Maßnahmen zur Analyse und Minimierung von Risiken voraus. Der grundlegende Haftungsrahmen wird durch die einzelnen Sanktionsverordnungen vorgegeben, so zum Beispiel von Art. 10 der Russland-VO:
„Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen können für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme hatten, dass sie mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser Verordnung verstoßen.“
Nach Auffassung des BMWK müssen Ausführer alle ihnen zur Verfügung stehende Informationen ausschöpfen, ein „bewusstes Sich-Verschließen“[46] vor sich ihnen aufdrängenden Umständen könne je nach Fallkonstellation einer Kenntnis gleichgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass die EU-Kommission und nationale Behörden Unternehmen diverse Hilfestellungen zur Identifikation und Bewältigung von Sorgfaltspflichten bieten, indem sie ihre Auslegung der jeweiligen Vorschriften, häufig aufkommende Fragen und Antworten sowie Hinweise auf besonders präsente Risiken (bspw. zu hohen Umgehungsrisiken bei Beteiligung von Ländern mit engen Beziehungen zu Russland) veröffentlichen. Abgesehen davon, dass diese Hilfestellungen keine rechtsverbindliche und allgemeingültige Auskunft bieten können, sind sie auch nicht immer frei von Widersprüchen und sorgen teilweise für zusätzliche Verwirrung.[47]
Mittlerweile wird das Umgehungsverbot der Russland-VO seinerseits von diversen flankierenden Maßnahmen begleitet, die die Sorgfaltspflichten der Unternehmen regulatorisch reflektieren und konkretisieren. Diese sollen weiter bestehende Sanktionsumgehungsrisiken möglichst reduzieren, indem Unternehmen zu größerer Sorgfalt insbesondere in Bezug auf ihre Tochterunternehmen (siehe a.), im Zusammenhang mit kriegswichtigen Gütern (siehe b.) und im Verhältnis mit ihren Geschäftspartnern (siehe c.) verpflichtet werden.
a) Sorgfaltspflichten in Bezug auf Tochterunternehmen
Das 14. Sanktionspaket führte mit einem neuen Art. 8a Russland-VO weitere Sorgfaltspflichten für EU-Unternehmen ein.[48] Diese sollen sich nun „nach besten Kräften“[49] („best efforts“) bemühen sicherzustellen, dass ihre in Drittstaaten niedergelassene Tochterunternehmen sich nicht an Umgehungshandlungen beteiligen. Der Wortlaut der Vorschrift bleibt eher vage, sodass die Auslegungspraxis der jeweiligen Behörden von zentraler Bedeutung sein wird. Ebenso sollte mit zeitnahen Hilfestellungen der EU-Kommission oder nationaler Behörden zu rechnen sein. Dabei ist zu hoffen, dass in diesem Rahmen die jetzt schon erkennbaren Unklarheiten der Vorschrift behoben werden können:
Zum einen ist der Anwendungsbereich der Vorschrift nicht eindeutig. Nach dem Wortlaut sind natürliche und juristische Personen betroffen, wenn sich außerhalb der Union niedergelassene juristische Personen in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle befinden.[50] Damit wären Tochterunternehmen erfasst, an denen der EU-Wirtschaftsteilnehmer mehr als 50 % der Anteile hält oder die er auf andere Weise kontrolliert.[51] Der Wortlaut stellt hingegen nicht klar, ob auch mittelbare Eigentums- bzw. Kontrollstrukturen an Tochterunternehmen erfasst sind. Dagegen erfassen einige Vorschriften der Russland-VO explizit sowohl unmittelbare als auch mittelbare Tochterunternehmen, vor allem wenn Eigentums- oder Kontrollverhältnisse mit russischer Beteiligung Bestandteil der jeweiligen Tatbestände sind.[52] Vor diesem Hintergrund kann wohl vorerst angenommen werden, dass nur direkte Tochterunternehmen von dem neuen Art. 8a Russland-VO erfasst werden sollen. Dafür spricht auch, dass angesichts der statuierten Sorgfaltspflicht dem EU-Wirtschaftsteilnehmer notwendigerweise auch entsprechend wirksame Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten über das Tochterunternehmen zur Verfügung stehen müssten, damit dieser seiner Pflicht nachkommen kann.[53] Nichtsdestotrotz ist der EU-Wirtschaftsteilnehmer wohl jedenfalls dazu gehalten, den erfassten Tochterunternehmen entsprechende Anweisungen zu erteilen, dass diese sich ihrerseits nicht an Sanktionsumgehungshandlungen beteiligen.
Ferner ist auch das erwartete Sorgfaltsniveau nicht klar. Klar dürfte sein, dass die Anti-Umgehungssorgfaltspflicht in Bezug auf Tochterunternehmen nicht grenzenlos ist und sich maßgeblich nach der Umgehungsrisikoexposition des jeweiligen Tochterunternehmens richtet. Erwartet werden Maßnahmen, die geeignet und notwendig sind, um Umgehungen zu verhindern.[54] Darunter können Strategien, Kontrollen und Verfahren fallen, durch die Umgehungsrisiken gemindert werden können, die aber auch den Umständen des jeweiligen Tochterunternehmens Rechnung tragen.[55] Hervorzuheben ist zudem, dass die Reichweite der verlangten „besten Kräfte“ jedenfalls durch fehlende Kontrolle über das Tochterunternehmen aus nicht von dem EU-Wirtschaftsteilnehmer verursachten Gründen begrenzt ist.[56] Dabei verweisen die Erwägungsgründe explizit auf Rechtsvorschriften eines Drittlands.[57] Dies scheint insbesondere den Konstellationen Rechnung zu tragen, in denen EU-Unternehmen noch Verbindungen zu russischen Tochterunternehmen haben, die ihrerseits aufgrund der russischen Gegensanktionen dazu gehalten sein können, die EU-Maßnahmen nicht zu beachten.
Nach unserem Verständnis dürften EU-Unternehmen auch nicht dazu gehalten sein, jegliche (insbesondere kleinere oder versehentliche) Sanktionsverstöße ihrer Tochterunternehmen zu verhindern. Ausgehend vom Wortlaut der neuen Vorschrift soll verhindert werden, dass sich erfasste Tochterunternehmen an Handlungen beteiligen, die die Sanktionen der Russland-VO „untergraben“.[58] Untergraben („undermine“) umfasst dabei Handlungen oder Vorgänge, die „nach und nach an der Vernichtung von etwas arbeiten“.[59] Die Wortwahl deutet also darauf hin, dass nur systematische oder zumindest auf Dauer wiederholt auftretende und damit die Wirksamkeit der Sanktionen nachhaltig schwächende Verstöße erfasst werden sollen. Besonders schwerwiegende Verstöße der Tochterunternehmen (wie die Lieferung kriegswichtiger Güter) dürften zweifelsohne erfasst sein, sodass das EU-Unternehmen auch dafür verantwortlich gemacht werden könnten.
Letztlich ist für etwaige Verstöße gegen diese Sorgfaltspflicht derzeit zumindest keine explizite Strafbewehrung oder Androhung von ordnungswidrigkeitsrechtlichen Sanktionen ersichtlich. Mögliche Strafbarkeits- bzw. Bußgeldrisiken könnten jedoch wie bereits erwähnt unter anderem über die strafrechtlichen Zurechnungsgrundsätze herrühren: So könnte zum Beispiel ein Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht und dadurch ermöglichte Umgehungshandlungen des Tochterunternehmens als fahrlässiger Sanktionsverstoß oder Tatbeteiligung gewertet werden. Wird das EU-Unternehmen trotz erkennbarer Umgehungsrisiken nicht aktiv, könnten Ermittlungsbehörden dem Ausführer auch vorwerfen, mit Eventualvorsatz gehandelt und sich damit nach § 18 Abs. 1 AWG strafbar gemacht zu haben. Jedenfalls zu befürchten wären aber wohl verwaltungsrechtliche Konsequenzen wie der Entzug zollrechtlicher Privilegien, da der EU-Wirtschaftsteilnehmer mit dem Verstoß seine Zuverlässigkeit in Frage stellen würde.[60]
Am Rande sei bemerkt, dass durch die neue Vorschrift nun faktisch Teile der EU-Russland-Sanktionen auf in Drittstaaten niedergelassene Tochterunternehmen von EU-Unternehmen (und damit weltweit) ausgeweitet werden, obwohl diese nicht in den Anwendungsbereich der Sanktionen fallen sollten.[61] Diese extraterritoriale Wirkung von Sanktionen hatte die EU in Bezug auf entsprechende US-Sanktionen häufig kritisiert[62] – angesichts der anhaltenden Sanktionsumgehung sah die EU sich aber nun wohl zu einem Paradigmenwechsel gezwungen – auch wenn im Diskurs noch daran festgehalten wird, dass es sich hierbei nicht um eine extraterritoriale Wirkung der Sanktionen handelt.
b) Sorgfaltspflichten in Bezug auf kriegswichtige Güter
Der ebenfalls mit dem 14. Sanktionspaket neu eingefügte Art. 12gb der Russland-VO verlangt von EU-Unternehmen ab dem 26. Dezember 2024 erhöhte Sorgfalt, wenn sie kriegswichtige Güter oder Technologien verkaufen, liefern, verbringen oder ausführen.[63] Dies betrifft die Liste der sogenannten „gemeinsamen Güter mit hoher Priorität“ („common high priority items“), worunter zum Beispiel Halbleiterbauelemente oder optische Instrumente fallen, da sie Bestandteile wichtiger russischer Waffensysteme sind.[64] Die EU hatte schon zuvor darauf hingewiesen, dass beim Vertrieb dieser Güter eine erhöhte Sorgfalt anzuwenden ist, da einige trotz der weitreichenden Verbote immer noch zum russischen Militär gelangten.[65] Nun wurde diese erhöhte Sorgfalt auch rechtlich vorgeschrieben.
EU-Unternehmen müssen Risikoermittlungen und Risikobewertungen hinsichtlich möglicher Ausfuhren der relevanten Güter nach Russland bzw. einer möglichen Verwendung in Russland vornehmen und dokumentieren.[66] Daraufhin müssen EU-Unternehmen Maßnahmen zum wirksamen Management und zur Minderung der identifizierten Risiken ergreifen.[67] Ähnlich wie bei den Anti-Umgehungssorgfaltspflichten in Bezug auf ihre Tochterunternehmen müssen die Unternehmen „geeignete Strategien, Kontrollen und Verfahren“ umsetzen, die im Verhältnis zu der Art und Größe dieser Risken stehen.[68]
Konsequenterweise erstreckt sich diese Sorgfaltspflicht auch auf die in Drittstaaten niedergelassenen Tochterunternehmen der EU-Unternehmen, falls diese ebenfalls kriegswichtige Güter verkaufen, liefern, verbringen oder ausführen.[69] Die obigen Ausführungen zum neuen Art. 8a der Russland-VO können übertragen werden. So wird die Reichweite der Sorgfaltspflicht in Bezug auf Tochterunternehmen auch hier dadurch begrenzt, wenn diese „aus unvermeidbaren Gründen“ nicht in der Lage sind, Kontrolle über das Tochterunternehmen auszuüben.[70] Darunter können ebenfalls Vorschriften eines Drittlands verstanden werden.[71]
Letztlich besteht die Sorgfaltspflicht auch nicht, wenn die EU-Unternehmen die jeweiligen Güter nur innerhalb der Union oder an gewisse Partnerländer (bspw. USA, UK, Norwegen, Schweiz)[72] verkaufen, liefern oder verbringen.[73] Das Umgehungsrisiko wird bei diesen Ländern insofern als gering genug eingestuft, da sie ihrerseits im Wesentlichen gleichwertige Sanktionsmaßnahmen ergriffen haben.[74]
c) „No Russia“-Klauseln
Als weitere flankierende Maßnahme zur Bekämpfung von Sanktionsumgehungen setzt die Russland-VO zudem auf Verpflichtungen zu einem bestimmten vertraglichen Verhalten der EU-Unternehmen. So sind diese verpflichtet, sogenannte „No re-export to Russia“-Klauseln (No Russia-Klausel) im Rahmen bestimmter Geschäftsbeziehungen mit Partnern aus Drittländern zu verwenden. Damit soll die Wiederausfuhr bzw. Weitergabe von Gütern oder Informationen aus Drittländern nach Russland (und mithin die Umgehung der jeweiligen Verbote) vertraglich untersagt werden.
Ausgangspunkt der Vorschrift zur No Russia-Klausel ist Art. 12g der Russland-VO, der eine solche Verpflichtung unter anderem hinsichtlich Transaktionen mit Bezug zu besonders sensiblen und kriegsrelevanten Gütern vorsieht.[75] Mit dem 14. Sanktionspaket kam die Verpflichtung hinzu, ähnliche Klauseln auch für Transaktionen in Bezug auf geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse sowie sonstige Informationen vorzusehen, wenn diese mit gemeinsamen Gütern mit hoher Priorität in Verbindung stehen und ebenfalls an Geschäftspartner übertragen werden sollen – dabei ist sowohl die Weiternutzung durch direkte Geschäftspartner als auch durch Unterlizenznehmer zu untersagen.[76] Beiden Vorschriften ist auch die Verpflichtung gemein, angemessene Abhilfemaßnahmen für den Fall eines Verstoßes gegen die No Russia-Klausel vorzusehen.[77] Ebenso sehen beide eine Meldepflicht vor: Sobald Kenntnis von Verstößen des Partners aus dem Drittland gegen die Klausel erlangt wird, ist dies den zuständigen Behörden zu melden.[78]
Der genaue Anwendungsbereich der Vorschrift sowie die Reichweite der vertraglichen Untersagungspflicht bergen indes erhebliche Unsicherheiten, welche die EU-Kommission mit dem Vorschlag einer Musterklausel kaum beseitigen konnte.[79] Unstreitig dürfte jedoch sein, dass ein Wiederausfuhrverbot und Abhilfemaßnahmen vertraglich fixiert sein müssen.
Straf- und ordnungswidrigkeitsrechtliche Risiken bestehen im Zusammenhang mit der (Nicht-)Aufnahme angemessener Klauseln, obwohl es wie bei den bereits beleuchteten Sorgfaltspflichten in Deutschland an einer direkten Straf- oder Bußgeldbewehrung für Verstöße gegen Art. 12g und 12ga der Russland-VO bisher fehlt.[80] Am Beispiel des Art. 12g Russland-VO bestehen solche Risiken, wenn das gelieferte Gut durch den Vertragspartner tatsächlich nach Russland wiederausgeführt wird und dabei keine No Russia-Klausel vereinbart wurde.[81] Hier besteht das Risiko, dass Ermittlungsbehörden dem Ausführer zumindest einen fahrlässigen Verstoß gegen eines der mittelbaren Ausfuhrverbote vorwerfen könnten, welcher gemäß § 19 Abs. 1 AWG bußgeldbewehrt wäre.[82] Sind darüber hinaus klare Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Vertragspartner die Güter möglicherweise nach Russland weiterliefern könnte, so steht wohl auch der Vorwurf eines Handelns mit Eventualvorsatz und damit eine Strafbarkeit nach § 18 Abs. 1 AWG im Raum.[83] Außerdem sind Verstöße gegen die von beiden No Russia-Klausel-Vorschriften vorgesehenen Meldepflichten über 19 Abs. 5 AWG bußgeldbewehrt.
V. Schadensbegrenzung nach Sanktionsverstößen durch Selbstanzeigen
Sollte ein Unternehmen nun auf einen in seinen Verantwortungsbereich fallenden Sanktionsverstoß aufmerksam werden, so kann die Verlockung groß sein, die Angelegenheit zunächst zur Vermeidung unangenehmer Medienaufmerksamkeit „unter den Teppich zu kehren“. Angesichts der sehr regelmäßigen Prüfungen der Hauptzollämter auf Sanktionsverstöße besteht aber ohnehin ein hohes Aufgriffsrisiko. Unternehmen sollten also in Betracht ziehen, durch proaktives und transparentes Handeln auf Sanktionsverstöße zu reagieren, beispielsweise durch Selbstanzeigen. Diese sind jedoch vorsichtig und grundsätzlich nur auf Grundlage gründlicher interner Ermittlungen und Risikoabwägungen anzugehen.[84]
Konkret sieht das Außenwirtschaftsrecht mit § 22 Abs. 4 AWG die Möglichkeit einer Selbstanzeige vor. Ihr sachlicher Anwendungsbereich ist eher begrenzt, da grundsätzlich nur Verstöße im Sinne des § 19 Abs. 3 bis 5 AWG erfasst werden und somit der Selbstanzeige zugänglich sind.[85] Mithin können Unternehmen mithilfe dieser Selbstanzeige nur der Verfolgung gewisser Ordnungswidrigkeiten entgegentreten.
Am Rande sei bemerkt, dass die rechtsdogmatische Einordnung und damit zugleich die persönliche Reichweite dieser Selbstanzeige umstritten ist. Nach der hier vertretenen Ansicht handelt es sich hierbei um einen persönlichen Straf- bzw. Ahndungsaufhebungsgrund, sodass zwecks Bußgeldfreiheit vorsichtshalber jede möglicherweise am Sanktionsverstoß beteiligte Person die Selbstanzeige erstatten sollte.[86]
Für den hier vorrangig beleuchteten Russland-Sanktionskontext kommen unter anderem folgende fahrlässige Verstöße gegen die Russland-VO in Betracht:
- Die Erfüllung von Ansprüchen sanktionierter Personen, Organisationen und Einrichtungen.[87]
- Geschäfte mit vom russischen Staat kontrollierten bzw. mit diesem verbundenen Unternehmen.[88]
Nicht erfasst sind dagegen strafbewehrte Verstöße, wie beispielsweise vorsätzliche Verstöße gegen Ausfuhrverbote im Sinne des § 18 Abs. 1 AWG. Zudem stellen diese bei fahrlässiger Begehung zwar auch Ordnungswidrigkeiten dar, aber ihre Bußgeldbewehrung ist mit Art. 19 Abs. 1 AWG nicht von der Selbstanzeige im Sinne des § 22 Abs. 4 S. 1 AWG erfasst.
Es kann jedoch auch bei diesen Verstößen außerhalb der Selbstanzeigemöglichkeit von Interesse sein, eine offizielle Meldung abzugeben.[89] § 22 Abs. 4 S. 3 AWG stellt insofern auch klar, dass § 47 OWiG unberührt bleibt. Nach § 47 OWiG, §§ 153, 153a StPO liegt es im behördlichen Ermessen von einer etwaigen Strafverfolgung abzusehen oder eine freiwillige Selbstanzeige zumindest strafmildernd zu berücksichtigen. Der proaktive Umgang eines Unternehmens mit Verstößen – was auch die sorgfältige interne Sachverhaltsermittlung und Offenlegung gegenüber den Behörden umfasst – wird dabei in der Regel von den Behörden begrüßt, sodass sich eine Meldung des Verstoßes vor allem auf die Höhe etwaiger Bußgelder positiv auswirken kann.
Diese wohlwollende Haltung gegenüber der Selbstanzeige von (Sanktions-)Verstößen im Allgemeinen könnte in naher Zukunft zudem verstärkt und juristisch verankert werden. Das 14. Sanktionspaket beinhaltete so auch eine Stärkung der Selbstanzeige: Art. 8 der Russland-VO fordert die Mitgliedsstaaten zur (unter anderem) strafrechtlichen Sanktionierung von Sanktionsverstößen auf. Dieser wurde nun derart neugefasst, dass die freiwillige Selbstanzeige von Verstößen gegen die Russland-VO von den jeweiligen nationalen Vorschriften und zuständigen Behörden ausdrücklich als mildernder Umstand berücksichtigt werden kann.[90] Zudem wird explizit die Anwendbarkeit der bereits erwähnten Richtlinie zur Harmonisierung der strafrechtlichen Sanktionen für EU-Sanktionsverstöße deklariert.[91] Diese legt Mitgliedsstaaten auch ihrerseits nahe, Selbstanzeigen als mildernden Umstand zu berücksichtigen.[92]
VI. Ausblick
Angesichts der aufgezeigten straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen Risiken sollte die Notwendigkeit der Einhaltung der Sanktionsvorgaben sowie der damit verbundene Arbeitsaufwand und die steigenden Anforderungen an die exportkontrollrechtliche Expertise in den Unternehmen keinesfalls unterschätzt werden. Die EU-Kommission und deutsche Behörden werden insbesondere die Wirksamkeit der No Russia-Klauseln aber auch andere Umgehungskonstellationen genau beobachten.[93] Es ist zudem mit einer erhöhten Aktivität der Strafverfolgungsbehörden zu rechnen. Die EU-Kommission kündigte zudem schon an, zukünftig gegebenenfalls die Wiederausfuhrverbotspflicht auch auf Tochterunternehmen zu erstrecken.[94] Vor dem Hintergrund der gestärkten Rolle der Selbstanzeige im Rahmen des 14. Sanktionspakets und der Richtlinie zur Harmonisierung des Sanktionsstrafrechts kann auch damit gerechnet werden, dass die Liste der einer Selbstanzeige zugänglichen Sanktionsverstöße zukünftig durch den nationalen Gesetzgeber erweitert wird.
* Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag der Autoren anlässlich der WisteV-wistra Neujahrstagung am 19. Januar 2024. Aktuelle Entwicklungen wurden bis August 2024 aufgenommen.
[1]Moller-Nielsen, „Studie: EU-Sanktionen gegen Russland werden massiv „umgangen““, 26.02.2023 in EURACTIV, abrufbar unter https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/studie-eu-sanktionen-gegen-russland-werden-massiv-umgangen/, zuletzt abgerufen am 07.08.2023.
[2] Vgl. Louca/Ackermann, AW-Prax 10/2023, 522, 524.
[3] Art. 12 Russland-VO.
[4] Art. 7 Abs. 4 VO (EG) Nr. 423/2007: „Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Maßnahmen bezweckt oder bewirkt wird.“
[5] EuGH, Urteil vom 21 Dezember 2011, C-72/11, Rn. 67-68.
[6] Vgl. EU-Kommission, Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No. 833/2014 and Council Regulation No 269/2014, zuletzt aktualisiert am 26.07.2024, abrufbar unter https://finance.ec.europa.eu/document/download/66e8fd7d-8057-4b9b-96c2-5e54bf573cd1_en?filename=faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf (im Folgenden: EU-Kommission, Consolidated FAQs), Abschnitt A.2.7.
[7] Erwägungsgrund 37 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[8] Art. 1 Nr. 2 VO (EU) 2024/1739.
[9] Art. 3 Abs. 1 lit. h) Richtlinie (EU) Nr. 2024/1226.
[10] EuGH, Urteil vom 21 Dezember 2011, C-72/11, Rn. 62.
[11] Vgl. bspw. Art. 2 Abs. 1 Russland-VO.
[12] EU-Kommission, Consolidated FAQs, Abschnitt G. 2. 23.
[13]Schäffer, RIW 2023, 777, 779-782.
[14]Coerper/Tandler-Schneider/Strompen, „Undercover: Wie Russland Sanktionen umgeht“, 14.03.2023 in ZDF frontal, abrufbar unter https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/russland-sanktionen-holz-ukraine-krieg-frontal-100.html, zuletzt abgerufen am 07.08.2024.
[15] Art. 3i Abs. 1 Russland-VO.
[16] EuGH, Urteil vom 21 Dezember 2011, C-72/11, Rn. 62.
[17] Art. 60 Abs. 2 Unionszollkodex.
[18]Galander/Göcke, UKuR 2023, 7, 8.
[19]Nagel/Murphy/Verfürden, „Russische Rüstungsfirma soll Bauteile von Rohde & Schwarz nutzen“, 17.01.2024 in Handelsblatt, abrufbar unter: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ruestungsindustrie-russische-ruestungsfirma-soll-bauteile-von-rohde-schwarz-nutzen/100007502.html, zuletzt abgerufen am 07.08.2024.
[20] Vgl. Art. 2 Abs. 1 Russland-VO.
[21] EuGH, Urteil vom 21 Dezember 2011, C-72/11, Rn. 62.
[22] BGH, Urt. v. 30.03.2021, 3 StR 474/19.
[23] Art. 1 c) Russland-VO.
[24]Louca/Ackermann, AW-Prax 10/2023, 522.
[25] BAFA, Entwicklungen des Iran-Embargos, 2017, abrufbar unter: https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_iran_embargo.html, S. 11.
[26]Louca/Ackermann, AW-Prax 10/2023, 522.
[27]Barowski/Rohr, AW-Prax 06/2024, 229, 232.
[28]Louca/Ackermann, AW-Prax 10/2023, 523.
[29] Vgl. bspw. Art. 3h Abs. 1 i.V.m. Anhang XVIII Kategorie 17 Russland-VO.
[30]Louca/Ackermann, AW-Prax 10/2023, 523.
[31]Louca/Ackermann, AW-Prax 10/2023, 523.
[32] BT-Drucks. 17/11127, S. 27; BGH, Beschluss vom 23. April 2010 – AK 2/10 –, BGHSt 55, 94-107, juris Rn. 30 f.
[33] BT-Drucks. 17/11127, S. 27.
[34] BT-Drucks. 17/11127, S. 27.
[35] BT-Drucks. 17/11127, S. 27.
[36] BGH, Beschluss vom 23. April 2010 – AK 2/10 –, BGHSt 55, 94-107, juris Rn. 17.
[37] BT-Drucks. 17/11127, S. 27; EuGH, Urteil vom 21 Dezember 2011, C-72/11, Rn. 40.
[38] EuGH, Urteil vom 21 Dezember 2011, C-72/11, Rn. 60-62.
[39] EuGH, Urteil vom 21 Dezember 2011, C-72/11, Rn. 61.
[40]Lehner, UKuR 2023, 105, 106.
[41] In diesem Sinne auch Lehner, UKuR 2023, 105, 106.
[42] BT-Drucks. 17/11127, S. 27.
[43] BT-Drucks. 17/11127, S. 27.
[44]Lehner, UKuR 2023, 105, 106 – am Beispiel der Belarus-Sanktionen.
[45] Vgl. auch Erwägungsgrund 15 Richtlinie (EU) Nr. 2024/1226.
[46] BWMK, „Sanktionsumgehung – Hinweispapier zur Unterstützung der Unternehmen beim Umgang mit warenverkehrsbezogenen Sanktionen“, 20.12.2023, abrufbar unter: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/sanktionsumgehung-hinweispapier-fuer-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=8 , zuletzt abgerufen am 07.08.2023.
[47] Vgl. bspw. in Bezug auf das Verbringungsverbot: Göcke, ZASA 2024, 82, 84-87.
[48] Art. 1 Nr. 22 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[49] Vgl. auch Erwägungsrund 29 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[50] Art. 8a Russland-VO.
[51] Erwägungsgrund 28 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[52] Vgl z.B. Art. 5 Abs. 1 lit. b) Russland-VO.
[53] Vgl. mit ähnlichem Gedanken in Bezug auf den Sorgfaltsmaßstab: Erwägungsgrund 30 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[54] Erwägungsgrund 30 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[55] Erwägungsgrund 30 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[56] Erwägungsgrund 30 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[57] Erwägungsgrund 30 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[58] Art. 8a Russland-VO.
[59] „Untergraben“ auf Duden online, abrufbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/untergraben_untergraben, zuletzt abgerufen am 14.08.2024.
[60] In diesem Sinne in Bezug auf die Sanktionierung von Umgehungshandlungen: Galander/Göcke, UKuR 2023, 7, 8.
[61] Vgl. Art. 13 Russland-VO.; EU-Kommission, Consolidated FAQs, Abschnitt D. 2. 34; Erwägungsgrund 27 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[62]https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/the-eu-paradox-with-tackling-sanctions-circumvention/
[63] Art. 1 Nr. 28 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[64] Anhang XL der Russland-VO n.F.; EU-Kommission, List of common high priority items, zuletzt aktualisiert am 22.02.2024, abrufbar unter: https://finance.ec.europa.eu/document/download/5a2494db-d874-4e2b-bf2a-ec5a191d2dc0_en?filename=list-common-high-priority-items_en.pdf (im Folgenden: EU-Kommission, List of common high priority items).
[65] EU-Kommission, List of common high priority items S. 1.
[66] Art. 12gb Abs. 1 lit. a) Russland-VO.
[67] Art. 12gb Abs. 1 lit. b) Russland-VO.
[68] Art. 12gb Abs. 1 lit. b) Russland-VO.
[69] Art. 12gb Abs. 3 Russland-VO.
[70] Art. 12gb Abs. 4 Russland-VO.
[71] In diesem Sinne wohl Erwägungsgrund 35 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[72] Anhang VIII Russland-VO.
[73] Art. 12g Abs. 2 Russland-VO.
[74]Stein/Ackermann, ZfZ 2024, 180, 183.
[75] Güter und Technologien, die in den Anhängen XI, XX, XXXV, XL der VO (EU) Nr. 833/2014 genannt sind sowie Feuerwaffen und Munition gemäß Anhang I der VO (EU) Nr. 258/2012 (Feuerwaffenverordnung).
[76] Art. 12ga Russland-VO.
[77] Art. 12g Abs. 3; Art. 12ga Abs. 3 Russland-VO.
[78] Art. 12g Abs. 4; Art. 12ga Abs. 4 Russland-VO.
[79]Stein/Ackermann, ZfZ 2024, 180, 181-186.
[80] Ebenso davon ausgehend, dass es bisher an einer eindeutigen Straf- bzw. Bußgeldbewehrung für Verstöße gegen Art. 12g VO (EU) Nr. 833/2014 fehlt: Gnielinski/Brzoska, AW-Prax 2024, 179-181.
[81]Stein/Ackermann, ZfZ 2024, 180, 187.
[82]Stein/Ackermann, ZfZ 2024, 180, 187.
[83]Stein/Ackermann, ZfZ 2024, 180, 187.
[84] Siehe zu den Einzelheiten: Abersfelder, Beck Newsdienst Compliance 2024, 210001; Stein/von Rummel, AW-Prax 07/2020, 277.
[85] § 22 Abs. 4 S.1 AWG.
[86]Stein/Louca in: Dorsch, Zollrecht, 225. Ergänzungslieferung, Mai 2024, § 22 AWG Rn 8; a.A.: Pelz in: Sachs/Pelz, Außenwirtschaftsrecht, 3. Auflage 2024, § 22 AWG, Rn 13-14.
[87] §§ 22 Abs. 4 S. 1, 19 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 AWG i.V.m. § 82 Abs. 1 Nr. 10 AWV i.Vm. Art, 11 Russland-VO.
[88] §§ 22 Abs. 4 S. 1, 19 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 AWG i.V.m. § 82 Abs. 9 AWV i.V.m. Art. 5aa Abs. 1 Russland-VO.
[89]Stein/von Rummel, AW-Prax 07/2020, 277, 279.
[90] Art. 8 Russland-VO.n.F.; vgl. auch Erwägungsgrund 26 VO VO (EU) Nr. 2024/1745.
[91] Erwägungsgrund 26 VO VO (EU) Nr. 2024/1745.
[92] Art. 9 Richtlinie (EU) Nr. 2024/2026.
[93] Erwägungsgrund 32 VO (EU) Nr. 2024/1745.
[94] Erwägungsgrund 32 VO (EU) Nr. 2024/1745.